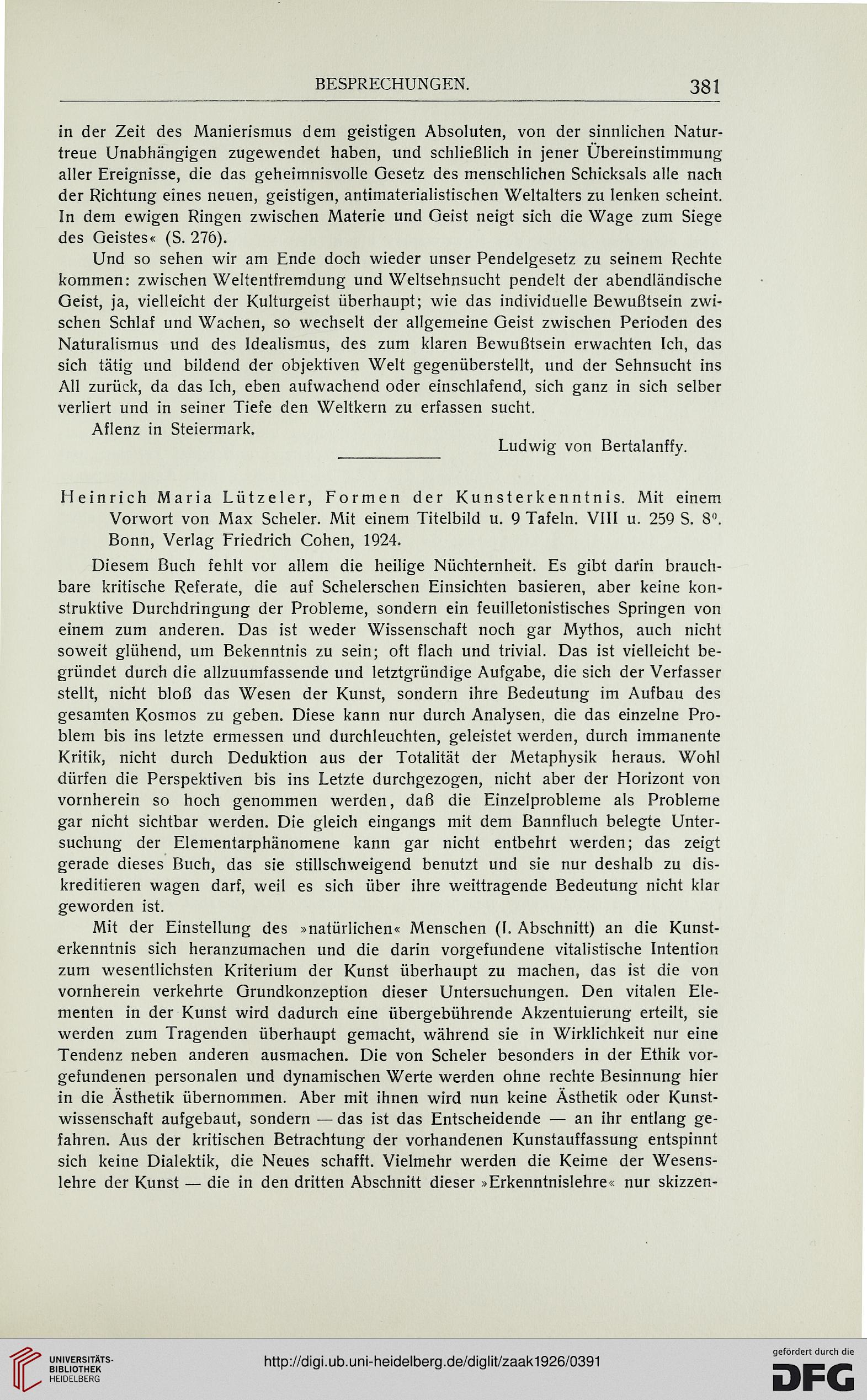BESPRECHUNGEN.
381
in der Zeit des Manierismus dem geistigen Absoluten, von der sinnlichen Natur-
treue Unabhängigen zugewendet haben, und schließlich in jener Übereinstimmung
aller Ereignisse, die das geheimnisvolle Gesetz des menschlichen Schicksals alle nach
der Richtung eines neuen, geistigen, antimaterialistischen Weltalters zu lenken scheint.
In dem ewigen Ringen zwischen Materie und Geist neigt sich die Wage zum Siege
des Geistes« (S. 276).
Und so sehen wir am Ende doch wieder unser Pendelgesetz zu seinem Rechte
kommen: zwischen Weltentfremdung und Weltsehnsucht pendelt der abendländische
Geist, ja, vielleicht der Kulturgeist überhaupt; wie das individuelle Bewußtsein zwi-
schen Schlaf und Wachen, so wechselt der allgemeine Geist zwischen Perioden des
Naturalismus und des Idealismus, des zum klaren Bewußtsein erwachten Ich, das
sich tätig und bildend der objektiven Welt gegenüberstellt, und der Sehnsucht ins
All zurück, da das Ich, eben aufwachend oder einschlafend, sich ganz in sich selber
verliert und in seiner Tiefe den Weltkern zu erfassen sucht.
Aflenz in Steiermark.
Ludwig von Bertalanffy.
Heinrich Maria Lützeler, Formen der Kunsterkenntnis. Mit einem
Vorwort von Max Scheler. Mit einem Titelbild u. 9 Tafeln. VIII u. 259 S. 8°.
Bonn, Verlag Friedrich Cohen, 1924.
Diesem Buch fehlt vor allem die heilige Nüchternheit. Es gibt darin brauch-
bare kritische Referate, die auf Schelerschen Einsichten basieren, aber keine kon-
struktive Durchdringung der Probleme, sondern ein feuilletonistisches Springen von
einem zum anderen. Das ist weder Wissenschaft noch gar Mythos, auch nicht
soweit glühend, um Bekenntnis zu sein; oft flach und trivial. Das ist vielleicht be-
gründet durch die allzuumfassende und letztgründige Aufgabe, die sich der Verfasser
stellt, nicht bloß das Wesen der Kunst, sondern ihre Bedeutung im Aufbau des
gesamten Kosmos zu geben. Diese kann nur durch Analysen, die das einzelne Pro-
blem bis ins letzte ermessen und durchleuchten, geleistet werden, durch immanente
Kritik, nicht durch Deduktion aus der Totalität der Metaphysik heraus. Wohl
dürfen die Perspektiven bis ins Letzte durchgezogen, nicht aber der Horizont von
vornherein so hoch genommen werden, daß die Einzelprobleme als Probleme
gar nicht sichtbar werden. Die gleich eingangs mit dem Bannfluch belegte Unter-
suchung der Elementarphänomene kann gar nicht entbehrt werden; das zeigt
gerade dieses Buch, das sie stillschweigend benutzt und sie nur deshalb zu dis-
kreditieren wagen darf, weil es sich über ihre weittragende Bedeutung nicht klar
geworden ist.
Mit der Einstellung des »natürlichen« Menschen (I. Abschnitt) an die Kunst-
erkenntnis sich heranzumachen und die darin vorgefundene vitalistische Intention
zum wesentlichsten Kriterium der Kunst überhaupt zu machen, das ist die von
vornherein verkehrte Grundkonzeption dieser Untersuchungen. Den vitalen Ele-
menten in der Kunst wird dadurch eine übergebührende Akzentuierung erteilt, sie
werden zum Tragenden überhaupt gemacht, während sie in Wirklichkeit nur eine
Tendenz neben anderen ausmachen. Die von Scheler besonders in der Ethik vor-
gefundenen personalen und dynamischen Werte werden ohne rechte Besinnung hier
in die Ästhetik übernommen. Aber mit ihnen wird nun keine Ästhetik oder Kunst-
wissenschaft aufgebaut, sondern — das ist das Entscheidende — an ihr entlang ge-
fahren. Aus der kritischen Betrachtung der vorhandenen Kunstauffassung entspinnt
sich keine Dialektik, die Neues schafft. Vielmehr werden die Keime der Wesens-
lehre der Kunst — die in den dritten Abschnitt dieser »Erkenntnislehre« nur skizzen-
381
in der Zeit des Manierismus dem geistigen Absoluten, von der sinnlichen Natur-
treue Unabhängigen zugewendet haben, und schließlich in jener Übereinstimmung
aller Ereignisse, die das geheimnisvolle Gesetz des menschlichen Schicksals alle nach
der Richtung eines neuen, geistigen, antimaterialistischen Weltalters zu lenken scheint.
In dem ewigen Ringen zwischen Materie und Geist neigt sich die Wage zum Siege
des Geistes« (S. 276).
Und so sehen wir am Ende doch wieder unser Pendelgesetz zu seinem Rechte
kommen: zwischen Weltentfremdung und Weltsehnsucht pendelt der abendländische
Geist, ja, vielleicht der Kulturgeist überhaupt; wie das individuelle Bewußtsein zwi-
schen Schlaf und Wachen, so wechselt der allgemeine Geist zwischen Perioden des
Naturalismus und des Idealismus, des zum klaren Bewußtsein erwachten Ich, das
sich tätig und bildend der objektiven Welt gegenüberstellt, und der Sehnsucht ins
All zurück, da das Ich, eben aufwachend oder einschlafend, sich ganz in sich selber
verliert und in seiner Tiefe den Weltkern zu erfassen sucht.
Aflenz in Steiermark.
Ludwig von Bertalanffy.
Heinrich Maria Lützeler, Formen der Kunsterkenntnis. Mit einem
Vorwort von Max Scheler. Mit einem Titelbild u. 9 Tafeln. VIII u. 259 S. 8°.
Bonn, Verlag Friedrich Cohen, 1924.
Diesem Buch fehlt vor allem die heilige Nüchternheit. Es gibt darin brauch-
bare kritische Referate, die auf Schelerschen Einsichten basieren, aber keine kon-
struktive Durchdringung der Probleme, sondern ein feuilletonistisches Springen von
einem zum anderen. Das ist weder Wissenschaft noch gar Mythos, auch nicht
soweit glühend, um Bekenntnis zu sein; oft flach und trivial. Das ist vielleicht be-
gründet durch die allzuumfassende und letztgründige Aufgabe, die sich der Verfasser
stellt, nicht bloß das Wesen der Kunst, sondern ihre Bedeutung im Aufbau des
gesamten Kosmos zu geben. Diese kann nur durch Analysen, die das einzelne Pro-
blem bis ins letzte ermessen und durchleuchten, geleistet werden, durch immanente
Kritik, nicht durch Deduktion aus der Totalität der Metaphysik heraus. Wohl
dürfen die Perspektiven bis ins Letzte durchgezogen, nicht aber der Horizont von
vornherein so hoch genommen werden, daß die Einzelprobleme als Probleme
gar nicht sichtbar werden. Die gleich eingangs mit dem Bannfluch belegte Unter-
suchung der Elementarphänomene kann gar nicht entbehrt werden; das zeigt
gerade dieses Buch, das sie stillschweigend benutzt und sie nur deshalb zu dis-
kreditieren wagen darf, weil es sich über ihre weittragende Bedeutung nicht klar
geworden ist.
Mit der Einstellung des »natürlichen« Menschen (I. Abschnitt) an die Kunst-
erkenntnis sich heranzumachen und die darin vorgefundene vitalistische Intention
zum wesentlichsten Kriterium der Kunst überhaupt zu machen, das ist die von
vornherein verkehrte Grundkonzeption dieser Untersuchungen. Den vitalen Ele-
menten in der Kunst wird dadurch eine übergebührende Akzentuierung erteilt, sie
werden zum Tragenden überhaupt gemacht, während sie in Wirklichkeit nur eine
Tendenz neben anderen ausmachen. Die von Scheler besonders in der Ethik vor-
gefundenen personalen und dynamischen Werte werden ohne rechte Besinnung hier
in die Ästhetik übernommen. Aber mit ihnen wird nun keine Ästhetik oder Kunst-
wissenschaft aufgebaut, sondern — das ist das Entscheidende — an ihr entlang ge-
fahren. Aus der kritischen Betrachtung der vorhandenen Kunstauffassung entspinnt
sich keine Dialektik, die Neues schafft. Vielmehr werden die Keime der Wesens-
lehre der Kunst — die in den dritten Abschnitt dieser »Erkenntnislehre« nur skizzen-