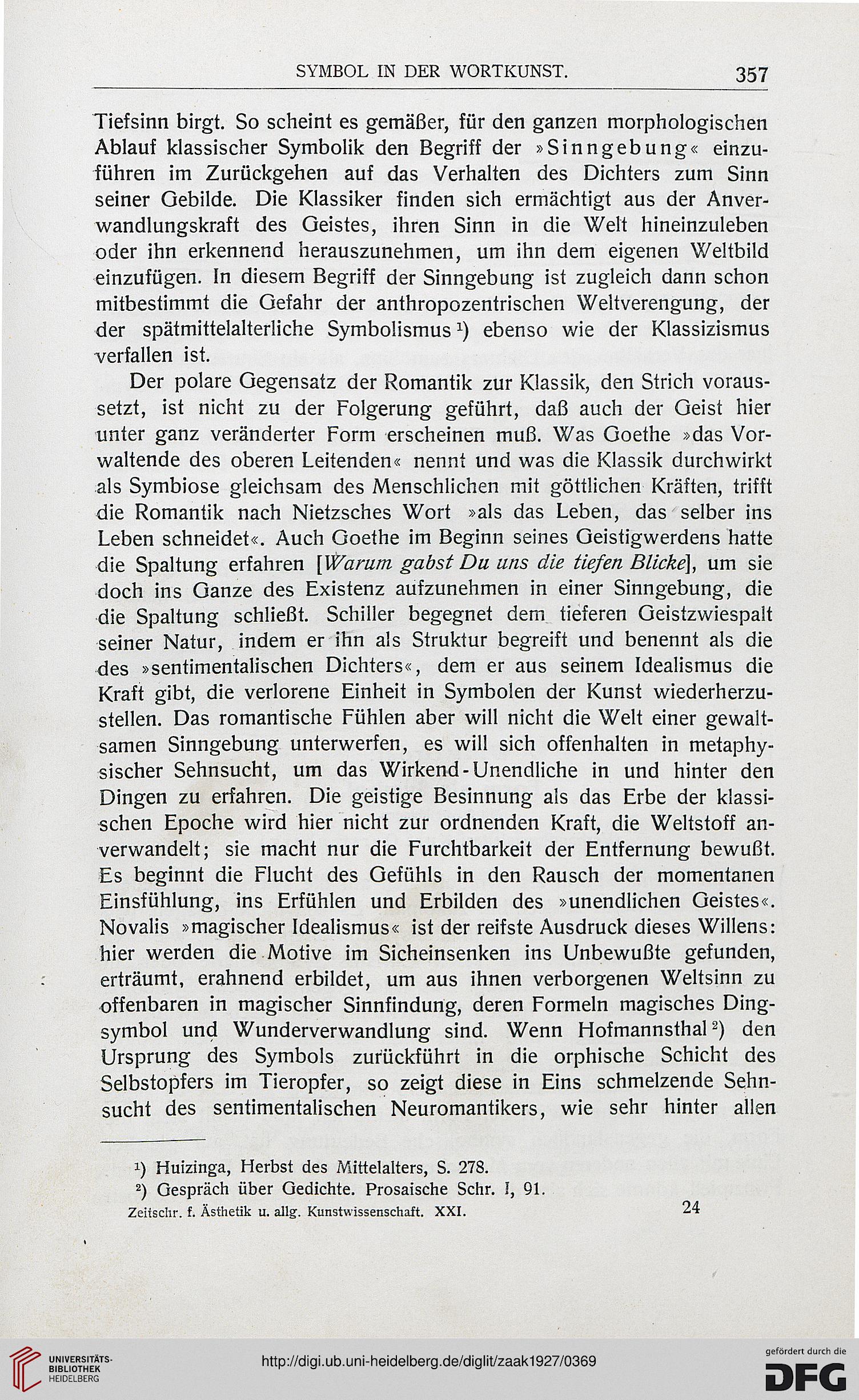SYMBOL IN DER WORTKUNST.
357
Tiefsinn birgt. So scheint es gemäßer, für den ganzen morphologischen
Ablauf klassischer Symbolik den Begriff der »Sinngebung« einzu-
führen im Zurückgehen auf das Verhalten des Dichters zum Sinn
seiner Gebilde. Die Klassiker finden sich ermächtigt aus der Anver-
wandlungskraft des Geistes, ihren Sinn in die Welt hineinzuleben
oder ihn erkennend herauszunehmen, um ihn dem eigenen Weltbild
einzufügen. In diesem Begriff der Sinngebung ist zugleich dann schon
mitbestimmt die Gefahr der anthropozentrischen Weltverengung, der
der spätmittelalterliche SymbolismusJ) ebenso wie der Klassizismus
verfallen ist.
Der polare Gegensatz der Romantik zur Klassik, den Strich voraus-
setzt, ist nicht zu der Folgerung geführt, daß auch der Geist hier
unter ganz veränderter Form erscheinen muß. Was Goethe »das Vor-
waltende des oberen Leitenden« nennt und was die Klassik durchwirkt
als Symbiose gleichsam des Menschlichen mit göttlichen Kräften, trifft
die Romantik nach Nietzsches Wort »als das Leben, das selber ins
Leben schneidet«. Auch Goethe im Beginn seines Geistigwerdens hatte
die Spaltung erfahren {Warum gabst Du uns die tiefen Blicke], um sie
doch ins Ganze des Existenz aufzunehmen in einer Sinngebung, die
die Spaltung schließt. Schiller begegnet dem tieferen Geisfzwiespait
seiner Natur, indem er ihn als Struktur begreift und benennt als die
des »sentimentalischen Dichters«, dem er aus seinem Idealismus die
Kraft gibt, die verlorene Einheit in Symbolen der Kunst wiederherzu-
stellen. Das romantische Fühlen aber will nicht die Welt einer gewalt-
samen Sinngebung unterwerfen, es will sich offenhalten in metaphy-
sischer Sehnsucht, um das Wirkend-Unendliche in und hinter den
Dingen zu erfahren. Die geistige Besinnung als das Erbe der klassi-
schen Epoche wird hier nicht zur ordnenden Kraft, die Weltstoff an-
verwandelt; sie macht nur die Furchtbarkeit der Entfernung bewußt.
Es beginnt die Flucht des Gefühls in den Rausch der momentanen
Einsfühlung, ins Erfühlen und Erbilden des »unendlichen Geistes«.
Novalis »magischer Idealismus« ist der reifste Ausdruck dieses Willens:
hier werden die Motive im Sicheinsenken ins Unbewußte gefunden,
erträumt, erahnend erbildet, um aus ihnen verborgenen Weltsinn zu
offenbaren in magischer Sinnfindung, deren Formeln magisches Ding-
symbol und Wunderverwandlung sind. Wenn Hofmannsthal2) den
Ursprung des Symbols zurückführt in die orphische Schicht des
Selbstopfers im Tieropfer, so zeigt diese in Eins schmelzende Sehn-
sucht des sentimentalischen Neuromantikers, wie sehr hinter allen
1) Huizinga, Herbst des Mittelalters, S. 278.
2) Gespräch über Gedichte. Prosaische Sehr. !, 91.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXI.
357
Tiefsinn birgt. So scheint es gemäßer, für den ganzen morphologischen
Ablauf klassischer Symbolik den Begriff der »Sinngebung« einzu-
führen im Zurückgehen auf das Verhalten des Dichters zum Sinn
seiner Gebilde. Die Klassiker finden sich ermächtigt aus der Anver-
wandlungskraft des Geistes, ihren Sinn in die Welt hineinzuleben
oder ihn erkennend herauszunehmen, um ihn dem eigenen Weltbild
einzufügen. In diesem Begriff der Sinngebung ist zugleich dann schon
mitbestimmt die Gefahr der anthropozentrischen Weltverengung, der
der spätmittelalterliche SymbolismusJ) ebenso wie der Klassizismus
verfallen ist.
Der polare Gegensatz der Romantik zur Klassik, den Strich voraus-
setzt, ist nicht zu der Folgerung geführt, daß auch der Geist hier
unter ganz veränderter Form erscheinen muß. Was Goethe »das Vor-
waltende des oberen Leitenden« nennt und was die Klassik durchwirkt
als Symbiose gleichsam des Menschlichen mit göttlichen Kräften, trifft
die Romantik nach Nietzsches Wort »als das Leben, das selber ins
Leben schneidet«. Auch Goethe im Beginn seines Geistigwerdens hatte
die Spaltung erfahren {Warum gabst Du uns die tiefen Blicke], um sie
doch ins Ganze des Existenz aufzunehmen in einer Sinngebung, die
die Spaltung schließt. Schiller begegnet dem tieferen Geisfzwiespait
seiner Natur, indem er ihn als Struktur begreift und benennt als die
des »sentimentalischen Dichters«, dem er aus seinem Idealismus die
Kraft gibt, die verlorene Einheit in Symbolen der Kunst wiederherzu-
stellen. Das romantische Fühlen aber will nicht die Welt einer gewalt-
samen Sinngebung unterwerfen, es will sich offenhalten in metaphy-
sischer Sehnsucht, um das Wirkend-Unendliche in und hinter den
Dingen zu erfahren. Die geistige Besinnung als das Erbe der klassi-
schen Epoche wird hier nicht zur ordnenden Kraft, die Weltstoff an-
verwandelt; sie macht nur die Furchtbarkeit der Entfernung bewußt.
Es beginnt die Flucht des Gefühls in den Rausch der momentanen
Einsfühlung, ins Erfühlen und Erbilden des »unendlichen Geistes«.
Novalis »magischer Idealismus« ist der reifste Ausdruck dieses Willens:
hier werden die Motive im Sicheinsenken ins Unbewußte gefunden,
erträumt, erahnend erbildet, um aus ihnen verborgenen Weltsinn zu
offenbaren in magischer Sinnfindung, deren Formeln magisches Ding-
symbol und Wunderverwandlung sind. Wenn Hofmannsthal2) den
Ursprung des Symbols zurückführt in die orphische Schicht des
Selbstopfers im Tieropfer, so zeigt diese in Eins schmelzende Sehn-
sucht des sentimentalischen Neuromantikers, wie sehr hinter allen
1) Huizinga, Herbst des Mittelalters, S. 278.
2) Gespräch über Gedichte. Prosaische Sehr. !, 91.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXI.