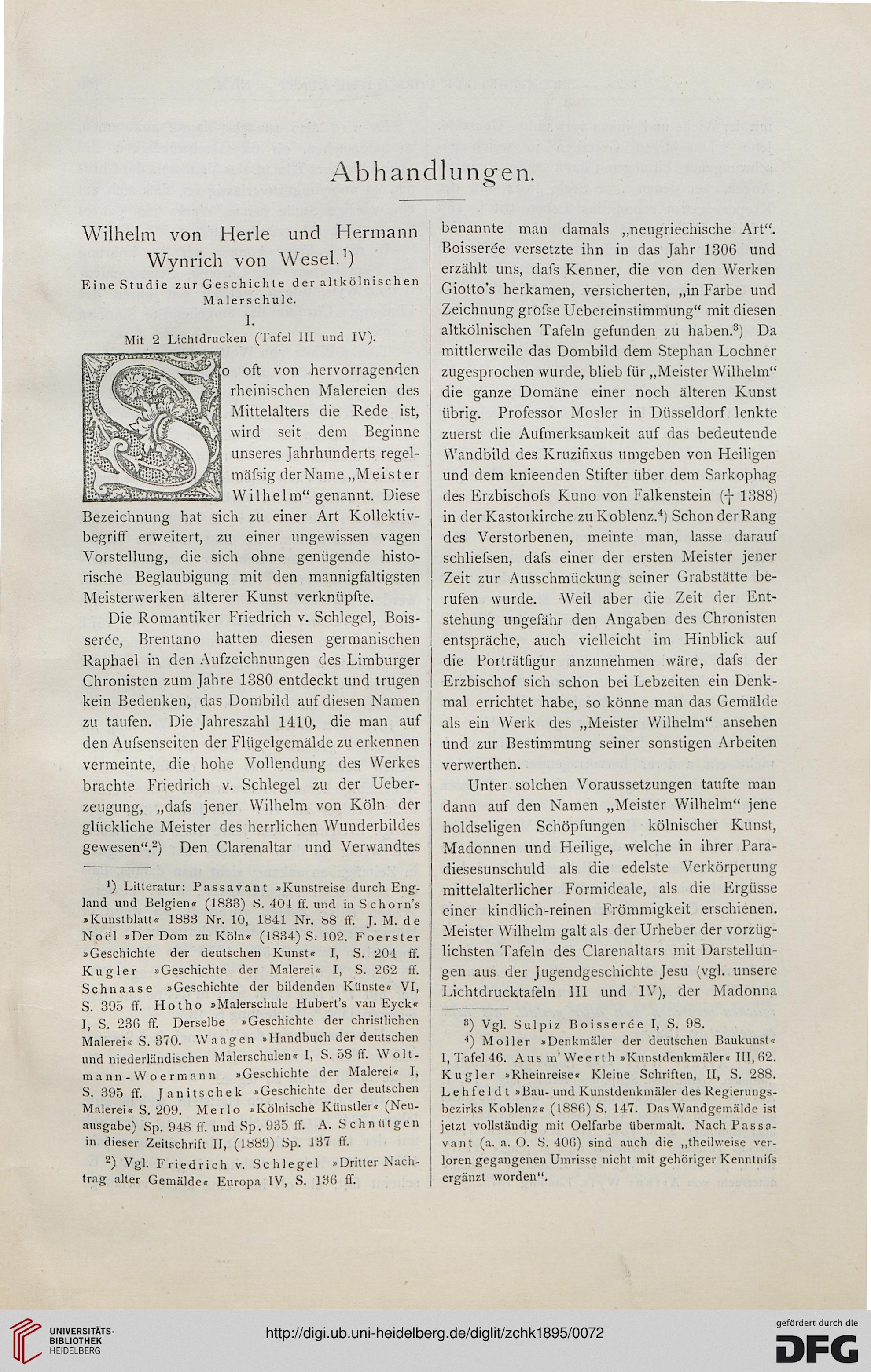Abhandlungen.
Wilhelm von Herle und Hermann
Wynrich von Wesel.1)
Eine Studie zur Geschichte der altkölnischen
Malerschule.
I.
Mit 2 Lichtdrucken (Tafel III und IV).
o oft von hervorragenden
rheinischen Malereien des
Mittelalters die Rede ist,
wird seit dem Beginne
unseres Jahrhunderts regel-
mäfsig der Name „Meister
Wilhelm" genannt. Diese
Bezeichnung hat sich zu einer Art Kollektiv-
begriff erweitert, zu einer Ungewissen vagen
Vorstellung, die sich ohne genügende histo-
rische Beglaubigung mit den mannigfaltigsten
Meisterwerken älterer Kunst verknüpfte.
Die Romantiker Friedrich v. Schlegel, Bois-
serde, Brentano hatten diesen germanischen
Raphael in den Aufzeichnungen des Limburger
Chronisten zum Jahre 1380 entdeckt und trugen
kein Bedenken, das Dombild auf diesen Namen
zu taufen. Die Jahreszahl 1410, die man auf
den Aufsenseiten der Flügelgemälde zu erkennen
vermeinte, die hohe Vollendung des Werkes
brachte Friedrich v. Schlegel zu der Ueber-
zeugung, „dafs jener Wilhelm von Köln der
glückliche Meister des herrlichen Wunderbildes
gewesen".2) Den Ciarenaltar und Verwandtes
') Litteratur: Passavant »Kunstreise durch Eng-
land und Belgien« (1833) S. 401 ff. und in Schorn's
»Kunstblatt« 1833 Nr. 10, 1841 Nr. 88 ff. J. M. de
Noel «Der Dom zu Köln« (1834) S. 102. Foerster
»Geschichte der deutschen Kunst« I, S. 204 ff.
Kugler »Geschichte der Malerei« I, S. 2G2 ff.
Schnaase »Geschichte der bildenden Künste« VI,
S. 305 ff. Hot ho »Malerschule Hubert's van Eyck«
I, S. 23ß ff. Derselbe »Geschichte der christlichen
Malerei« S. 370. Waagen »Handbuch der deutschen
und niederländischen Malerschulen« I, S. 58 ff. Wolf.
mann-Woermann »Geschichte der Malerei« 1,
S. 395 ff. Janitschek »Geschichte der deutschen
Malereic S. 209. Merlo »Kölnische Künstler« (Neu-
ausgabe) Sp. 948 ff. und Sp. 935 ff. A. Sehn tilgen
in dieser Zeitschrift II, (1889) Sp. 137 ff.
2) Vgl. Friedrich v. Schlegel »Dritter Nach-
trag alter Gemälde« Europa IV, S. 186 ff.
benannte man damals „neugriechische Art".
Boisseree versetzte ihn in das Jahr 1306 und
erzählt uns, dafs Kenner, die von den Werken
Giolto's herkamen, versicherten, „in Farbe und
Zeichnung grofse Uebereinstimmung" mit diesen
altkölnischen Tafeln gefunden zu haben.8) Da
mittlerweile das Dombild dem Stephan Lochner
zugesprochen wurde, blieb für „Meister Wilhelm"
die ganze Domäne einer noch älteren Kunst
übrig. Professor Mosler in Düsseldorf lenkte
zuerst die Aufmerksamkeit auf das bedeutende
Wandbild des Kruzifixus umgeben von Heiligen
und dem knieenden Stifter über dem Sarkophag
des Erzbischofs Kuno von Falkenstein (-j- 1388)
in der Kastoikirche zu Koblenz.4) Schon derRang
des Verstorbenen, meinte man, lasse darauf
schliefsen, dafs einer der ersten Meister jener
Zeit zur Ausschmückung seiner Grabstätte be-
rufen wurde. Weil aber die Zeit der Eni«
stehung ungefähr den Angaben des Chronisten
entspräche, auch vielleicht im Hinblick auf
die Porträtfigur anzunehmen wäre, dafs der
Erzbischof sich schon bei Lebzeiten ein Denk-
mal errichtet habe, so könne man das Gemälde
als ein Werk des „Meister Wilhelm" ansehen
und zur Bestimmung seiner sonstigen Arbeiten
verwerthen.
Unter solchen Voraussetzungen taufte man
dann auf den Namen „Meister Wilhelm" jene
holdseligen Schöpfungen kölnischer Kunst,
Madonnen und Heilige, welche in ihrer Para-
diesesunschuld als die edelste Verkörperung
mittelalterlicher Formideale, als die Ergüsse
einer kindlich-reinen Frömmigkeit erschienen.
Meister Wilhelm galt als der Urheber der vorzüg-
lichsten Tafeln des Clarenaltars mit Darstellun-
gen aus der Jugendgeschichte Jesu (vgl. unsere
Lichtdrucktafeln 111 und IV), der Madonna
3) Vgl. Sulpiz Boisseree I, S. 98.
4) Moller »Denkmäler der deutschen Baukunst«
I,Tafel l(i. Aus m'Weerth »Kunstdenkmäler« 111,62.
Kugler »Kheinreise« Kleine Schriften, II, S. 288.
L e h f e I d t »Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-
bezirks Koblenz« (18SG) S. 147. Das Wandgemälde ist
jetzt vollständig mit Oelfarbe übermalt. Nach Passo-
vant (a. a. (). S. 40(1) sind auch die „theilweise vcr.
loren gegangenen Umrisse nicht mit gehöriger Kenntnifs
ergänzt worden".
Wilhelm von Herle und Hermann
Wynrich von Wesel.1)
Eine Studie zur Geschichte der altkölnischen
Malerschule.
I.
Mit 2 Lichtdrucken (Tafel III und IV).
o oft von hervorragenden
rheinischen Malereien des
Mittelalters die Rede ist,
wird seit dem Beginne
unseres Jahrhunderts regel-
mäfsig der Name „Meister
Wilhelm" genannt. Diese
Bezeichnung hat sich zu einer Art Kollektiv-
begriff erweitert, zu einer Ungewissen vagen
Vorstellung, die sich ohne genügende histo-
rische Beglaubigung mit den mannigfaltigsten
Meisterwerken älterer Kunst verknüpfte.
Die Romantiker Friedrich v. Schlegel, Bois-
serde, Brentano hatten diesen germanischen
Raphael in den Aufzeichnungen des Limburger
Chronisten zum Jahre 1380 entdeckt und trugen
kein Bedenken, das Dombild auf diesen Namen
zu taufen. Die Jahreszahl 1410, die man auf
den Aufsenseiten der Flügelgemälde zu erkennen
vermeinte, die hohe Vollendung des Werkes
brachte Friedrich v. Schlegel zu der Ueber-
zeugung, „dafs jener Wilhelm von Köln der
glückliche Meister des herrlichen Wunderbildes
gewesen".2) Den Ciarenaltar und Verwandtes
') Litteratur: Passavant »Kunstreise durch Eng-
land und Belgien« (1833) S. 401 ff. und in Schorn's
»Kunstblatt« 1833 Nr. 10, 1841 Nr. 88 ff. J. M. de
Noel «Der Dom zu Köln« (1834) S. 102. Foerster
»Geschichte der deutschen Kunst« I, S. 204 ff.
Kugler »Geschichte der Malerei« I, S. 2G2 ff.
Schnaase »Geschichte der bildenden Künste« VI,
S. 305 ff. Hot ho »Malerschule Hubert's van Eyck«
I, S. 23ß ff. Derselbe »Geschichte der christlichen
Malerei« S. 370. Waagen »Handbuch der deutschen
und niederländischen Malerschulen« I, S. 58 ff. Wolf.
mann-Woermann »Geschichte der Malerei« 1,
S. 395 ff. Janitschek »Geschichte der deutschen
Malereic S. 209. Merlo »Kölnische Künstler« (Neu-
ausgabe) Sp. 948 ff. und Sp. 935 ff. A. Sehn tilgen
in dieser Zeitschrift II, (1889) Sp. 137 ff.
2) Vgl. Friedrich v. Schlegel »Dritter Nach-
trag alter Gemälde« Europa IV, S. 186 ff.
benannte man damals „neugriechische Art".
Boisseree versetzte ihn in das Jahr 1306 und
erzählt uns, dafs Kenner, die von den Werken
Giolto's herkamen, versicherten, „in Farbe und
Zeichnung grofse Uebereinstimmung" mit diesen
altkölnischen Tafeln gefunden zu haben.8) Da
mittlerweile das Dombild dem Stephan Lochner
zugesprochen wurde, blieb für „Meister Wilhelm"
die ganze Domäne einer noch älteren Kunst
übrig. Professor Mosler in Düsseldorf lenkte
zuerst die Aufmerksamkeit auf das bedeutende
Wandbild des Kruzifixus umgeben von Heiligen
und dem knieenden Stifter über dem Sarkophag
des Erzbischofs Kuno von Falkenstein (-j- 1388)
in der Kastoikirche zu Koblenz.4) Schon derRang
des Verstorbenen, meinte man, lasse darauf
schliefsen, dafs einer der ersten Meister jener
Zeit zur Ausschmückung seiner Grabstätte be-
rufen wurde. Weil aber die Zeit der Eni«
stehung ungefähr den Angaben des Chronisten
entspräche, auch vielleicht im Hinblick auf
die Porträtfigur anzunehmen wäre, dafs der
Erzbischof sich schon bei Lebzeiten ein Denk-
mal errichtet habe, so könne man das Gemälde
als ein Werk des „Meister Wilhelm" ansehen
und zur Bestimmung seiner sonstigen Arbeiten
verwerthen.
Unter solchen Voraussetzungen taufte man
dann auf den Namen „Meister Wilhelm" jene
holdseligen Schöpfungen kölnischer Kunst,
Madonnen und Heilige, welche in ihrer Para-
diesesunschuld als die edelste Verkörperung
mittelalterlicher Formideale, als die Ergüsse
einer kindlich-reinen Frömmigkeit erschienen.
Meister Wilhelm galt als der Urheber der vorzüg-
lichsten Tafeln des Clarenaltars mit Darstellun-
gen aus der Jugendgeschichte Jesu (vgl. unsere
Lichtdrucktafeln 111 und IV), der Madonna
3) Vgl. Sulpiz Boisseree I, S. 98.
4) Moller »Denkmäler der deutschen Baukunst«
I,Tafel l(i. Aus m'Weerth »Kunstdenkmäler« 111,62.
Kugler »Kheinreise« Kleine Schriften, II, S. 288.
L e h f e I d t »Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-
bezirks Koblenz« (18SG) S. 147. Das Wandgemälde ist
jetzt vollständig mit Oelfarbe übermalt. Nach Passo-
vant (a. a. (). S. 40(1) sind auch die „theilweise vcr.
loren gegangenen Umrisse nicht mit gehöriger Kenntnifs
ergänzt worden".