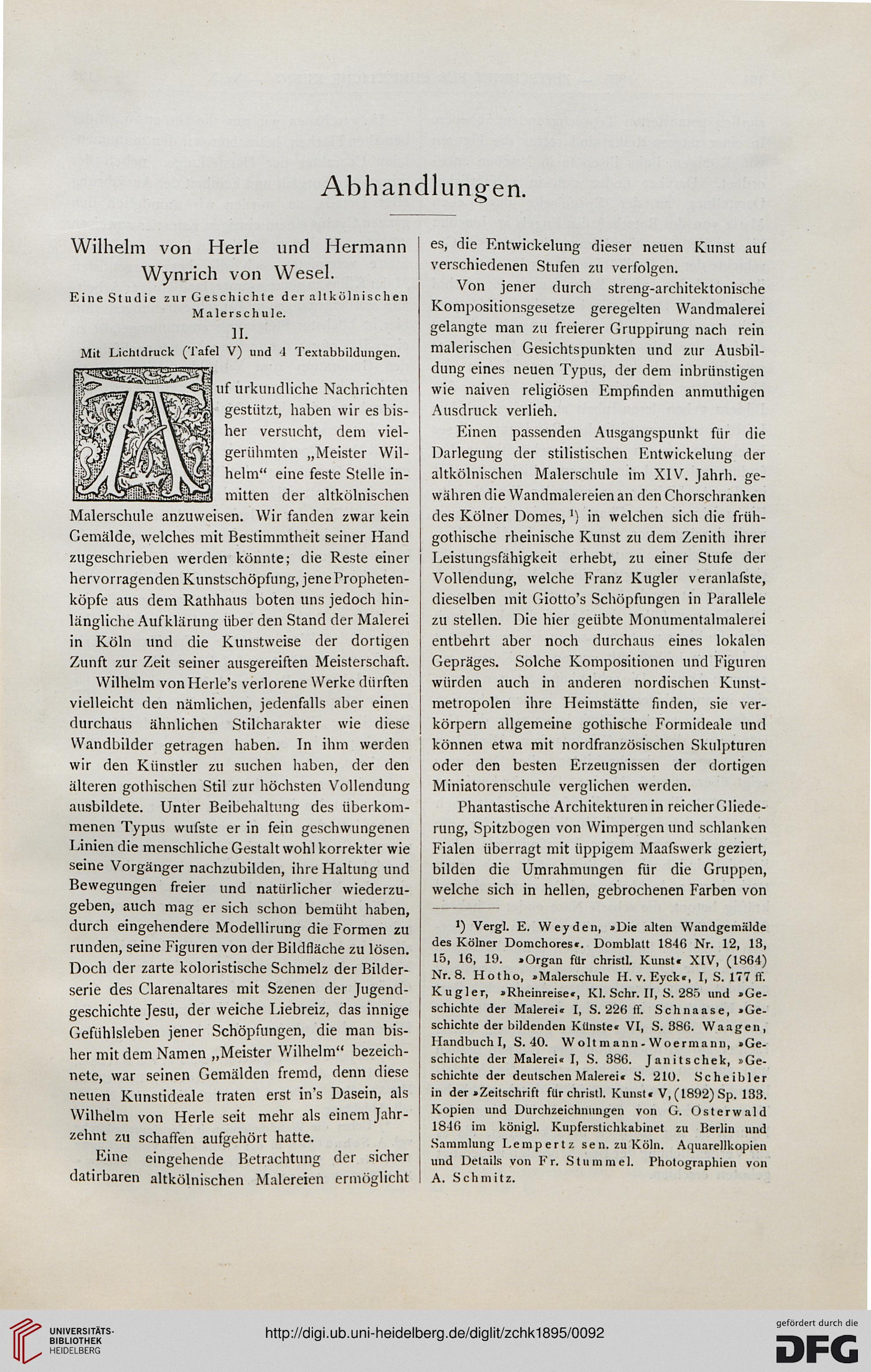Abhandlunoren.
Wilhelm von Herle und Hermann
Wynrich von Wesel.
Eine Studie zur Geschichte der altkölnischen
Malerschule.
II.
Mit Lichtdruck (Tafel V) und '1 Textabbildungen.
uf urkundliche Nachrichten
gestützt, haben wir es bis-
her versucht, dem viel-
gerühmten „Meister Wil-
helm" eine feste Stelle in-
mitten der altkölnischen
Malerschule anzuweisen. Wir fanden zwar kein
Gemälde, welches mit Bestimmtheit seiner Hand
zugeschrieben werden könnte; die Reste einer
hervorragenden Kunstschöpfung, jene Propheten-
köpfe aus dem Rathhaus boten uns jedoch hin-
längliche Aufklärung über den Stand der Malerei
in Köln und die Kunstweise der dortigen
Zunft zur Zeit seiner ausgereiften Meisterschaft.
Wilhelm vonHerle's verlorene Werke dürften
vielleicht den nämlichen, jedenfalls aber einen
durchaus ähnlichen Stilcharakter wie diese
Wandbilder getragen haben. In ihm werden
wir den Künstler zu suchen haben, der den
älteren gothischen Stil zur höchsten Vollendung
ausbildete. Unter Beibehaltung des überkom-
menen Typus wufste er in fein geschwungenen
Linien die menschliche Gestalt wohl korrekter wie
seine Vorgänger nachzubilden, ihre Haltung und
Bewegungen freier und natürlicher wiederzu-
geben, auch mag er sich schon bemüht haben,
durch eingehendere Modellirung die Formen zu
runden, seine Figuren von der Bildfläche zu lösen.
Doch der zarte koloristische Schmelz der Bilder-
serie des Clarenaltares mit Szenen der Jugend-
geschichte Jesu, der weiche Liebreiz, das innige
Gefühlsleben jener Schöpfungen, die man bis-
her mit dem Namen „Meister Wilhelm" bezeich-
nete, war seinen Gemälden fremd, denn diese
neuen Kunstideale traten erst in's Dasein, als
Wilhelm von Herle seit mehr als einem Jahr-
zehnt zu schaffen aufgehört hatte.
Eine eingehende Betrachtung der sicher
datirbaren altkölnischen Malereien ermöglicht
es, die Entwicklung dieser neuen Kunst auf
verschiedenen Stufen zu verfolgen.
Von jener durch streng-architektonische
Kompositionsgesetze geregelten Wandmalerei
gelangte man zu freierer Gruppirung nach rein
malerischen Gesichtspunkten und zur Ausbil-
dung eines neuen Typus, der dem inbrünstigen
wie naiven religiösen Empfinden anmuthigen
Ausdruck verlieh.
Einen passenden Ausgangspunkt für die
Darlegung der stilistischen F.ntwickelung der
altkölnischen Malerschule im XIV. Jahrh. ge-
währen die Wandmalereien an den Chorschranken
des Kölner Domes,') in welchen sich die früh-
gothische rheinische Kunst zu dem Zenith ihrer
Leistungsfähigkeit erhebt, zu einer Stufe der
Vollendung, welche Franz Kugler veranlafste,
dieselben mit Giotto's Schöpfungen in Parallele
zu stellen. Die hier geübte Monumentalmalerei
entbehrt aber noch durchaus eines lokalen
Gepräges. Solche Kompositionen und Figuren
würden auch in anderen nordischen Kunst-
metropolen ihre Heimstätte finden, sie ver-
körpern allgemeine gothische Formideale und
können etwa mit nordfranzösischen Skulpturen
oder den besten Erzeugnissen der dortigen
Miniatorenschule verglichen werden.
Phantastische Architekturen in reicherGliede-
rung, Spitzbogen von Wimpergen und schlanken
Fialen überragt mit üppigem Maafswerk geziert,
bilden die Umrahmungen für die Gruppen,
welche sich in hellen, gebrochenen Farben von
') Vergl. E. Weyden, »Die alten Wandgemälde
des Kölner Domchores«. Domblalt 1846 Nr. 12, 13,
15, 16, 19. »Organ für christl. Kunst« XIV, (1864)
Nr. 8. Hotho, »Malerschule H. v. Eyck«, I, S. 177 ff.
Kugler, »Rheinreise«, Kl. Sehr. If, S. 285 und »Ge-
schichte der Malerei« I, S. 226 ff. Schnaase, »Ge-
schichte der bildenden Künste« VI, S. 886. Waagen,
Handbuch I, S. 40. Woltmann-Woermann, »Ge-
schichte der Malerei« I, S. 386. Janitschek, »Ge-
schichte der deutschen Malerei« S. 210. Scheibler
in der »Zeitschrift für christl. Kunst« V, (1892) Sp. 133.
Kopien und Durchzeichnungen von G. Osterwald
1846 im königl. Kupferslichkabinet zu Berlin und
Sammlung Lempertz sen. zuKöln. Aquarellkopien
und Details von Fr. Stummel. Photographien von
A. Schmitz.
Wilhelm von Herle und Hermann
Wynrich von Wesel.
Eine Studie zur Geschichte der altkölnischen
Malerschule.
II.
Mit Lichtdruck (Tafel V) und '1 Textabbildungen.
uf urkundliche Nachrichten
gestützt, haben wir es bis-
her versucht, dem viel-
gerühmten „Meister Wil-
helm" eine feste Stelle in-
mitten der altkölnischen
Malerschule anzuweisen. Wir fanden zwar kein
Gemälde, welches mit Bestimmtheit seiner Hand
zugeschrieben werden könnte; die Reste einer
hervorragenden Kunstschöpfung, jene Propheten-
köpfe aus dem Rathhaus boten uns jedoch hin-
längliche Aufklärung über den Stand der Malerei
in Köln und die Kunstweise der dortigen
Zunft zur Zeit seiner ausgereiften Meisterschaft.
Wilhelm vonHerle's verlorene Werke dürften
vielleicht den nämlichen, jedenfalls aber einen
durchaus ähnlichen Stilcharakter wie diese
Wandbilder getragen haben. In ihm werden
wir den Künstler zu suchen haben, der den
älteren gothischen Stil zur höchsten Vollendung
ausbildete. Unter Beibehaltung des überkom-
menen Typus wufste er in fein geschwungenen
Linien die menschliche Gestalt wohl korrekter wie
seine Vorgänger nachzubilden, ihre Haltung und
Bewegungen freier und natürlicher wiederzu-
geben, auch mag er sich schon bemüht haben,
durch eingehendere Modellirung die Formen zu
runden, seine Figuren von der Bildfläche zu lösen.
Doch der zarte koloristische Schmelz der Bilder-
serie des Clarenaltares mit Szenen der Jugend-
geschichte Jesu, der weiche Liebreiz, das innige
Gefühlsleben jener Schöpfungen, die man bis-
her mit dem Namen „Meister Wilhelm" bezeich-
nete, war seinen Gemälden fremd, denn diese
neuen Kunstideale traten erst in's Dasein, als
Wilhelm von Herle seit mehr als einem Jahr-
zehnt zu schaffen aufgehört hatte.
Eine eingehende Betrachtung der sicher
datirbaren altkölnischen Malereien ermöglicht
es, die Entwicklung dieser neuen Kunst auf
verschiedenen Stufen zu verfolgen.
Von jener durch streng-architektonische
Kompositionsgesetze geregelten Wandmalerei
gelangte man zu freierer Gruppirung nach rein
malerischen Gesichtspunkten und zur Ausbil-
dung eines neuen Typus, der dem inbrünstigen
wie naiven religiösen Empfinden anmuthigen
Ausdruck verlieh.
Einen passenden Ausgangspunkt für die
Darlegung der stilistischen F.ntwickelung der
altkölnischen Malerschule im XIV. Jahrh. ge-
währen die Wandmalereien an den Chorschranken
des Kölner Domes,') in welchen sich die früh-
gothische rheinische Kunst zu dem Zenith ihrer
Leistungsfähigkeit erhebt, zu einer Stufe der
Vollendung, welche Franz Kugler veranlafste,
dieselben mit Giotto's Schöpfungen in Parallele
zu stellen. Die hier geübte Monumentalmalerei
entbehrt aber noch durchaus eines lokalen
Gepräges. Solche Kompositionen und Figuren
würden auch in anderen nordischen Kunst-
metropolen ihre Heimstätte finden, sie ver-
körpern allgemeine gothische Formideale und
können etwa mit nordfranzösischen Skulpturen
oder den besten Erzeugnissen der dortigen
Miniatorenschule verglichen werden.
Phantastische Architekturen in reicherGliede-
rung, Spitzbogen von Wimpergen und schlanken
Fialen überragt mit üppigem Maafswerk geziert,
bilden die Umrahmungen für die Gruppen,
welche sich in hellen, gebrochenen Farben von
') Vergl. E. Weyden, »Die alten Wandgemälde
des Kölner Domchores«. Domblalt 1846 Nr. 12, 13,
15, 16, 19. »Organ für christl. Kunst« XIV, (1864)
Nr. 8. Hotho, »Malerschule H. v. Eyck«, I, S. 177 ff.
Kugler, »Rheinreise«, Kl. Sehr. If, S. 285 und »Ge-
schichte der Malerei« I, S. 226 ff. Schnaase, »Ge-
schichte der bildenden Künste« VI, S. 886. Waagen,
Handbuch I, S. 40. Woltmann-Woermann, »Ge-
schichte der Malerei« I, S. 386. Janitschek, »Ge-
schichte der deutschen Malerei« S. 210. Scheibler
in der »Zeitschrift für christl. Kunst« V, (1892) Sp. 133.
Kopien und Durchzeichnungen von G. Osterwald
1846 im königl. Kupferslichkabinet zu Berlin und
Sammlung Lempertz sen. zuKöln. Aquarellkopien
und Details von Fr. Stummel. Photographien von
A. Schmitz.