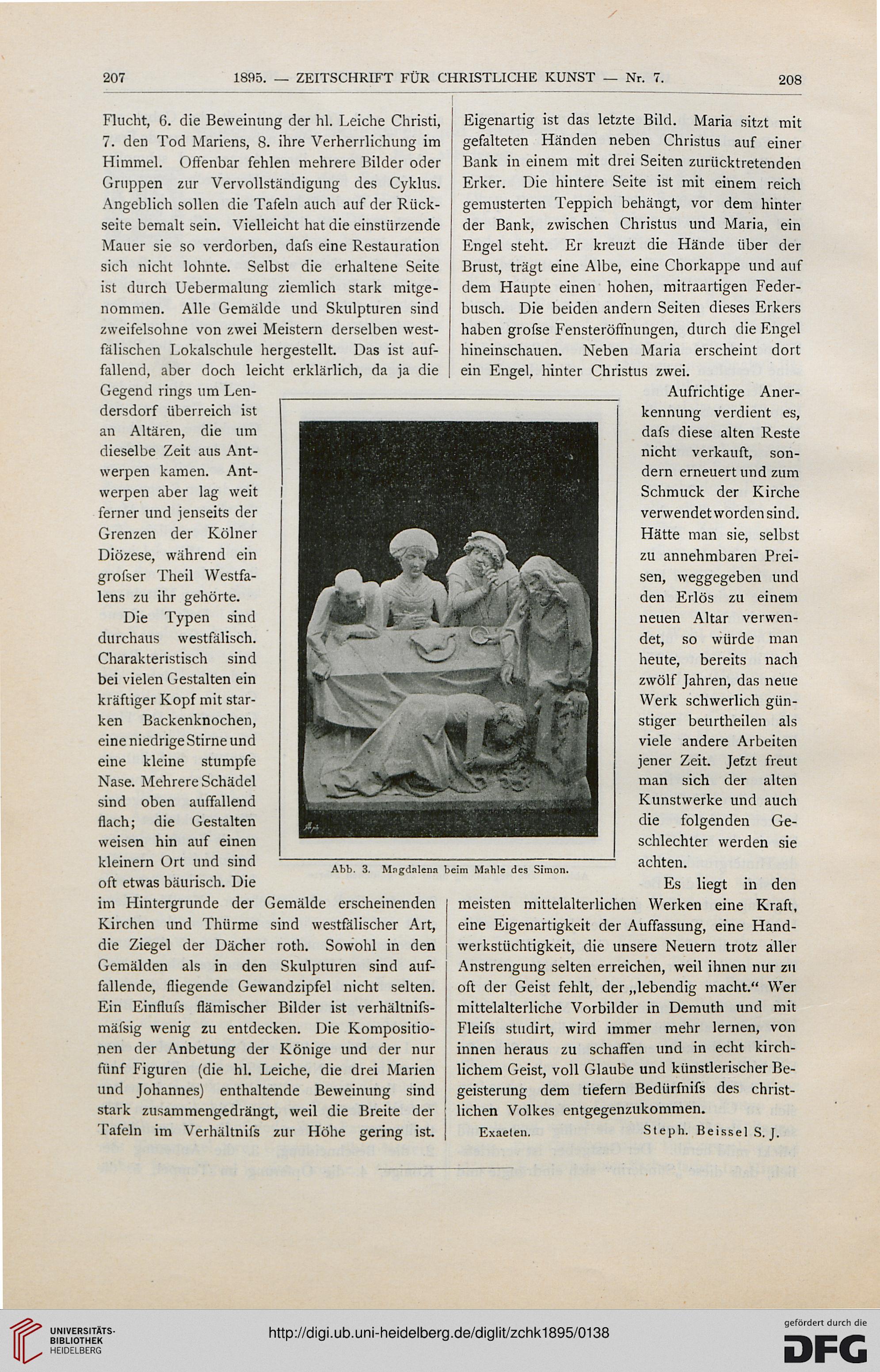207
1895.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
208
Flucht, 6. die Beweinung der hl. Leiche Christi,
7. den Tod Mariens, 8. ihre Verherrlichung im
Himmel. Offenbar fehlen mehrere Bilder oder
Gruppen zur Vervollständigung des Cyklus.
Angeblich sollen die Tafeln auch auf der Rück-
seite bemalt sein. Vielleicht hat die einstürzende
Mauer sie so verdorben, dafs eine Restauration
sich nicht lohnte. Selbst die erhaltene Seite
ist durch Uebermalung ziemlich stark mitge-
nommen. Alle Gemälde und Skulpturen sind
zweifelsohne von zwei Meistern derselben west-
fälischen Lokalschule hergestellt. Das ist auf-
fallend, aber doch leicht erklärlich, da ja die
Gegend rings um Len-
dersdorf überreich ist
an Altären, die um
dieselbe Zeit aus Ant-
werpen kamen. Ant-
werpen aber lag weit
ferner und jenseits der
Grenzen der Kölner
Diözese, während ein
grofser Theil Westfa-
lens zu ihr gehörte.
Die Typen sind
durchaus westfälisch.
Charakteristisch sind
bei vielen Gestalten ein
kräftiger Kopf mit star-
ken Backenknochen,
eine niedrige Stirne und
eine kleine stumpfe
Nase. Mehrere Schädel
sind oben auffallend
flach; die Gestalten
weisen hin auf einen
kleinern Ort und sind
oft etwas bäurisch. Die
im Hintergrunde der Gemälde erscheinenden
Kirchen und Thürme sind westfälischer Art,
die Ziegel der Dächer roth. Sowohl in den
Gemälden als in den Skulpturen sind auf-
fallende, fliegende Gewandzipfel nicht selten.
Ein Einflufs flämischer Bilder ist verhältnifs-
mäfsig wenig zu entdecken. Die Kompositio-
nen der Anbetung der Könige und der nur
fünf Figuren (die hl. Leiche, die drei Marien
und Johannes) enthaltende Beweinung sind
stark zusammengedrängt, weil die Breite der
Tafeln im Verhältnifs zur Höhe gering ist.
Abb. 3. Magdalena beim Mable des Simon.
Eigenartig ist das letzte Bild. Maria sitzt mit
gefalteten Händen neben Christus auf einer
Bank in einem mit drei Seiten zurücktretenden
Erker. Die hintere Seite ist mit einem reich
gemusterten Teppich behängt, vor dem hinter
der Bank, zwischen Christus und Maria, ein
Engel steht. Er kreuzt die Hände über der
Brust, trägt eine Albe, eine Chorkappe und auf
dem Haupte einen hohen, mitraartigen Feder-
busch. Die beiden andern Seiten dieses Erkers
haben grofse Fensteröffnungen, durch die Engel
hineinschauen. Neben Maria erscheint dort
ein Engel, hinter Christus zwei.
Aufrichtige Aner-
kennung verdient es,
dafs diese alten Reste
nicht verkauft, son-
dern erneuert und zum
Schmuck der Kirche
verwendet worden sind.
Hätte man sie, selbst
zu annehmbaren Prei-
sen, weggegeben und
den Erlös zu einem
neuen Altar verwen-
det, so würde man
heute, bereits nach
zwölf Jahren, das neue
Werk schwerlich gün-
stiger beurtheilen als
viele andere Arbeiten
jener Zeit. Jetzt freut
man sich der alten
Kunstwerke und auch
die folgenden Ge-
schlechter werden sie
achten.
Es liegt in den
meisten mittelalterlichen Werken eine Kraft,
eine Eigenartigkeit der Auffassung, eine Hand-
werkstüchtigkeit, die unsere Neuern trotz aller
Anstrengung selten erreichen, weil ihnen nur zu
oft der Geist fehlt, der „lebendig macht." Wer
mittelalterliche Vorbilder in Demuth und mit
Fleifs studirt, wird immer mehr lernen, von
innen heraus zu schaffen und in echt kirch-
lichem Geist, voll Glaube und künstlerischer Be-
geisterung dem tiefern Bediirfnifs des christ-
lichen Volkes entgegenzukommen.
Exaeten.
Steph. Beissel S. J.
1895.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
208
Flucht, 6. die Beweinung der hl. Leiche Christi,
7. den Tod Mariens, 8. ihre Verherrlichung im
Himmel. Offenbar fehlen mehrere Bilder oder
Gruppen zur Vervollständigung des Cyklus.
Angeblich sollen die Tafeln auch auf der Rück-
seite bemalt sein. Vielleicht hat die einstürzende
Mauer sie so verdorben, dafs eine Restauration
sich nicht lohnte. Selbst die erhaltene Seite
ist durch Uebermalung ziemlich stark mitge-
nommen. Alle Gemälde und Skulpturen sind
zweifelsohne von zwei Meistern derselben west-
fälischen Lokalschule hergestellt. Das ist auf-
fallend, aber doch leicht erklärlich, da ja die
Gegend rings um Len-
dersdorf überreich ist
an Altären, die um
dieselbe Zeit aus Ant-
werpen kamen. Ant-
werpen aber lag weit
ferner und jenseits der
Grenzen der Kölner
Diözese, während ein
grofser Theil Westfa-
lens zu ihr gehörte.
Die Typen sind
durchaus westfälisch.
Charakteristisch sind
bei vielen Gestalten ein
kräftiger Kopf mit star-
ken Backenknochen,
eine niedrige Stirne und
eine kleine stumpfe
Nase. Mehrere Schädel
sind oben auffallend
flach; die Gestalten
weisen hin auf einen
kleinern Ort und sind
oft etwas bäurisch. Die
im Hintergrunde der Gemälde erscheinenden
Kirchen und Thürme sind westfälischer Art,
die Ziegel der Dächer roth. Sowohl in den
Gemälden als in den Skulpturen sind auf-
fallende, fliegende Gewandzipfel nicht selten.
Ein Einflufs flämischer Bilder ist verhältnifs-
mäfsig wenig zu entdecken. Die Kompositio-
nen der Anbetung der Könige und der nur
fünf Figuren (die hl. Leiche, die drei Marien
und Johannes) enthaltende Beweinung sind
stark zusammengedrängt, weil die Breite der
Tafeln im Verhältnifs zur Höhe gering ist.
Abb. 3. Magdalena beim Mable des Simon.
Eigenartig ist das letzte Bild. Maria sitzt mit
gefalteten Händen neben Christus auf einer
Bank in einem mit drei Seiten zurücktretenden
Erker. Die hintere Seite ist mit einem reich
gemusterten Teppich behängt, vor dem hinter
der Bank, zwischen Christus und Maria, ein
Engel steht. Er kreuzt die Hände über der
Brust, trägt eine Albe, eine Chorkappe und auf
dem Haupte einen hohen, mitraartigen Feder-
busch. Die beiden andern Seiten dieses Erkers
haben grofse Fensteröffnungen, durch die Engel
hineinschauen. Neben Maria erscheint dort
ein Engel, hinter Christus zwei.
Aufrichtige Aner-
kennung verdient es,
dafs diese alten Reste
nicht verkauft, son-
dern erneuert und zum
Schmuck der Kirche
verwendet worden sind.
Hätte man sie, selbst
zu annehmbaren Prei-
sen, weggegeben und
den Erlös zu einem
neuen Altar verwen-
det, so würde man
heute, bereits nach
zwölf Jahren, das neue
Werk schwerlich gün-
stiger beurtheilen als
viele andere Arbeiten
jener Zeit. Jetzt freut
man sich der alten
Kunstwerke und auch
die folgenden Ge-
schlechter werden sie
achten.
Es liegt in den
meisten mittelalterlichen Werken eine Kraft,
eine Eigenartigkeit der Auffassung, eine Hand-
werkstüchtigkeit, die unsere Neuern trotz aller
Anstrengung selten erreichen, weil ihnen nur zu
oft der Geist fehlt, der „lebendig macht." Wer
mittelalterliche Vorbilder in Demuth und mit
Fleifs studirt, wird immer mehr lernen, von
innen heraus zu schaffen und in echt kirch-
lichem Geist, voll Glaube und künstlerischer Be-
geisterung dem tiefern Bediirfnifs des christ-
lichen Volkes entgegenzukommen.
Exaeten.
Steph. Beissel S. J.