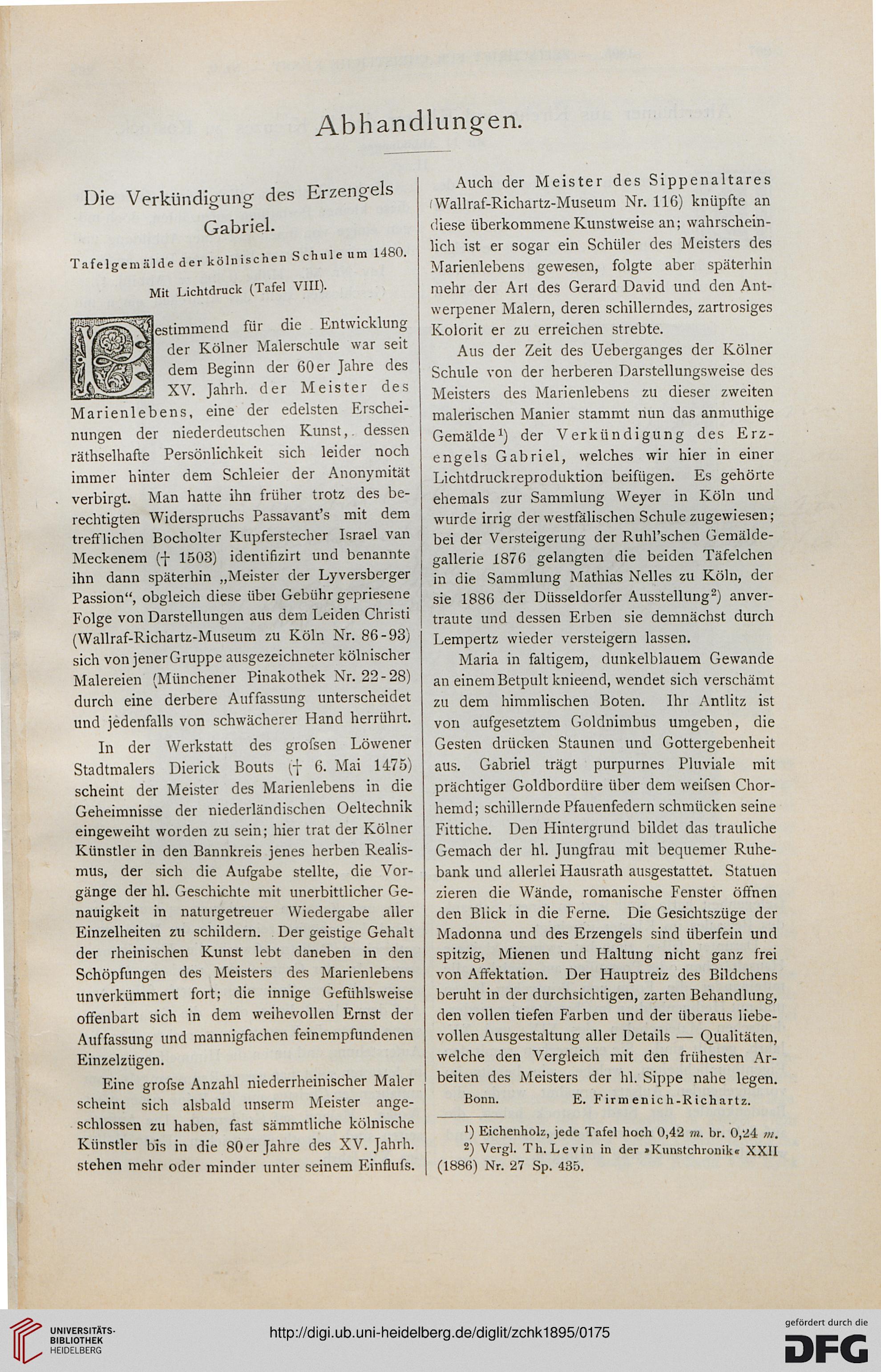Abhandlungen.
Die Verkündigung des Erzengels
Gabriel.
TafelgemüldederkölnUchenSchuleum
Mit Lichtdruck (Tafel VIII).
1480.
bestimmend für die Entwicklung
der Kölner Malerschule war seit
dem Beginn der 60 er Jahre des
XV. Jahrh. der Meister des
Marienlebens, eine der edelsten Erschei-
nungen der niederdeutschen Kunst, dessen
räthselhafte Persönlichkeit sich leider noch
immer hinter dem Schleier der Anonymität
verbirgt. Man hatte ihn früher trotz des be-
rechtigten Widerspruchs Passavant's mit dem
trefflichen Bocholter Kupferstecher Israel van
Meckenem (-J- 1503) identifizirt und benannte
ihn dann späterhin „Meister der Lyversberger
Passion", obgleich diese übet Gebühr gepriesene
Folge von Darstellungen aus dem Leiden Christi
(Wallraf-Richartz-Museum zu Köln Nr. 86-93)
sich von jenerGruppe ausgezeichneter kölnischer
Malereien (Münchener Pinakothek Nr. 22-28)
durch eine derbere Auffassung unterscheidet
und jedenfalls von schwächerer Hand herrührt.
In der Werkstatt des grofsen Löwener
Stadtmalers Dierick Bouts (-j- 6. Mai 1475)
scheint der Meister des Marienlebens in die
Geheimnisse der niederländischen Oeltechnik
eingeweiht worden zu sein; hier trat der Kölner
Künstler in den Bannkreis jenes herben Realis-
mus, der sich die Aufgabe stellte, die Vor-
gänge der hl. Geschichte mit unerbittlicher Ge-
nauigkeit in naturgetreuer Wiedergabe aller
Einzelheiten zu schildern. Der geistige Gehalt
der rheinischen Kunst lebt daneben in den
Schöpfungen des Meisters des Marienlebens
unverkümmert fort; die innige Gefühlsweise
offenbart sich in dem weihevollen Ernst der
Auffassung und mannigfachen feinempfundenen
Einzelzügen.
Eine grofse Anzahl niederrheinischer Maler
scheint sich alsbald unserm Meister ange-
schlossen zu haben, fast sämmtliche kölnische
Künstler bis in die 80 er Jahre des XV. Jahrh.
stehen mehr oder minder unter seinem Einflufs.
Auch der Meister des Sippenaltares
(Wallraf-Richartz-Museum Nr. 116) knüpfte an
diese überkommene Kunstweise an; wahrschein-
lich ist er sogar ein Schüler des Meisters des
Marienlebens gewesen, folgte aber späterhin
mehr der Art des Gerard David und den Ant-
werpener Malern, deren schillerndes, zartrosiges
Kolorit er zu erreichen strebte.
Aus der Zeit des Ueberganges der Kölner
Schule von der herberen Darstellungsweise des
Meisters des Marienlebens zu dieser zweiten
malerischen Manier stammt nun das anmuthige
Gemälde1) der Verkündigung des Erz-
engels Gabriel, welches wir hier in einer
Lichtdruckreproduktion beifügen. Es gehörte
ehemals zur Sammlung Weyer in Köln und
wurde irrig der westfälischen Schule zugewiesen;
bei der Versteigerung der Ruhl'schen Gemälde-
gallerie 1876 gelangten die beiden Täfelchen
in die Sammlung Mathias Nelles zu Köln, der
sie 1886 der Düsseldorfer Ausstellung2) anver-
traute und dessen Erben sie demnächst durch
Lempertz wieder versteigern lassen.
Maria in faltigem, dunkelblauem Gewände
an einem Betpult knieend, wendet sich verschämt
zu dem himmlischen Boten. Ihr Antlitz ist
von aufgesetztem Goldnimbus umgeben, die
Gesten drücken Staunen und Gottergebenheit
aus. Gabriel trägt purpurnes Pluviale mit
prächtiger Goldbordüre über dem weifsen Chor-
hemd; schillernde Pfauenfedern schmücken seine
Fittiche. Den Hintergrund bildet das trauliche
Gemach der hl. Jungfrau mit bequemer Ruhe-
bank und allerlei Hausrath ausgestattet. Statuen
zieren die Wände, romanische Fenster öffnen
den Blick in die Ferne. Die Gesichtszüge der
Madonna und des Erzengels sind überfein und
spitzig, Mienen und Haltung nicht ganz frei
von Affektation. Der Hauptreiz des Bildchens
beruht in der durchsichtigen, zarten Behandlung,
den vollen tiefen Farben und der überaus liebe-
vollen Ausgestaltung aller Details — Qualitäten,
welche den Vergleich mit den frühesten Ar-
beiten des Meisters der hl. Sippe nahe legen.
Bonn. E. Firm enich-Richartz.
') Eichenholz, jede Tafel hoch 0,42 m. br. 0,24 in,
") Vergl. Th. Levin in der «Kunstchronikc XXII
(1886) Nr. 27 Sp. 435.
Die Verkündigung des Erzengels
Gabriel.
TafelgemüldederkölnUchenSchuleum
Mit Lichtdruck (Tafel VIII).
1480.
bestimmend für die Entwicklung
der Kölner Malerschule war seit
dem Beginn der 60 er Jahre des
XV. Jahrh. der Meister des
Marienlebens, eine der edelsten Erschei-
nungen der niederdeutschen Kunst, dessen
räthselhafte Persönlichkeit sich leider noch
immer hinter dem Schleier der Anonymität
verbirgt. Man hatte ihn früher trotz des be-
rechtigten Widerspruchs Passavant's mit dem
trefflichen Bocholter Kupferstecher Israel van
Meckenem (-J- 1503) identifizirt und benannte
ihn dann späterhin „Meister der Lyversberger
Passion", obgleich diese übet Gebühr gepriesene
Folge von Darstellungen aus dem Leiden Christi
(Wallraf-Richartz-Museum zu Köln Nr. 86-93)
sich von jenerGruppe ausgezeichneter kölnischer
Malereien (Münchener Pinakothek Nr. 22-28)
durch eine derbere Auffassung unterscheidet
und jedenfalls von schwächerer Hand herrührt.
In der Werkstatt des grofsen Löwener
Stadtmalers Dierick Bouts (-j- 6. Mai 1475)
scheint der Meister des Marienlebens in die
Geheimnisse der niederländischen Oeltechnik
eingeweiht worden zu sein; hier trat der Kölner
Künstler in den Bannkreis jenes herben Realis-
mus, der sich die Aufgabe stellte, die Vor-
gänge der hl. Geschichte mit unerbittlicher Ge-
nauigkeit in naturgetreuer Wiedergabe aller
Einzelheiten zu schildern. Der geistige Gehalt
der rheinischen Kunst lebt daneben in den
Schöpfungen des Meisters des Marienlebens
unverkümmert fort; die innige Gefühlsweise
offenbart sich in dem weihevollen Ernst der
Auffassung und mannigfachen feinempfundenen
Einzelzügen.
Eine grofse Anzahl niederrheinischer Maler
scheint sich alsbald unserm Meister ange-
schlossen zu haben, fast sämmtliche kölnische
Künstler bis in die 80 er Jahre des XV. Jahrh.
stehen mehr oder minder unter seinem Einflufs.
Auch der Meister des Sippenaltares
(Wallraf-Richartz-Museum Nr. 116) knüpfte an
diese überkommene Kunstweise an; wahrschein-
lich ist er sogar ein Schüler des Meisters des
Marienlebens gewesen, folgte aber späterhin
mehr der Art des Gerard David und den Ant-
werpener Malern, deren schillerndes, zartrosiges
Kolorit er zu erreichen strebte.
Aus der Zeit des Ueberganges der Kölner
Schule von der herberen Darstellungsweise des
Meisters des Marienlebens zu dieser zweiten
malerischen Manier stammt nun das anmuthige
Gemälde1) der Verkündigung des Erz-
engels Gabriel, welches wir hier in einer
Lichtdruckreproduktion beifügen. Es gehörte
ehemals zur Sammlung Weyer in Köln und
wurde irrig der westfälischen Schule zugewiesen;
bei der Versteigerung der Ruhl'schen Gemälde-
gallerie 1876 gelangten die beiden Täfelchen
in die Sammlung Mathias Nelles zu Köln, der
sie 1886 der Düsseldorfer Ausstellung2) anver-
traute und dessen Erben sie demnächst durch
Lempertz wieder versteigern lassen.
Maria in faltigem, dunkelblauem Gewände
an einem Betpult knieend, wendet sich verschämt
zu dem himmlischen Boten. Ihr Antlitz ist
von aufgesetztem Goldnimbus umgeben, die
Gesten drücken Staunen und Gottergebenheit
aus. Gabriel trägt purpurnes Pluviale mit
prächtiger Goldbordüre über dem weifsen Chor-
hemd; schillernde Pfauenfedern schmücken seine
Fittiche. Den Hintergrund bildet das trauliche
Gemach der hl. Jungfrau mit bequemer Ruhe-
bank und allerlei Hausrath ausgestattet. Statuen
zieren die Wände, romanische Fenster öffnen
den Blick in die Ferne. Die Gesichtszüge der
Madonna und des Erzengels sind überfein und
spitzig, Mienen und Haltung nicht ganz frei
von Affektation. Der Hauptreiz des Bildchens
beruht in der durchsichtigen, zarten Behandlung,
den vollen tiefen Farben und der überaus liebe-
vollen Ausgestaltung aller Details — Qualitäten,
welche den Vergleich mit den frühesten Ar-
beiten des Meisters der hl. Sippe nahe legen.
Bonn. E. Firm enich-Richartz.
') Eichenholz, jede Tafel hoch 0,42 m. br. 0,24 in,
") Vergl. Th. Levin in der «Kunstchronikc XXII
(1886) Nr. 27 Sp. 435.