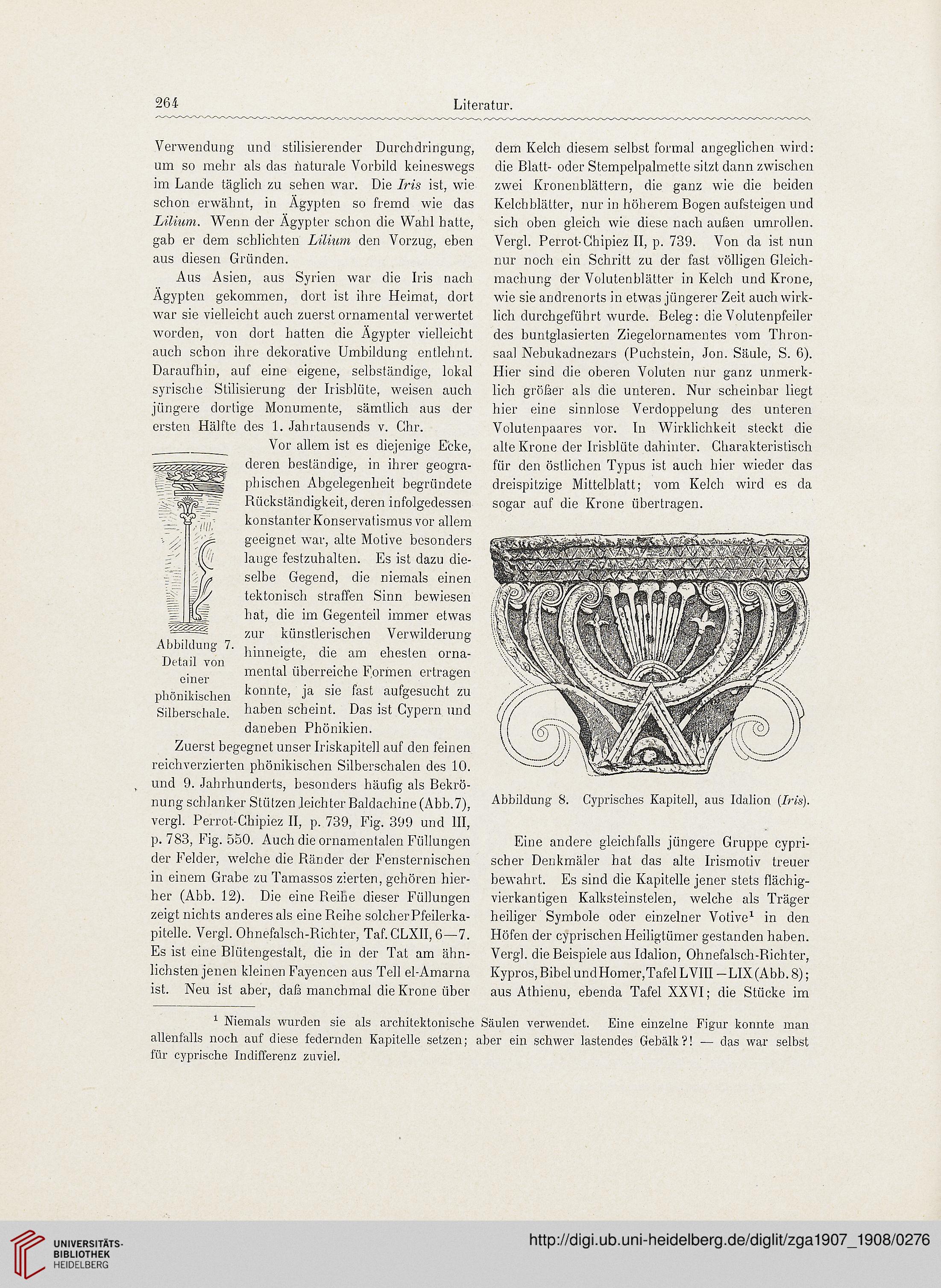264
Verwendung und stilisierender Durchdringung, dem Kelch diesem selbst formal angeglichen wird:
um so mehr als das naturale Vorbild keineswegs die Blatt-oder Stempelpalmette sitzt dann zwischen
im Lande täglich zu sehen war. Die Iris ist, wie zwei Kronenblättern, die ganz wie die beiden
schon erwähnt, in Ägypten so fremd wie das Kelchblätter, nur in höherem Bogen aufsteigen und
Lilium. Wenn der Ägypter schon die Wahl hatte, sich oben gleich wie diese nach außen umrollen.
gab er dem schlichten Lilium den Vorzug, eben Vergl. Perrot-Ghipiez II, p. 739. Von da ist nun
aus diesen Gründen. nur noch ein Schritt zu der fast völligen Gleich-
Aus Asien, aus Syrien war die Iris nach machung der Volutenblätter in Kelch und Krone,
Ägypten gekommen, dort ist ihre Heimat, dort wie sie andrenorts in etwas jüngerer Zeit auch wirk-
war sie vielleicht auch zuerst ornamental verwertet lieh durchgeführt wurde. Beleg: die Volutenpfeiler
worden, von dort hatten die Ägypter vielleicht des buntglasierten Ziegelornamentes vom Thron-
auch schon ihre dekorative Umbildung entlehnt, saal Nebukadnezars (Puchstein, Jon. Säule, S. 6).
Daraufhin, auf eine eigene, selbständige, lokal Hier sind die oberen Voluten nur ganz unmerk-
syrische Stilisierung der Irisblüte, weisen auch lieh größer als die unteren. Nur scheinbar liegt
jüngere dortige Monumente, sämtlich aus der hier eine sinnlose Verdoppelung des unteren
ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. Volutenpaares vor. In Wirklichkeit steckt die
___ Vor allem ist es diejenige Ecke, alte Krone der Irisblüte dahinter. Charakteristisch
deren beständige, in ihrer geogra- für den östlichen Typus ist auch hier wieder das
phischen Abgelegcnheit begründete dreispitzige Mittelblatt; vom Kelch wird es da
Rückständigkeit, deren infolgedessen sogar auf die Krone übertragen,
konstanter Konservatismus vor allem
geeignet war, alte Motive besonders
lange festzuhalten. Es ist dazu die-
selbe Gegend, die niemals einen
tektonisch straffen Sinn bewiesen
hat, die im Gegenteil immer etwas
zur künstlerischen Verwilderung
Abbildung 7. , • • , ,
_ hinneigte, die am ehesten orna-
Detail von , ... . , „ .
mental überreiche I1 ormen ertragen
einer °
phönikischen konnte> Ja sie fast aufgesucht zu
Silberschnle. haben scheint. Das ist Cypern und
daneben Phönikien.
Zuerst begegnet unser Iriskapitell auf den feinen
reichverzierten phönikischen Silberschalen des 10.
und 9. Jahrhunderts, besonders häufig als Bekrö-
nung schlanker Stützen Jeichter Baldachine (Abb.7), Abbildung 8. Cyprisches Kapitell, aus Idalion (Iris).
vergl. Perrot-Chipiez II, p. 739, Fig. 399 und III,
p. 783, Fig. 550. Auch die ornamentalen Füllungen Eine andere gleichfalls jüngere Gruppe cypri-
der Felder, welche die Ränder der Fensternischen scher Denkmäler hat das alte Irismotiv treuer
in einem Grabe zu Tamassos zierten, gehören hier- bewahrt. Es sind die Kapitelle jener stets flächig-
her (Abb. 12). Die eine Reihe dieser Füllungen vierkantigen Kalksteinstelen, welche als Träger
zeigt nichts anderes als eine Reihe solcherPfeilerka- heiliger Symbole oder einzelner Votive1 in den
pitelle. Vergl. Ohnefalsch-Richter, Taf. GLXII, 6—7. Höfen der cyprischenHeiligtümer gestanden haben.
Es ist eine Blütengestalt, die in der Tat am ahn- Vergl. die Beispiele aus Idalion, Ohnefalsch-Bichter,
lichsten jenen kleinen Fayencen aus Teil el-Amarna Kypros, Bibel und Homer,TafelLVIII— LIX(Abb.8);
ist. Neu ist aber, daß manchmal die Krone über aus Athienu, ebenda Tafel XXVI; die Stücke im
1 Niemals wurden sie als architektonische Säulen verwendet. Eine einzelne Figur konnte man
allenfalls noch auf diese federnden Kapitelle setzen; aber ein schwer lastendes Gebälk'?! — das war selbst
für cyprische Indifferenz zuviel.
Verwendung und stilisierender Durchdringung, dem Kelch diesem selbst formal angeglichen wird:
um so mehr als das naturale Vorbild keineswegs die Blatt-oder Stempelpalmette sitzt dann zwischen
im Lande täglich zu sehen war. Die Iris ist, wie zwei Kronenblättern, die ganz wie die beiden
schon erwähnt, in Ägypten so fremd wie das Kelchblätter, nur in höherem Bogen aufsteigen und
Lilium. Wenn der Ägypter schon die Wahl hatte, sich oben gleich wie diese nach außen umrollen.
gab er dem schlichten Lilium den Vorzug, eben Vergl. Perrot-Ghipiez II, p. 739. Von da ist nun
aus diesen Gründen. nur noch ein Schritt zu der fast völligen Gleich-
Aus Asien, aus Syrien war die Iris nach machung der Volutenblätter in Kelch und Krone,
Ägypten gekommen, dort ist ihre Heimat, dort wie sie andrenorts in etwas jüngerer Zeit auch wirk-
war sie vielleicht auch zuerst ornamental verwertet lieh durchgeführt wurde. Beleg: die Volutenpfeiler
worden, von dort hatten die Ägypter vielleicht des buntglasierten Ziegelornamentes vom Thron-
auch schon ihre dekorative Umbildung entlehnt, saal Nebukadnezars (Puchstein, Jon. Säule, S. 6).
Daraufhin, auf eine eigene, selbständige, lokal Hier sind die oberen Voluten nur ganz unmerk-
syrische Stilisierung der Irisblüte, weisen auch lieh größer als die unteren. Nur scheinbar liegt
jüngere dortige Monumente, sämtlich aus der hier eine sinnlose Verdoppelung des unteren
ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. Volutenpaares vor. In Wirklichkeit steckt die
___ Vor allem ist es diejenige Ecke, alte Krone der Irisblüte dahinter. Charakteristisch
deren beständige, in ihrer geogra- für den östlichen Typus ist auch hier wieder das
phischen Abgelegcnheit begründete dreispitzige Mittelblatt; vom Kelch wird es da
Rückständigkeit, deren infolgedessen sogar auf die Krone übertragen,
konstanter Konservatismus vor allem
geeignet war, alte Motive besonders
lange festzuhalten. Es ist dazu die-
selbe Gegend, die niemals einen
tektonisch straffen Sinn bewiesen
hat, die im Gegenteil immer etwas
zur künstlerischen Verwilderung
Abbildung 7. , • • , ,
_ hinneigte, die am ehesten orna-
Detail von , ... . , „ .
mental überreiche I1 ormen ertragen
einer °
phönikischen konnte> Ja sie fast aufgesucht zu
Silberschnle. haben scheint. Das ist Cypern und
daneben Phönikien.
Zuerst begegnet unser Iriskapitell auf den feinen
reichverzierten phönikischen Silberschalen des 10.
und 9. Jahrhunderts, besonders häufig als Bekrö-
nung schlanker Stützen Jeichter Baldachine (Abb.7), Abbildung 8. Cyprisches Kapitell, aus Idalion (Iris).
vergl. Perrot-Chipiez II, p. 739, Fig. 399 und III,
p. 783, Fig. 550. Auch die ornamentalen Füllungen Eine andere gleichfalls jüngere Gruppe cypri-
der Felder, welche die Ränder der Fensternischen scher Denkmäler hat das alte Irismotiv treuer
in einem Grabe zu Tamassos zierten, gehören hier- bewahrt. Es sind die Kapitelle jener stets flächig-
her (Abb. 12). Die eine Reihe dieser Füllungen vierkantigen Kalksteinstelen, welche als Träger
zeigt nichts anderes als eine Reihe solcherPfeilerka- heiliger Symbole oder einzelner Votive1 in den
pitelle. Vergl. Ohnefalsch-Richter, Taf. GLXII, 6—7. Höfen der cyprischenHeiligtümer gestanden haben.
Es ist eine Blütengestalt, die in der Tat am ahn- Vergl. die Beispiele aus Idalion, Ohnefalsch-Bichter,
lichsten jenen kleinen Fayencen aus Teil el-Amarna Kypros, Bibel und Homer,TafelLVIII— LIX(Abb.8);
ist. Neu ist aber, daß manchmal die Krone über aus Athienu, ebenda Tafel XXVI; die Stücke im
1 Niemals wurden sie als architektonische Säulen verwendet. Eine einzelne Figur konnte man
allenfalls noch auf diese federnden Kapitelle setzen; aber ein schwer lastendes Gebälk'?! — das war selbst
für cyprische Indifferenz zuviel.