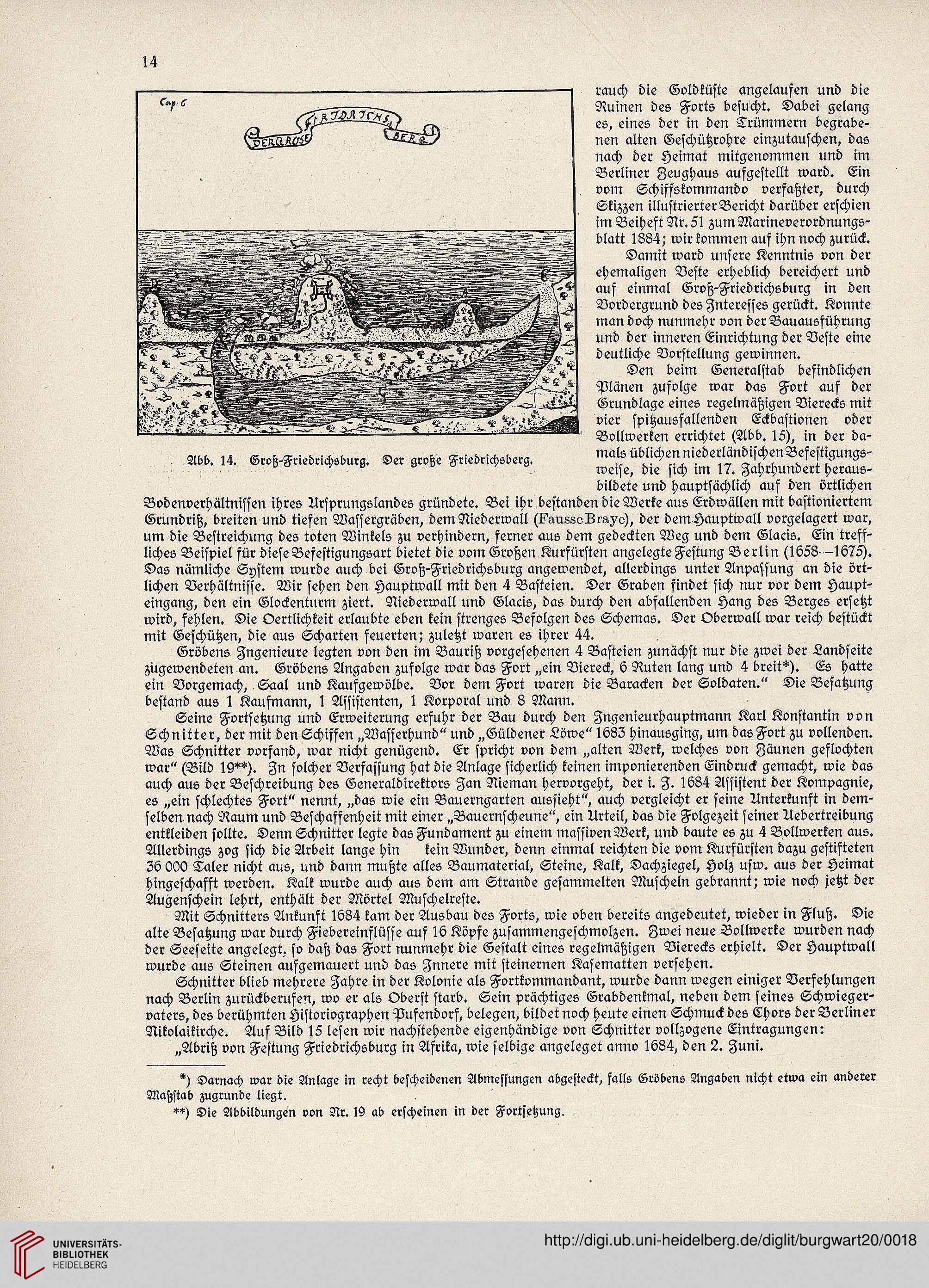14
rauch die Goldküste angelaufen und die
Ruinen des Forts besucht. Dabei gelang
es, eines der in den Trümmern begrabe-
nen alten Geschützrohre einzutauschen, das
nach der Heimat mitgenommen und im
Berliner Zeughaus aufgestellt ward. Ein
vom Schiffskommando verfaßter, durch
Skizzen illustrierter Bericht darüber erschien
im Beiheft Nr. 51 zum Marineverordnungs-
blatt 1884; wir kommen auf ihn noch zurück.
Damit ward unsere Kenntnis von der
ehemaligen Veste erheblich bereichert und
auf einmal Groß-Friedrichsburg in den
Vordergrund des Interesses gerückt. Konnte
man doch nunmehr von der Bauausführung
rind der inneren Einrichtung der Veste eine
deutliche Vorstellung gewinnen.
Den beim Generalstab befindlichen
Plänen zufolge war das Fort auf der
Grundlage eines regelmäßigen Vierecks mit
vier spitzaussallenden Eckbastionen oder
Bollwerken errichtet (Abb. 15), in der da-
mals üblichen niederländischenBefestigungs-
weise, die sich im 17. Jahrhundert heraus-
bildete und hauptsächlich auf den örtlichen
Bodenverhältnissen ihres Ursprungslandes gründete. Bei ihr bestanden die Werke aus Erdwällen mit bastioniertem
Grundriß, breiten und tiefen Wassergräben, dem Niederwall (Hausse Vra^ch, der dem Hauptwall vorgelagert war,
um die Bestreichung des toten Winkels zu verhindern, ferner aus dem gedeckten Weg und dein Glacis. Ein treff-
liches Beispiel für diese Befestigungsart bietet die vom Großen Kurfürsten angelegte Festung Berlin (1658-1675).
Das nämliche System wurde auch bei Groß-Friedrichsburg angewendet, allerdings unter Anpassung an die ört-
lichen Verhältnisse. Wir sehen den Hauptwall mit den 4 Basteien. Der Graben findet sich nur vor dem Haupt-
eingang, den ein Glockenturm ziert. Niederwall und Glacis, das durch den abfallenden Hang des Berges ersetzt
wird, fehlen. Die Oertlichkeit erlaubte eben kein strenges Befolgen des Schemas. Der Oberwall war reich bestückt
mit Geschützen, die aus Scharten feuerten; zuletzt waren es ihrer 44.
Gröbens Ingenieure legten von den im Bauriß vorgesehenen 4 Basteien zunächst nur die zwei der Landseite
zügewendeten an. Gröbens Angaben zufolge war das Fort „ein Viereck, 6 Ruten lang und 4 breit*). Es hatte
ein Vorgemach, Saal und Kaufgewölbe. Vor dem Fort waren die Baracken der Soldaten." Die Besatzung
bestand aus 1 Kaufmann, 1 Assistenten, 1 Korporal und 8 Mann.
Seine Fortsetzung und Erweiterung erfuhr der Bau durch den Ingenieurhauptmann Karl Konstantin von
Schnitter, der mit den Schiffen „Wasserhund" und „Güldener Löwe" 1633 hinausging, um das Fort zu vollenden.
Was Schnitter vorfand, war nicht genügend. Er spricht von dem „alten Werk, welches von Zäunen geflochten
war" (Bild Id**). In solcher Verfassung hat die Anlage sicherlich keinen imponierenden Eindruck gemacht, wie das
auch aus der Beschreibung des Generaldirektors Jan Nieman hervorgeht, der i. I. 1684 Assistent der Kompagnie,
es „ein schlechtes Fort" nennt, „das wie ein Bauerngarten aussieht", auch vergleicht er seine Unterkunft in dem-
selben nach Raum und Beschaffenheit mit einer „Bauernscheune", ein Urteil, das die Folgezeit seiner Uebertreibung
entkleiden sollte. Denn Schnitter legte das Fundament zu einem massiven Werk, und baute es zu 4 Bollwerken aus.
Allerdings zog sich die Arbeit lange hin kein Wunder, denn einmal reichten die vom Kurfürsten dazu gestifteten
36 000 Taler nicht aus, und dann mußte alles Baumaterial, Steine, Kalk, Dachziegel, Holz usw. aus der Heimat
hingeschasft werden. Kalk wurde auch aus dem am Strande gesammelten Muscheln gebrannt; wie noch jetzt der
Augenschein lehrt, enthält der Mörtel Muschelreste.
Mit Schnitters Ankunft 1684 kam der Ausbau des Forts, wie oben bereits angedeutet, wieder in Fluß. Die
alte Besatzung war durch Fiebereinflüsse aus 16 Köpfe zusammengeschmolzen. Zwei neue Bollwerke wurden nach
der Seeseite angelegt, so daß das Fort nunmehr die Gestalt eines regelmäßigen Vierecks erhielt. Der Hauptwall
wurde aus Steinen aufgemauert und das Innere mit steinernen Kasematten versehen.
Schnitter blieb mehrere Jahre in der Kolonie als Fortkommandant, wurde dann wegen einiger Verfehlungen
nach Berlin zurückberufen, wo er als Oberst starb. Sein prächtiges Grabdenkmal, neben dem seines Schwieger-
vaters, des berühmten Historiographen Pufendorf, belegen, bildet noch heute einen Schmuck des Chors der Berliner
Nikolaikirche. Auf Bild 15 lesen wir nachstehende eigenhändige von Schnitter vollzogene Eintragungen:
„Abriß von Festung Fciedrichsburg in Afrika, wie selbige angeleget anno 1684, den 2. Juni.
*) Damach war die Anlage in recht bescheidenen Abmessungen abgesteckt, falls Gröbens Angaben nicht etwa ein anderer
Mahstab zugrunde liegt.
**) Die Abbildungen von Nr. ld ab erscheinen in der Fortsetzung.
Abb. 14. Groß-Friedrichsburg. Der große Friedrichsberg.
rauch die Goldküste angelaufen und die
Ruinen des Forts besucht. Dabei gelang
es, eines der in den Trümmern begrabe-
nen alten Geschützrohre einzutauschen, das
nach der Heimat mitgenommen und im
Berliner Zeughaus aufgestellt ward. Ein
vom Schiffskommando verfaßter, durch
Skizzen illustrierter Bericht darüber erschien
im Beiheft Nr. 51 zum Marineverordnungs-
blatt 1884; wir kommen auf ihn noch zurück.
Damit ward unsere Kenntnis von der
ehemaligen Veste erheblich bereichert und
auf einmal Groß-Friedrichsburg in den
Vordergrund des Interesses gerückt. Konnte
man doch nunmehr von der Bauausführung
rind der inneren Einrichtung der Veste eine
deutliche Vorstellung gewinnen.
Den beim Generalstab befindlichen
Plänen zufolge war das Fort auf der
Grundlage eines regelmäßigen Vierecks mit
vier spitzaussallenden Eckbastionen oder
Bollwerken errichtet (Abb. 15), in der da-
mals üblichen niederländischenBefestigungs-
weise, die sich im 17. Jahrhundert heraus-
bildete und hauptsächlich auf den örtlichen
Bodenverhältnissen ihres Ursprungslandes gründete. Bei ihr bestanden die Werke aus Erdwällen mit bastioniertem
Grundriß, breiten und tiefen Wassergräben, dem Niederwall (Hausse Vra^ch, der dem Hauptwall vorgelagert war,
um die Bestreichung des toten Winkels zu verhindern, ferner aus dem gedeckten Weg und dein Glacis. Ein treff-
liches Beispiel für diese Befestigungsart bietet die vom Großen Kurfürsten angelegte Festung Berlin (1658-1675).
Das nämliche System wurde auch bei Groß-Friedrichsburg angewendet, allerdings unter Anpassung an die ört-
lichen Verhältnisse. Wir sehen den Hauptwall mit den 4 Basteien. Der Graben findet sich nur vor dem Haupt-
eingang, den ein Glockenturm ziert. Niederwall und Glacis, das durch den abfallenden Hang des Berges ersetzt
wird, fehlen. Die Oertlichkeit erlaubte eben kein strenges Befolgen des Schemas. Der Oberwall war reich bestückt
mit Geschützen, die aus Scharten feuerten; zuletzt waren es ihrer 44.
Gröbens Ingenieure legten von den im Bauriß vorgesehenen 4 Basteien zunächst nur die zwei der Landseite
zügewendeten an. Gröbens Angaben zufolge war das Fort „ein Viereck, 6 Ruten lang und 4 breit*). Es hatte
ein Vorgemach, Saal und Kaufgewölbe. Vor dem Fort waren die Baracken der Soldaten." Die Besatzung
bestand aus 1 Kaufmann, 1 Assistenten, 1 Korporal und 8 Mann.
Seine Fortsetzung und Erweiterung erfuhr der Bau durch den Ingenieurhauptmann Karl Konstantin von
Schnitter, der mit den Schiffen „Wasserhund" und „Güldener Löwe" 1633 hinausging, um das Fort zu vollenden.
Was Schnitter vorfand, war nicht genügend. Er spricht von dem „alten Werk, welches von Zäunen geflochten
war" (Bild Id**). In solcher Verfassung hat die Anlage sicherlich keinen imponierenden Eindruck gemacht, wie das
auch aus der Beschreibung des Generaldirektors Jan Nieman hervorgeht, der i. I. 1684 Assistent der Kompagnie,
es „ein schlechtes Fort" nennt, „das wie ein Bauerngarten aussieht", auch vergleicht er seine Unterkunft in dem-
selben nach Raum und Beschaffenheit mit einer „Bauernscheune", ein Urteil, das die Folgezeit seiner Uebertreibung
entkleiden sollte. Denn Schnitter legte das Fundament zu einem massiven Werk, und baute es zu 4 Bollwerken aus.
Allerdings zog sich die Arbeit lange hin kein Wunder, denn einmal reichten die vom Kurfürsten dazu gestifteten
36 000 Taler nicht aus, und dann mußte alles Baumaterial, Steine, Kalk, Dachziegel, Holz usw. aus der Heimat
hingeschasft werden. Kalk wurde auch aus dem am Strande gesammelten Muscheln gebrannt; wie noch jetzt der
Augenschein lehrt, enthält der Mörtel Muschelreste.
Mit Schnitters Ankunft 1684 kam der Ausbau des Forts, wie oben bereits angedeutet, wieder in Fluß. Die
alte Besatzung war durch Fiebereinflüsse aus 16 Köpfe zusammengeschmolzen. Zwei neue Bollwerke wurden nach
der Seeseite angelegt, so daß das Fort nunmehr die Gestalt eines regelmäßigen Vierecks erhielt. Der Hauptwall
wurde aus Steinen aufgemauert und das Innere mit steinernen Kasematten versehen.
Schnitter blieb mehrere Jahre in der Kolonie als Fortkommandant, wurde dann wegen einiger Verfehlungen
nach Berlin zurückberufen, wo er als Oberst starb. Sein prächtiges Grabdenkmal, neben dem seines Schwieger-
vaters, des berühmten Historiographen Pufendorf, belegen, bildet noch heute einen Schmuck des Chors der Berliner
Nikolaikirche. Auf Bild 15 lesen wir nachstehende eigenhändige von Schnitter vollzogene Eintragungen:
„Abriß von Festung Fciedrichsburg in Afrika, wie selbige angeleget anno 1684, den 2. Juni.
*) Damach war die Anlage in recht bescheidenen Abmessungen abgesteckt, falls Gröbens Angaben nicht etwa ein anderer
Mahstab zugrunde liegt.
**) Die Abbildungen von Nr. ld ab erscheinen in der Fortsetzung.
Abb. 14. Groß-Friedrichsburg. Der große Friedrichsberg.