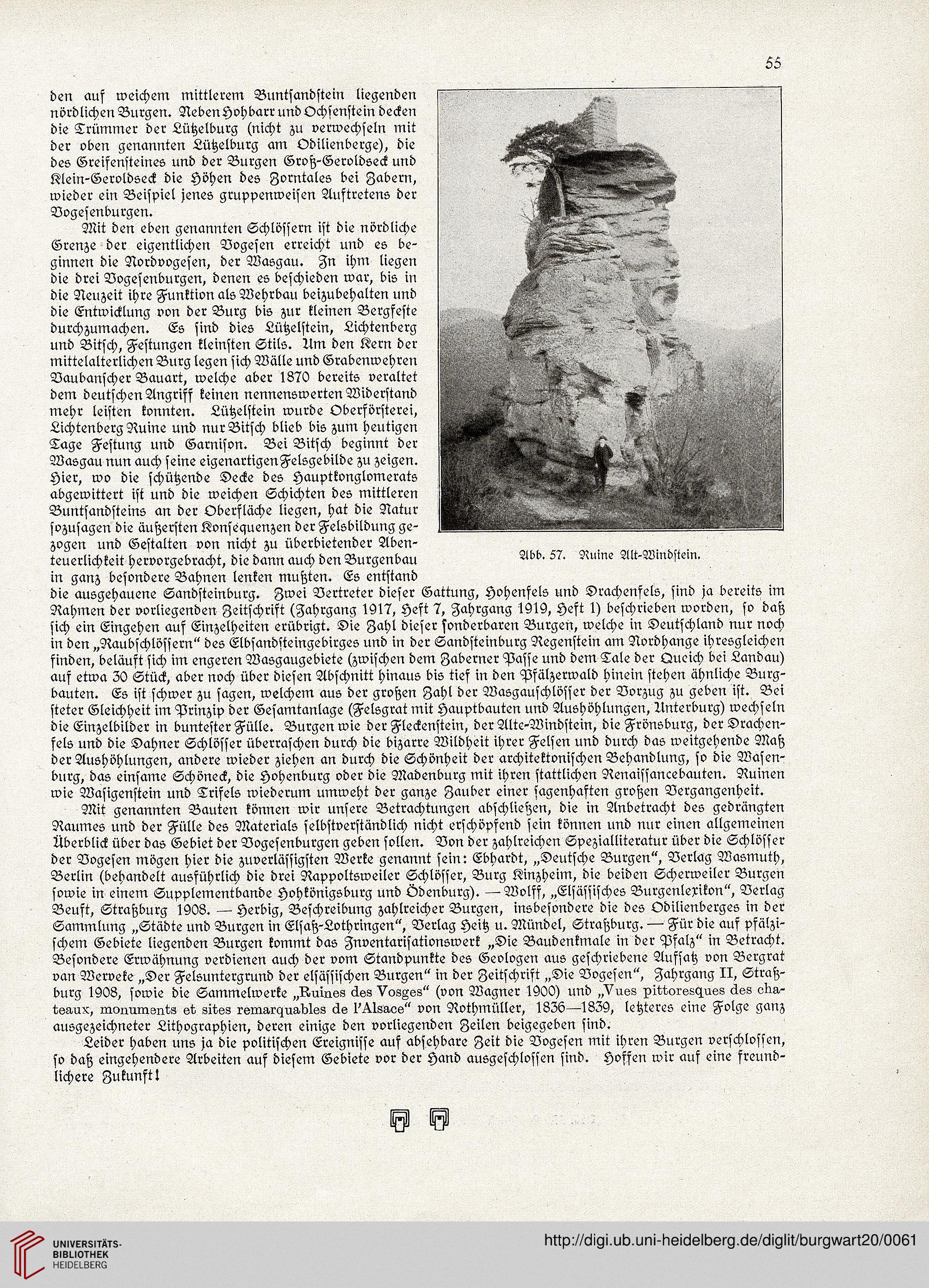den auf weichein mittlerem Buntsandstein liegenden
nördlichen Burgen. NebcnHohbarrundOchsenstcin decken
die Trümmer der Lützelburg (nicht zu verwechseln mit
der oben genannten Lühelburg am Odilienberge), die
des Greisensteines und der Burgen Groß-Geroldseck und
Klein-Geroldseck die Höhen des Zorntales bei Zabern,
wieder ein Beispiel jenes gruppenweisen Auftretens der
Vogesenburgen.
Mit den eben genannten Schlössern ist die nördliche
Grenze der eigentlichen Vogesen erreicht und es be-
ginnen die Nordvogesen, der Wasgau. Zn ihn: liegen
die drei Vogesenburgen, denen es beschieden war, bis in
die Neuzeit ihre Funktion als Wehrbau beizubehalten und
die Entwicklung von der Burg bis zur kleinen Bergfeste
durchzumachen. Es sind dies Lützelstein, Lichtenberg
und Bitsch, Festungen kleinsten Stils. Ilm den Kern der
mittelalterlichen Burg legen sich Wälle und Grabenwehren
Vaubanscher Bauart, welche aber 1870 bereits veraltet
dem deutschen Angriff keinen nennenswerten Widerstand
mehr leisten konnten. Lützelstein wurde Oberförsterei,
Lichtenberg Ruine und nur Bitsch blieb bis zum heutigen
Tage Festung und Garnison. Bei Bitsch beginnt der
Wasgau nun auch seine eigenartigen Felsgebilde zu zeigen.
Hier, wo die schützende Decke des Hauptkonglomerats
abgewittert ist und die weichen Schichten des mittleren
Buntsandsteins an der Oberfläche liegen, hat die Natur
sozusagen die äußersten Konsequenzen der Felsbildung ge-
zogen und Gestalten von nicht zu überbietender Aben-
teuerlichkeit hervorgebracht, die dann auch den Burgenbau
in ganz besondere Bahnen lenken mutzten. Es entstand
die ausgehauene Sandsteinburg. Zwei Vertreter dieser Gattung, Hohenfels und Drachensels, sind ja bereits im
Rahmen der vorliegenden Zeitschrift (Zahrgang 1917, Heft 7, Jahrgang 1919, Heft 1) beschrieben worden, so daß
sich ein Eingehen auf Einzelheiten erübrigt. Die Zahl dieser sonderbaren Burgen, welche in Deutschland nur noch
in den „Raubschlössern" des Elbsandsteingebirges und in der Sandsteinburg Regenstein am Nordhange ihresgleichen
finden, beläuft sich im engeren Wasgaugebiete (zwischen dem Zaberner Passe und dem Tale der Queich bei Landau)
aus etwa 30 Stück, aber noch über diesen Abschnitt hinaus bis tief in den Pfälzerwald hinein stehen ähnliche Burg-
bauten. Es ist schwer zu sagen, welchem aus der großen Zahl der Wasgauschlösser der Vorzug zu geben ist. Bei
steter Gleichheit im Prinzip der Gesamtanlage (Felsgrat mit Hauptbauten und Aushöhlungen, Unterburg) wechseln
die Einzelbilder ln buntester Fülle. Burgen wie der Fleckenstein, der Altc-Windstein, die Frönsburg, der Drachen-
fels und die Dahner Schlösser überraschen durch die bizarre Wildheit ihrer Felsen und durch das weitgehende Maß
der Aushöhlungen, andere wieder ziehen an durch die Schönheit der architektonischen Behandlung, so die Wasen-
burg, das einsame Schöneck, die Hohenburg oder die Madenburg mit ihren stattlichen Renaissancebauten. Ruinen
wie Wasigenstein und Trifels wiederum umweht der ganze Zauber einer sagenhaften großen Vergangenheit.
Mit genannten Bauten können wir unsere Betrachtungen abschliehen, die in Anbetracht des gedrängten
Raumes und der Fülle des Materials selbstverständlich nicht erschöpfend sein können und nur einen allgenieinen
Überblick über das Gebiet der Vogesenburgen geben sollen. Von der zahlreichen Spezialliteratur über die Schlösser
der Vogesen mögen hier die zuverlässigsten Werke genannt sein: Ebhardt, „Deutsche Burgen", Verlag Wasmuth,
Berlin (behandelt ausführlich die drei Rappoltsweiler Schlösser, Burg Kinzheim, die beiden Scherweiler Burgen
sowie in einem Supplementbande Hohkönigsburg und Ödenburg). — Wolfs, „Elsässisches Burgenlexikon", Verlag
Beuft, Straßburg 1908. — Herbig, Beschreibung zahlreicher Burgen, insbesondere die des Odilienberges in der
Sammlung „Städte und Burgen in Elsaß-Lothringen", Verlag Heitz u. Mündel, Straßburg. — Für die auf pfälzi-
schem Gebiete liegenden Burgen kommt das Znventarisationswerk „Die Baudenkmale in der Pfalz" in Betracht.
Besondere Erwähnung verdienen auch der vom Standpunkte des Geologen aus geschriebene Aufsatz von Bergrat
van Wcrveke „Der Felsuntergrund der elsässischen Burgen" in der Zeitschrift „Die Vogesen", Zahrgang II, Straß-
burg 1908, sowie die Sammelwerke „Ruines äss VosZss" (von Wagner 1900) und „Vues plttorssquss des (Iia-
tsaux, momunsuts et sits8 rsmarquadlss äs 1'^.lsaos" von Rothmüller, 1836—1839, letzteres eine Folge ganz
ausgezeichneter Lithographien, deren einige den vorliegenden Zeilen beigegeben sind.
Leider haben uns ja die politischen Ereignisse aus absehbare Zeit die Vogesen mit ihren Burgen verschlossen,
so daß eingehendere Arbeiten auf diesem Gebiete vor der Hand ausgeschlossen sind. Hoffen wir auf eine freund-
lichere Zukunft!
Abb. 57. Ruine Alt-Windstcin.
nördlichen Burgen. NebcnHohbarrundOchsenstcin decken
die Trümmer der Lützelburg (nicht zu verwechseln mit
der oben genannten Lühelburg am Odilienberge), die
des Greisensteines und der Burgen Groß-Geroldseck und
Klein-Geroldseck die Höhen des Zorntales bei Zabern,
wieder ein Beispiel jenes gruppenweisen Auftretens der
Vogesenburgen.
Mit den eben genannten Schlössern ist die nördliche
Grenze der eigentlichen Vogesen erreicht und es be-
ginnen die Nordvogesen, der Wasgau. Zn ihn: liegen
die drei Vogesenburgen, denen es beschieden war, bis in
die Neuzeit ihre Funktion als Wehrbau beizubehalten und
die Entwicklung von der Burg bis zur kleinen Bergfeste
durchzumachen. Es sind dies Lützelstein, Lichtenberg
und Bitsch, Festungen kleinsten Stils. Ilm den Kern der
mittelalterlichen Burg legen sich Wälle und Grabenwehren
Vaubanscher Bauart, welche aber 1870 bereits veraltet
dem deutschen Angriff keinen nennenswerten Widerstand
mehr leisten konnten. Lützelstein wurde Oberförsterei,
Lichtenberg Ruine und nur Bitsch blieb bis zum heutigen
Tage Festung und Garnison. Bei Bitsch beginnt der
Wasgau nun auch seine eigenartigen Felsgebilde zu zeigen.
Hier, wo die schützende Decke des Hauptkonglomerats
abgewittert ist und die weichen Schichten des mittleren
Buntsandsteins an der Oberfläche liegen, hat die Natur
sozusagen die äußersten Konsequenzen der Felsbildung ge-
zogen und Gestalten von nicht zu überbietender Aben-
teuerlichkeit hervorgebracht, die dann auch den Burgenbau
in ganz besondere Bahnen lenken mutzten. Es entstand
die ausgehauene Sandsteinburg. Zwei Vertreter dieser Gattung, Hohenfels und Drachensels, sind ja bereits im
Rahmen der vorliegenden Zeitschrift (Zahrgang 1917, Heft 7, Jahrgang 1919, Heft 1) beschrieben worden, so daß
sich ein Eingehen auf Einzelheiten erübrigt. Die Zahl dieser sonderbaren Burgen, welche in Deutschland nur noch
in den „Raubschlössern" des Elbsandsteingebirges und in der Sandsteinburg Regenstein am Nordhange ihresgleichen
finden, beläuft sich im engeren Wasgaugebiete (zwischen dem Zaberner Passe und dem Tale der Queich bei Landau)
aus etwa 30 Stück, aber noch über diesen Abschnitt hinaus bis tief in den Pfälzerwald hinein stehen ähnliche Burg-
bauten. Es ist schwer zu sagen, welchem aus der großen Zahl der Wasgauschlösser der Vorzug zu geben ist. Bei
steter Gleichheit im Prinzip der Gesamtanlage (Felsgrat mit Hauptbauten und Aushöhlungen, Unterburg) wechseln
die Einzelbilder ln buntester Fülle. Burgen wie der Fleckenstein, der Altc-Windstein, die Frönsburg, der Drachen-
fels und die Dahner Schlösser überraschen durch die bizarre Wildheit ihrer Felsen und durch das weitgehende Maß
der Aushöhlungen, andere wieder ziehen an durch die Schönheit der architektonischen Behandlung, so die Wasen-
burg, das einsame Schöneck, die Hohenburg oder die Madenburg mit ihren stattlichen Renaissancebauten. Ruinen
wie Wasigenstein und Trifels wiederum umweht der ganze Zauber einer sagenhaften großen Vergangenheit.
Mit genannten Bauten können wir unsere Betrachtungen abschliehen, die in Anbetracht des gedrängten
Raumes und der Fülle des Materials selbstverständlich nicht erschöpfend sein können und nur einen allgenieinen
Überblick über das Gebiet der Vogesenburgen geben sollen. Von der zahlreichen Spezialliteratur über die Schlösser
der Vogesen mögen hier die zuverlässigsten Werke genannt sein: Ebhardt, „Deutsche Burgen", Verlag Wasmuth,
Berlin (behandelt ausführlich die drei Rappoltsweiler Schlösser, Burg Kinzheim, die beiden Scherweiler Burgen
sowie in einem Supplementbande Hohkönigsburg und Ödenburg). — Wolfs, „Elsässisches Burgenlexikon", Verlag
Beuft, Straßburg 1908. — Herbig, Beschreibung zahlreicher Burgen, insbesondere die des Odilienberges in der
Sammlung „Städte und Burgen in Elsaß-Lothringen", Verlag Heitz u. Mündel, Straßburg. — Für die auf pfälzi-
schem Gebiete liegenden Burgen kommt das Znventarisationswerk „Die Baudenkmale in der Pfalz" in Betracht.
Besondere Erwähnung verdienen auch der vom Standpunkte des Geologen aus geschriebene Aufsatz von Bergrat
van Wcrveke „Der Felsuntergrund der elsässischen Burgen" in der Zeitschrift „Die Vogesen", Zahrgang II, Straß-
burg 1908, sowie die Sammelwerke „Ruines äss VosZss" (von Wagner 1900) und „Vues plttorssquss des (Iia-
tsaux, momunsuts et sits8 rsmarquadlss äs 1'^.lsaos" von Rothmüller, 1836—1839, letzteres eine Folge ganz
ausgezeichneter Lithographien, deren einige den vorliegenden Zeilen beigegeben sind.
Leider haben uns ja die politischen Ereignisse aus absehbare Zeit die Vogesen mit ihren Burgen verschlossen,
so daß eingehendere Arbeiten auf diesem Gebiete vor der Hand ausgeschlossen sind. Hoffen wir auf eine freund-
lichere Zukunft!
Abb. 57. Ruine Alt-Windstcin.