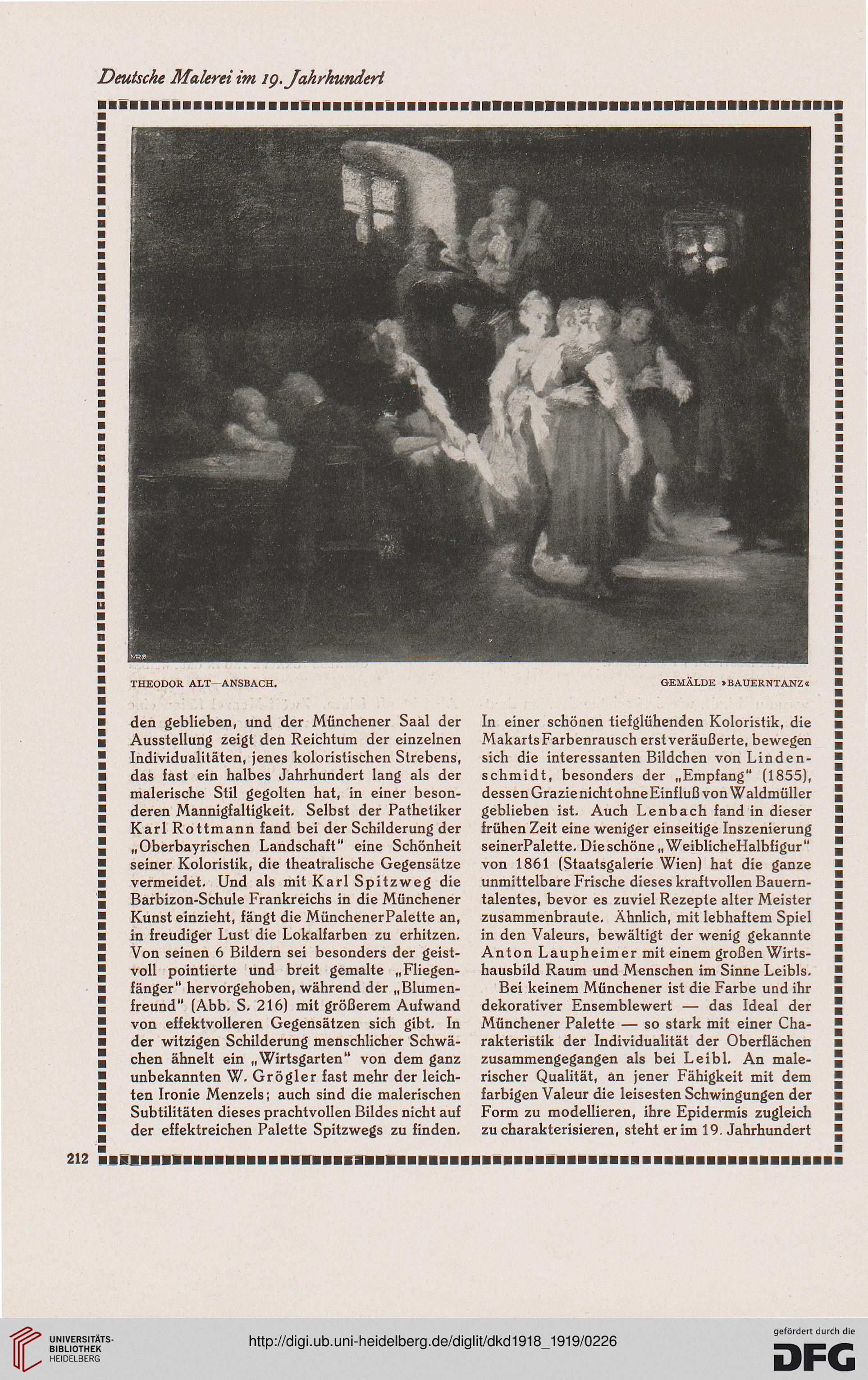Deutsche Malerei im ig. Jahrhundert
THEODOR ALT ANSBACH.
GEMÄLDE »BAUERNTANZ«
den geblieben, und der Münchener Saal der
Ausstellung zeigt den Reichtum der einzelnen
Individualitäten, jenes koloristischen Strebens,
das fast ein halbes Jahrhundert lang als der
malerische Stil gegolten hat, in einer beson-
deren Mannigfaltigkeit. Selbst der Pathetiker
Karl Rottmann fand bei der Schilderung der
„Oberbayrischen Landschaft" eine Schönheit
seiner Koloristik, die theatralische Gegensätze
vermeidet. Und als mit Karl Spitzweg die
Barbizon-Schule Frankreichs in die Münchener
Kunst einzieht, fängt die MünchenerPalette an,
in freudiger Lust die Lokalfarben zu erhitzen.
Von seinen 6 Bildern sei besonders der geist-
voll pointierte und breit gemalte „Fliegen-
fänger" hervorgehoben, während der „Blumen-
freund" (Abb. S. 216) mit größerem Aufwand
von effektvolleren Gegensätzen sich gibt. In
der witzigen Schilderung menschlicher Schwä-
chen ähnelt ein „Wirtsgarten" von dem ganz
unbekannten W. Grögler fast mehr der leich-
ten Ironie Menzels; auch sind die malerischen
Subtilitäten dieses prachtvollen Bildes nicht auf
der effektreichen Palette Spitzwegs zu finden.
In einer schönen tiefglühenden Koloristik, die
MakartsFarbenrausch erst veräußerte, bewegen
sich die interessanten Bildchen von Linden-
schmidt, besonders der „Empfang" (1855),
dessen Grazie nicht ohne Einfluß von Waldmüller
geblieben ist. Auch Lenbach fand in dieser
frühen Zeit eine weniger einseitige Inszenierung
seinerPalette. Die schöne „ WeiblicheHalbfigur"
von 1861 (Staatsgalerie Wien) hat die ganze
unmittelbare Frische dieses kraftvollen Bauern-
talentes, bevor es zuviel Rezepte alter Meister
zusammenbraute. Ähnlich, mit lebhaftem Spiel
in den Valeurs, bewältigt der wenig gekannte
Anton Laupheimer mit einem großen Wirts-
hausbild Raum und Menschen im Sinne Leibis.
Bei keinem Münchener ist die Farbe und ihr
dekorativer Ensemblewert — das Ideal der
Münchener Palette — so stark mit einer Cha-
rakteristik der Individualität der Oberflächen
zusammengegangen als bei Leibi. An male-
rischer Qualität, an jener Fähigkeit mit dem
farbigen Valeur die leisesten Schwingungen der
Form zu modellieren, ihre Epidermis zugleich
zu charakterisieren, steht er im 19. Jahrhundert
THEODOR ALT ANSBACH.
GEMÄLDE »BAUERNTANZ«
den geblieben, und der Münchener Saal der
Ausstellung zeigt den Reichtum der einzelnen
Individualitäten, jenes koloristischen Strebens,
das fast ein halbes Jahrhundert lang als der
malerische Stil gegolten hat, in einer beson-
deren Mannigfaltigkeit. Selbst der Pathetiker
Karl Rottmann fand bei der Schilderung der
„Oberbayrischen Landschaft" eine Schönheit
seiner Koloristik, die theatralische Gegensätze
vermeidet. Und als mit Karl Spitzweg die
Barbizon-Schule Frankreichs in die Münchener
Kunst einzieht, fängt die MünchenerPalette an,
in freudiger Lust die Lokalfarben zu erhitzen.
Von seinen 6 Bildern sei besonders der geist-
voll pointierte und breit gemalte „Fliegen-
fänger" hervorgehoben, während der „Blumen-
freund" (Abb. S. 216) mit größerem Aufwand
von effektvolleren Gegensätzen sich gibt. In
der witzigen Schilderung menschlicher Schwä-
chen ähnelt ein „Wirtsgarten" von dem ganz
unbekannten W. Grögler fast mehr der leich-
ten Ironie Menzels; auch sind die malerischen
Subtilitäten dieses prachtvollen Bildes nicht auf
der effektreichen Palette Spitzwegs zu finden.
In einer schönen tiefglühenden Koloristik, die
MakartsFarbenrausch erst veräußerte, bewegen
sich die interessanten Bildchen von Linden-
schmidt, besonders der „Empfang" (1855),
dessen Grazie nicht ohne Einfluß von Waldmüller
geblieben ist. Auch Lenbach fand in dieser
frühen Zeit eine weniger einseitige Inszenierung
seinerPalette. Die schöne „ WeiblicheHalbfigur"
von 1861 (Staatsgalerie Wien) hat die ganze
unmittelbare Frische dieses kraftvollen Bauern-
talentes, bevor es zuviel Rezepte alter Meister
zusammenbraute. Ähnlich, mit lebhaftem Spiel
in den Valeurs, bewältigt der wenig gekannte
Anton Laupheimer mit einem großen Wirts-
hausbild Raum und Menschen im Sinne Leibis.
Bei keinem Münchener ist die Farbe und ihr
dekorativer Ensemblewert — das Ideal der
Münchener Palette — so stark mit einer Cha-
rakteristik der Individualität der Oberflächen
zusammengegangen als bei Leibi. An male-
rischer Qualität, an jener Fähigkeit mit dem
farbigen Valeur die leisesten Schwingungen der
Form zu modellieren, ihre Epidermis zugleich
zu charakterisieren, steht er im 19. Jahrhundert