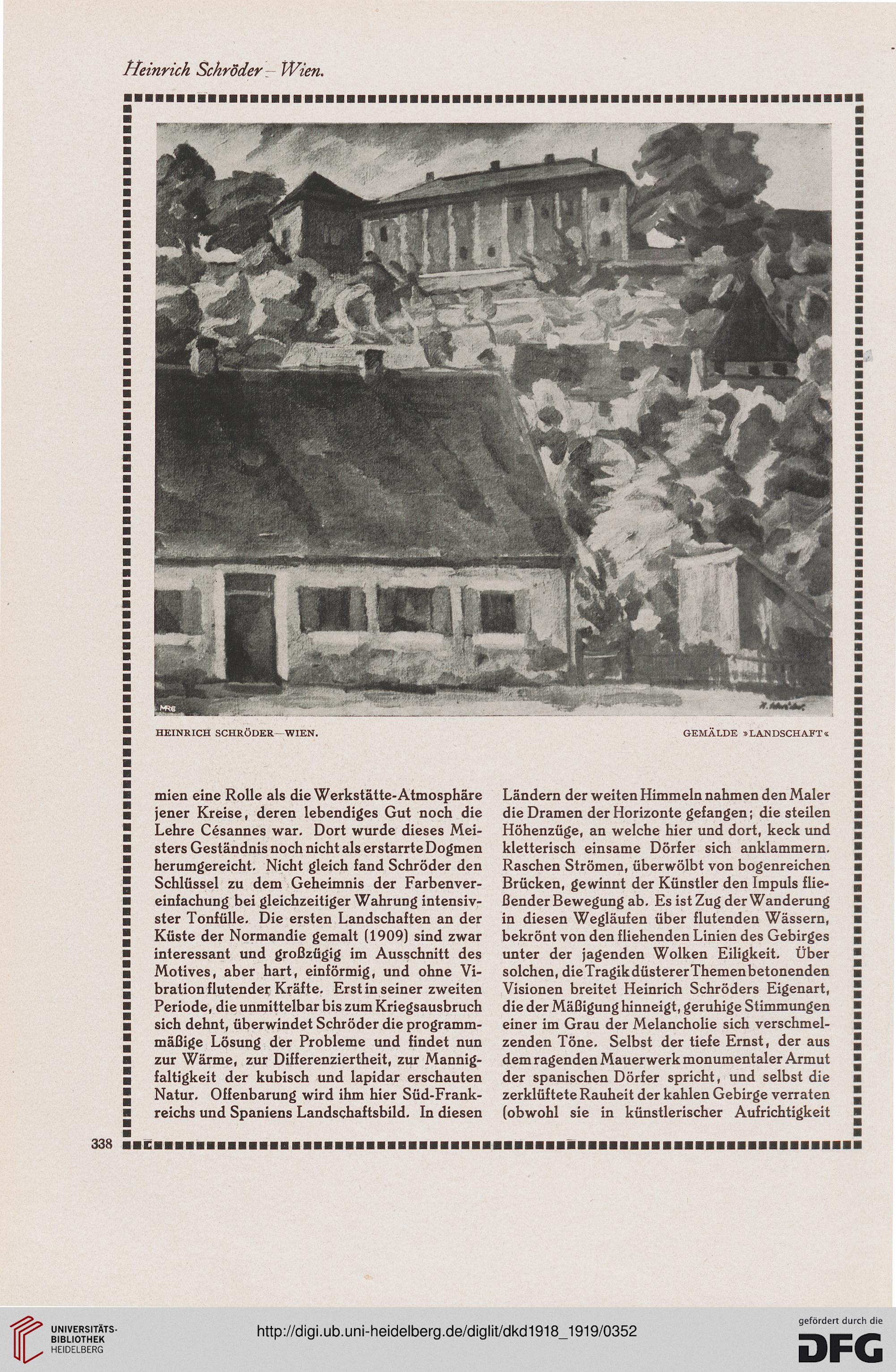Heinrich Schröder Wien.
HEINRICH SCHRÖDER WIEN.
GEMÄLDE »LANDSCHAFT«
mien eine Rolle als die Werkstätte-Atmosphäre
jener Kreise, deren lebendiges Gut noch die
Lehre Cesannes war. Dort wurde dieses Mei-
sters Geständnis noch nicht als erstarrte Dogmen
herumgereicht. Nicht gleich fand Schröder den
Schlüssel zu dem Geheimnis der Farbenver-
einfachung bei gleichzeitiger Wahrung intensiv-
ster Tonfülle. Die ersten Landschaften an der
Küste der Normandie gemalt (1909) sind zwar
interessant und großzügig im Ausschnitt des
Motives, aber hart, einförmig, und ohne Vi-
bration flutender Kräfte. Erst in seiner zweiten
Periode, die unmittelbar bis zum Kriegsausbruch
sich dehnt, überwindet Schröder die programm-
mäßige Lösung der Probleme und findet nun
zur Wärme, zur Differenziertheit, zur Mannig-
faltigkeit der kubisch und lapidar erschauten
Natur. Offenbarung wird ihm hier Süd-Frank-
reichs und Spaniens Landschaftsbild. In diesen
Ländern der weiten Himmeln nahmen den Maler
die Dramen der Horizonte gefangen; die steilen
Höhenzüge, an welche hier und dort, keck und
kletterisch einsame Dörfer sich anklammern.
Raschen Strömen, überwölbt von bogenreichen
Brücken, gewinnt der Künstler den Impuls flie-
ßender Bewegung ab. Es ist Zug der Wanderung
in diesen Wegläufen über flutenden Wässern,
bekrönt von den fliehenden Linien des Gebirges
unter der jagenden Wolken Eiligkeit. Über
solchen, die Tragik düstererThemenbetonenden
Visionen breitet Heinrich Schröders Eigenart,
die der Mäßigung hinneigt, geruhige Stimmungen
einer im Grau der Melancholie sich verschmel-
zenden Töne. Selbst der tiefe Ernst, der aus
dem ragenden Mauerwerk monumentaler Armut
der spanischen Dörfer spricht, und selbst die
zerklüftete Rauheit der kahlen Gebirge verraten
(obwohl sie in künstlerischer Aufrichtigkeit
338
HEINRICH SCHRÖDER WIEN.
GEMÄLDE »LANDSCHAFT«
mien eine Rolle als die Werkstätte-Atmosphäre
jener Kreise, deren lebendiges Gut noch die
Lehre Cesannes war. Dort wurde dieses Mei-
sters Geständnis noch nicht als erstarrte Dogmen
herumgereicht. Nicht gleich fand Schröder den
Schlüssel zu dem Geheimnis der Farbenver-
einfachung bei gleichzeitiger Wahrung intensiv-
ster Tonfülle. Die ersten Landschaften an der
Küste der Normandie gemalt (1909) sind zwar
interessant und großzügig im Ausschnitt des
Motives, aber hart, einförmig, und ohne Vi-
bration flutender Kräfte. Erst in seiner zweiten
Periode, die unmittelbar bis zum Kriegsausbruch
sich dehnt, überwindet Schröder die programm-
mäßige Lösung der Probleme und findet nun
zur Wärme, zur Differenziertheit, zur Mannig-
faltigkeit der kubisch und lapidar erschauten
Natur. Offenbarung wird ihm hier Süd-Frank-
reichs und Spaniens Landschaftsbild. In diesen
Ländern der weiten Himmeln nahmen den Maler
die Dramen der Horizonte gefangen; die steilen
Höhenzüge, an welche hier und dort, keck und
kletterisch einsame Dörfer sich anklammern.
Raschen Strömen, überwölbt von bogenreichen
Brücken, gewinnt der Künstler den Impuls flie-
ßender Bewegung ab. Es ist Zug der Wanderung
in diesen Wegläufen über flutenden Wässern,
bekrönt von den fliehenden Linien des Gebirges
unter der jagenden Wolken Eiligkeit. Über
solchen, die Tragik düstererThemenbetonenden
Visionen breitet Heinrich Schröders Eigenart,
die der Mäßigung hinneigt, geruhige Stimmungen
einer im Grau der Melancholie sich verschmel-
zenden Töne. Selbst der tiefe Ernst, der aus
dem ragenden Mauerwerk monumentaler Armut
der spanischen Dörfer spricht, und selbst die
zerklüftete Rauheit der kahlen Gebirge verraten
(obwohl sie in künstlerischer Aufrichtigkeit
338