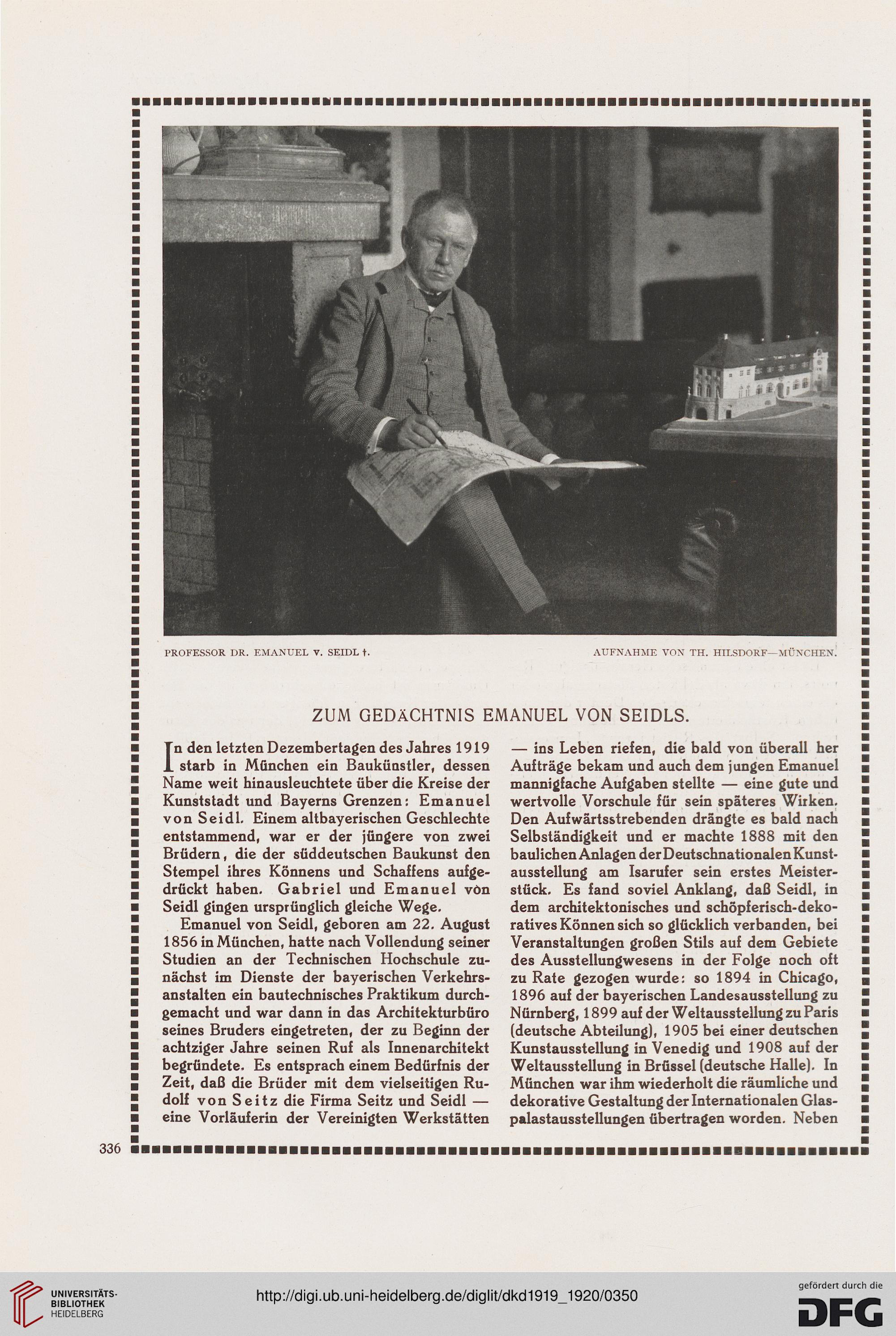PROFESSOR DR. F.MANUEL V. SEIDL t.
AUFNAHME VON" TH. HTT.SDORF—MÜNCHEN.
ZUM GEDÄCHTNIS EMANUEL VON SEIDLS.
In den letzten Dezember tagen des Jahres 1919
starb in München ein Baukünstler, dessen
Name weit hinausleuchtete über die Kreise der
Kunststadt und Bayerns Grenzen: Emanuel
von Seidl. Einem altbayerischen Geschlechte
entstammend, war er der jüngere von zwei
Brüdern, die der süddeutschen Baukunst den
Stempel ihres Könnens und Schaffens aufge-
drückt haben. Gabriel und Emanuel von
Seidl gingen ursprünglich gleiche Wege.
Emanuel von Seidl, geboren am 22. August
1856 in München, hatte nach Vollendung seiner
Studien an der Technischen Hochschule zu-
nächst im Dienste der bayerischen Verkehrs-
anstalten ein bautechnisches Praktikum durch-
gemacht und war dann in das Architekturbüro
seines Bruders eingetreten, der zu Beginn der
achtziger Jahre seinen Ruf als Innenarchitekt
begründete. Es entsprach einem Bedürfnis der
Zeit, daß die Brüder mit dem vielseitigen Ru-
dolf von Seitz die Firma Seitz und Seidl —
eine Vorläuferin der Vereinigten Werkstätten
— ins Leben riefen, die bald von überall her
Aufträge bekam und auch dem jungen Emanuel
mannigfache Aufgaben stellte — eine gute und
wertvolle Vorschule für sein späteres Wirken.
Den Aufwärtsstrebenden drängte es bald nach
Selbständigkeit und er machte 1888 mit den
baulichen Anlagen der Deutschnationalen Kunst-
ausstellung am Isarufer sein erstes Meister-
stück. Es fand soviel Anklang, daß Seidl, in
dem architektonisches und schöpferisch-deko-
ratives Können sich so glücklich verbanden, bei
Veranstaltungen großen Stils auf dem Gebiete
des Ausstellungwesens in der Folge noch oft
zu Rate gezogen wurde: so 1894 in Chicago,
1896 auf der bayerischen Landesausstellung zu
Nürnberg, 1899 auf der Weltausstellung zu Paris
(deutsche Abteilung), 1905 bei einer deutschen
Kunstausstellung in Venedig und 1908 auf der
Weltausstellung in Brüssel (deutsche Halle). In
München war ihm wiederholt die räumliche und
dekorative Gestaltung der Internationalen Glas-
palastausstellungen übertragen worden. Neben
AUFNAHME VON" TH. HTT.SDORF—MÜNCHEN.
ZUM GEDÄCHTNIS EMANUEL VON SEIDLS.
In den letzten Dezember tagen des Jahres 1919
starb in München ein Baukünstler, dessen
Name weit hinausleuchtete über die Kreise der
Kunststadt und Bayerns Grenzen: Emanuel
von Seidl. Einem altbayerischen Geschlechte
entstammend, war er der jüngere von zwei
Brüdern, die der süddeutschen Baukunst den
Stempel ihres Könnens und Schaffens aufge-
drückt haben. Gabriel und Emanuel von
Seidl gingen ursprünglich gleiche Wege.
Emanuel von Seidl, geboren am 22. August
1856 in München, hatte nach Vollendung seiner
Studien an der Technischen Hochschule zu-
nächst im Dienste der bayerischen Verkehrs-
anstalten ein bautechnisches Praktikum durch-
gemacht und war dann in das Architekturbüro
seines Bruders eingetreten, der zu Beginn der
achtziger Jahre seinen Ruf als Innenarchitekt
begründete. Es entsprach einem Bedürfnis der
Zeit, daß die Brüder mit dem vielseitigen Ru-
dolf von Seitz die Firma Seitz und Seidl —
eine Vorläuferin der Vereinigten Werkstätten
— ins Leben riefen, die bald von überall her
Aufträge bekam und auch dem jungen Emanuel
mannigfache Aufgaben stellte — eine gute und
wertvolle Vorschule für sein späteres Wirken.
Den Aufwärtsstrebenden drängte es bald nach
Selbständigkeit und er machte 1888 mit den
baulichen Anlagen der Deutschnationalen Kunst-
ausstellung am Isarufer sein erstes Meister-
stück. Es fand soviel Anklang, daß Seidl, in
dem architektonisches und schöpferisch-deko-
ratives Können sich so glücklich verbanden, bei
Veranstaltungen großen Stils auf dem Gebiete
des Ausstellungwesens in der Folge noch oft
zu Rate gezogen wurde: so 1894 in Chicago,
1896 auf der bayerischen Landesausstellung zu
Nürnberg, 1899 auf der Weltausstellung zu Paris
(deutsche Abteilung), 1905 bei einer deutschen
Kunstausstellung in Venedig und 1908 auf der
Weltausstellung in Brüssel (deutsche Halle). In
München war ihm wiederholt die räumliche und
dekorative Gestaltung der Internationalen Glas-
palastausstellungen übertragen worden. Neben