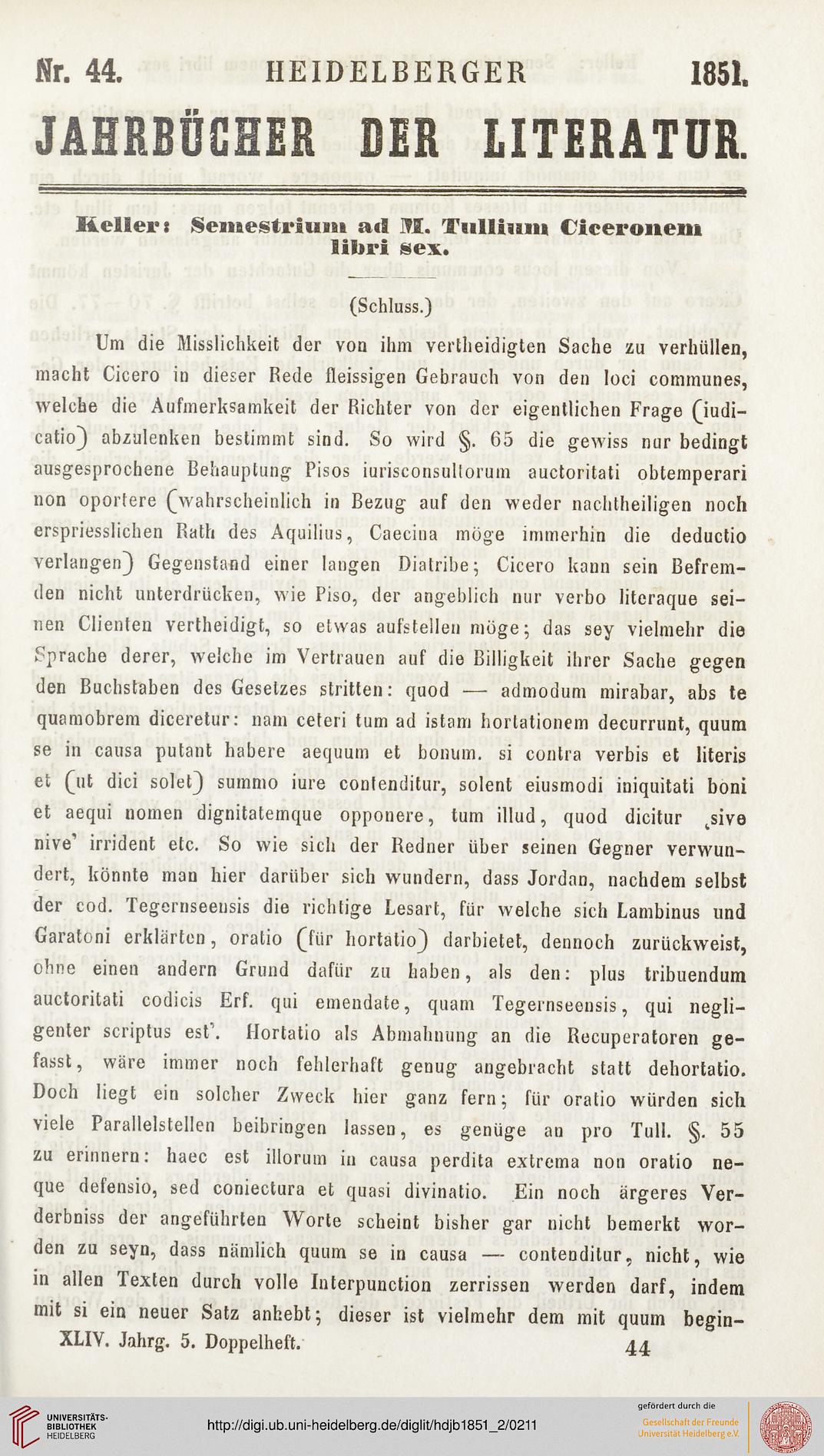Nr. 44.
HEIDELBERGER
1851.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Keller: Semestrium ad .11. Tulliiuii Ciceroneni
libri sex.
(Schluss.)
Um die Misslichkeit der von ihm verteidigten Sache zu verhüllen,
macht Cicero in dieser Rede fleissigen Gebrauch von den loci communes,
welche die Aufmerksamkeit der Richter von der eigentlichen Frage (judi—
catio} abzulenken bestimmt sind. So wird §. 65 die gewiss nur bedingt
ausgesprochene Behauptung Pisos iurisconsultorum auctoritati obtemperari
non oportere (wahrscheinlich in Bezug auf den weder nachtheiligen noch
erspriesslichen Rath des Aquilins, Caecina möge immerhin die deductio
verlangen} Gegenstand einer langen Diatribe; Cicero kann sein Befrem-
den nicht unterdrücken, wie Piso, der angeblich nur verbo literaque sei-
nen Clienten verteidigt, so etwas aufstellen möge; das sey vielmehr die
Sprache derer, welche im Vertrauen auf die Billigkeit ihrer Sache gegen
den Buchstaben des Gesetzes stritten: quod — admodum mirabar, abs te
quamobrem diceretur: nam ceteri tum ad istam hortationem decurrunt, quum
se in causa putant habere aequum et bonum. si contra verbis et literis
et (ut dici solet} summo iure contenditur, solent eiusmodi iniquitati boni
et aequi nomen dignitateinque opponere, tum illud, quod dicitur tsive
nive’ irrident etc. So wie sich der Redner über seinen Gegner verwun-
dert, könnte man hier darüber sich wundern, dass Jordan, nachdem selbst
der cod. Tegernseensis die richtige Lesart, für welche sich Lambinus und
Garatoni erklärten, oratio (für hortatio} darbietet, dennoch zurückweist,
ohne einen andern Grund dafür zu haben, als den: plus tribuendum
auctoritati codicis Erf. qui emendate, quam Tegernseensis, qui negli-
genter scriptus est'. Hortatio als Abmahnung an die Recuperatoren ge-
fasst, wäre immer noch fehlerhaft genug angebracht statt dehortatio.
Doch liegt ein solcher Zweck hier ganz fern; für oratio würden sich
viele Parallelstellen beibringen lassen, es genüge an pro Tüll. §. 55
zu erinnern: haec est illorum in causa perdita extrema non oratio ne-
que defensio, sed coniectura et quasi divinatio. Ein noch ärgeres Ver-
derbniss der angeführten Worte scheint bisher gar nicht bemerkt wor-
den zu seyn, dass nämlich quum se in causa — contenditur, nicht, wie
in allen Texten durch volle Interpunction zerrissen werden darf, indem
mit si ein neuer Satz anhebt; dieser ist vielmehr dem mit quum begin-
XLIV. Jahrg. 5. Doppelheft. 44
HEIDELBERGER
1851.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Keller: Semestrium ad .11. Tulliiuii Ciceroneni
libri sex.
(Schluss.)
Um die Misslichkeit der von ihm verteidigten Sache zu verhüllen,
macht Cicero in dieser Rede fleissigen Gebrauch von den loci communes,
welche die Aufmerksamkeit der Richter von der eigentlichen Frage (judi—
catio} abzulenken bestimmt sind. So wird §. 65 die gewiss nur bedingt
ausgesprochene Behauptung Pisos iurisconsultorum auctoritati obtemperari
non oportere (wahrscheinlich in Bezug auf den weder nachtheiligen noch
erspriesslichen Rath des Aquilins, Caecina möge immerhin die deductio
verlangen} Gegenstand einer langen Diatribe; Cicero kann sein Befrem-
den nicht unterdrücken, wie Piso, der angeblich nur verbo literaque sei-
nen Clienten verteidigt, so etwas aufstellen möge; das sey vielmehr die
Sprache derer, welche im Vertrauen auf die Billigkeit ihrer Sache gegen
den Buchstaben des Gesetzes stritten: quod — admodum mirabar, abs te
quamobrem diceretur: nam ceteri tum ad istam hortationem decurrunt, quum
se in causa putant habere aequum et bonum. si contra verbis et literis
et (ut dici solet} summo iure contenditur, solent eiusmodi iniquitati boni
et aequi nomen dignitateinque opponere, tum illud, quod dicitur tsive
nive’ irrident etc. So wie sich der Redner über seinen Gegner verwun-
dert, könnte man hier darüber sich wundern, dass Jordan, nachdem selbst
der cod. Tegernseensis die richtige Lesart, für welche sich Lambinus und
Garatoni erklärten, oratio (für hortatio} darbietet, dennoch zurückweist,
ohne einen andern Grund dafür zu haben, als den: plus tribuendum
auctoritati codicis Erf. qui emendate, quam Tegernseensis, qui negli-
genter scriptus est'. Hortatio als Abmahnung an die Recuperatoren ge-
fasst, wäre immer noch fehlerhaft genug angebracht statt dehortatio.
Doch liegt ein solcher Zweck hier ganz fern; für oratio würden sich
viele Parallelstellen beibringen lassen, es genüge an pro Tüll. §. 55
zu erinnern: haec est illorum in causa perdita extrema non oratio ne-
que defensio, sed coniectura et quasi divinatio. Ein noch ärgeres Ver-
derbniss der angeführten Worte scheint bisher gar nicht bemerkt wor-
den zu seyn, dass nämlich quum se in causa — contenditur, nicht, wie
in allen Texten durch volle Interpunction zerrissen werden darf, indem
mit si ein neuer Satz anhebt; dieser ist vielmehr dem mit quum begin-
XLIV. Jahrg. 5. Doppelheft. 44