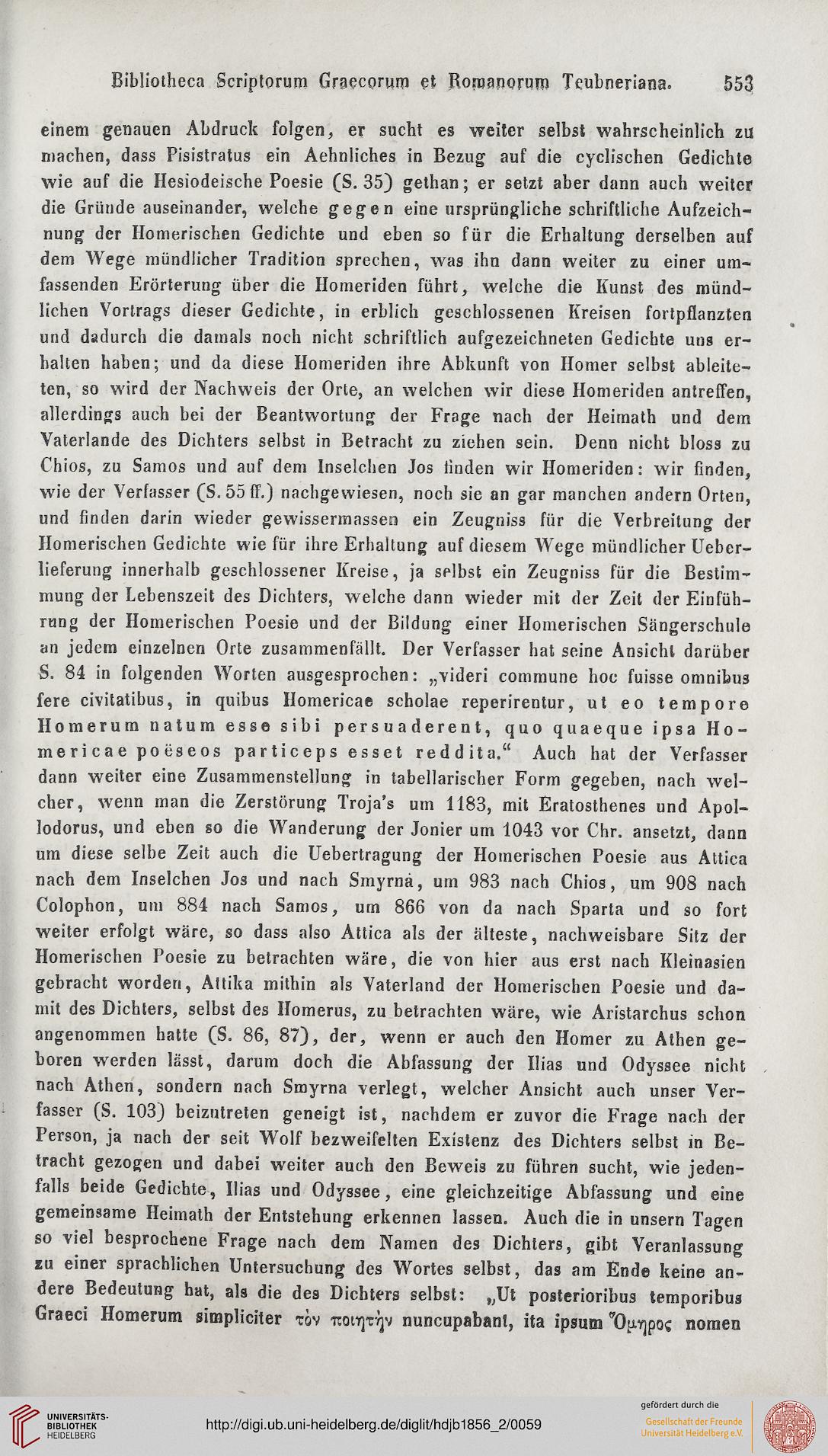Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Roraanorum Teubneriana. 553
einem genauen Abdruck folgen, er sucht es weiter selbst wahrscheinlich zu
machen, dass Pisistratus ein Aehnliches in Bezug auf die cyclischen Gedichte
wie auf die Hesiodeische Poesie (S. 35) gethan; er setzt aber dann auch weiter
die Gründe auseinander, welche gegen eine ursprüngliche schriftliche Aufzeich-
nung der Homerischen Gedichte und eben so für die Erhaltung derselben auf
dem Wege mündlicher Tradition sprechen, was ihn dann weiter zu einer um-
fassenden Erörterung über die Homeriden führt, welche die Kunst des münd-
lichen Vortrags dieser Gedichte, in erblich geschlossenen Kreisen fortpflanzten
und dadurch die damals noch nicht schriftlich aufgezeichneten Gedichte uns er-
halten haben; und da diese Homeriden ihre Abkunft von Homer selbst ableite-
ten, so wird der Nachweis der Orte, an welchen wir diese Homeriden antreffen,
allerdings auch bei der Beantwortung der Frage nach der Heimath und dem
Vaterlande des Dichters selbst in Betracht zu ziehen sein. Denn nicht bloss zu
Chios, zu Samos und auf dem Inselchen Jos linden wir Homeriden: wir finden,
wie der Verfasser (S.551T.) nachgewiesen, noch sie an gar manchen andern Orten,
und finden darin wieder gewissermassen ein Zeugniss für die Verbreitung der
Homerischen Gedichte wie für ihre Erhaltung auf diesem Wege mündlicher Ueber-
lieferung innerhalb geschlossener Kreise, ja selbst ein Zeugniss für die Bestim-
mung der Lebenszeit des Dichters, welche dann wieder mit der Zeit der Einfüh-
rung der Homerischen Poesie und der Bildung einer Homerischen Sängerschule
an jedem einzelnen Orte zusammenfällt. Der Verfasser hat seine Ansicht darüber
S. 84 in folgenden Worten ausgesprochen: „videri commune hoc fuisse Omnibus
fere civitatibus, in quibus Homericae scholae reperirentur, ut eo tempore
Homerum natum esse sibi per s u a d e re n t, quo quaeque ipsa Ho-
mericae poeseos particeps esset reddita.“ Auch hat der Verfasser
dann weiter eine Zusammenstellung in tabellarischer Form gegeben, nach wel-
cher, wenn man die Zerstörung Troja’s um 1183, mit Eratosthenes und Apol-
lodorus, und eben so die Wanderung der Jonier um 1043 vor Chr. ansetzt, dann
um diese selbe Zeit auch die Uebertragung der Homerischen Poesie aus Attica
nach dem Inselchen Jos und nach Smyrna, um 983 nach Chios, um 908 nach
Colophon, um 884 nach Samos, um 866 von da nach Sparta und so fort
weiter erfolgt wäre, so dass also Attica als der älteste, nachweisbare Sitz der
Homerischen Poesie zu betrachten wäre, die von hier aus erst nach Kleinasien
gebracht worden, Attika mithin als Vaterland der Homerischen Poesie und da-
mit des Dichters, selbst des Ilomerus, zu betrachten wäre, wie Aristarchus schon
angenommen hatte (S. 86, 87), der, wenn er auch den Homer zu Athen ge-
boren werden lässt, darum doch die Abfassung der Ilias und Odyssee nicht
nach Athen, sondern nach Smyrna verlegt, welcher Ansicht auch unser Ver-
fasser (S. 103) beizutreten geneigt ist, nachdem er zuvor die Frage nach der
Person, ja nach der seit Wolf bezweifelten Existenz des Dichters selbst in Be-
tracht gezogen und dabei weiter auch den Beweis zu führen sucht, wie jeden-
falls beide Gedichte, Ilias und Odyssee, eine gleichzeitige Abfassung und eine
gemeinsame Heimath der Entstehung erkennen lassen. Auch die in unsern Tagen
so viel besprochene Frage nach dem Namen des Dichters, gibt Veranlassung
zu einer sprachlichen Untersuchung des Wortes selbst, das am Ende keine an-
dere Bedeutung hat, als die des Dichters selbst: „Ut posterioribus temporibus
Graeci Homerum simpliciter töv hocvjttjv nuncupabanl, ita ipsum ’Öu.vjpo; nomen
einem genauen Abdruck folgen, er sucht es weiter selbst wahrscheinlich zu
machen, dass Pisistratus ein Aehnliches in Bezug auf die cyclischen Gedichte
wie auf die Hesiodeische Poesie (S. 35) gethan; er setzt aber dann auch weiter
die Gründe auseinander, welche gegen eine ursprüngliche schriftliche Aufzeich-
nung der Homerischen Gedichte und eben so für die Erhaltung derselben auf
dem Wege mündlicher Tradition sprechen, was ihn dann weiter zu einer um-
fassenden Erörterung über die Homeriden führt, welche die Kunst des münd-
lichen Vortrags dieser Gedichte, in erblich geschlossenen Kreisen fortpflanzten
und dadurch die damals noch nicht schriftlich aufgezeichneten Gedichte uns er-
halten haben; und da diese Homeriden ihre Abkunft von Homer selbst ableite-
ten, so wird der Nachweis der Orte, an welchen wir diese Homeriden antreffen,
allerdings auch bei der Beantwortung der Frage nach der Heimath und dem
Vaterlande des Dichters selbst in Betracht zu ziehen sein. Denn nicht bloss zu
Chios, zu Samos und auf dem Inselchen Jos linden wir Homeriden: wir finden,
wie der Verfasser (S.551T.) nachgewiesen, noch sie an gar manchen andern Orten,
und finden darin wieder gewissermassen ein Zeugniss für die Verbreitung der
Homerischen Gedichte wie für ihre Erhaltung auf diesem Wege mündlicher Ueber-
lieferung innerhalb geschlossener Kreise, ja selbst ein Zeugniss für die Bestim-
mung der Lebenszeit des Dichters, welche dann wieder mit der Zeit der Einfüh-
rung der Homerischen Poesie und der Bildung einer Homerischen Sängerschule
an jedem einzelnen Orte zusammenfällt. Der Verfasser hat seine Ansicht darüber
S. 84 in folgenden Worten ausgesprochen: „videri commune hoc fuisse Omnibus
fere civitatibus, in quibus Homericae scholae reperirentur, ut eo tempore
Homerum natum esse sibi per s u a d e re n t, quo quaeque ipsa Ho-
mericae poeseos particeps esset reddita.“ Auch hat der Verfasser
dann weiter eine Zusammenstellung in tabellarischer Form gegeben, nach wel-
cher, wenn man die Zerstörung Troja’s um 1183, mit Eratosthenes und Apol-
lodorus, und eben so die Wanderung der Jonier um 1043 vor Chr. ansetzt, dann
um diese selbe Zeit auch die Uebertragung der Homerischen Poesie aus Attica
nach dem Inselchen Jos und nach Smyrna, um 983 nach Chios, um 908 nach
Colophon, um 884 nach Samos, um 866 von da nach Sparta und so fort
weiter erfolgt wäre, so dass also Attica als der älteste, nachweisbare Sitz der
Homerischen Poesie zu betrachten wäre, die von hier aus erst nach Kleinasien
gebracht worden, Attika mithin als Vaterland der Homerischen Poesie und da-
mit des Dichters, selbst des Ilomerus, zu betrachten wäre, wie Aristarchus schon
angenommen hatte (S. 86, 87), der, wenn er auch den Homer zu Athen ge-
boren werden lässt, darum doch die Abfassung der Ilias und Odyssee nicht
nach Athen, sondern nach Smyrna verlegt, welcher Ansicht auch unser Ver-
fasser (S. 103) beizutreten geneigt ist, nachdem er zuvor die Frage nach der
Person, ja nach der seit Wolf bezweifelten Existenz des Dichters selbst in Be-
tracht gezogen und dabei weiter auch den Beweis zu führen sucht, wie jeden-
falls beide Gedichte, Ilias und Odyssee, eine gleichzeitige Abfassung und eine
gemeinsame Heimath der Entstehung erkennen lassen. Auch die in unsern Tagen
so viel besprochene Frage nach dem Namen des Dichters, gibt Veranlassung
zu einer sprachlichen Untersuchung des Wortes selbst, das am Ende keine an-
dere Bedeutung hat, als die des Dichters selbst: „Ut posterioribus temporibus
Graeci Homerum simpliciter töv hocvjttjv nuncupabanl, ita ipsum ’Öu.vjpo; nomen