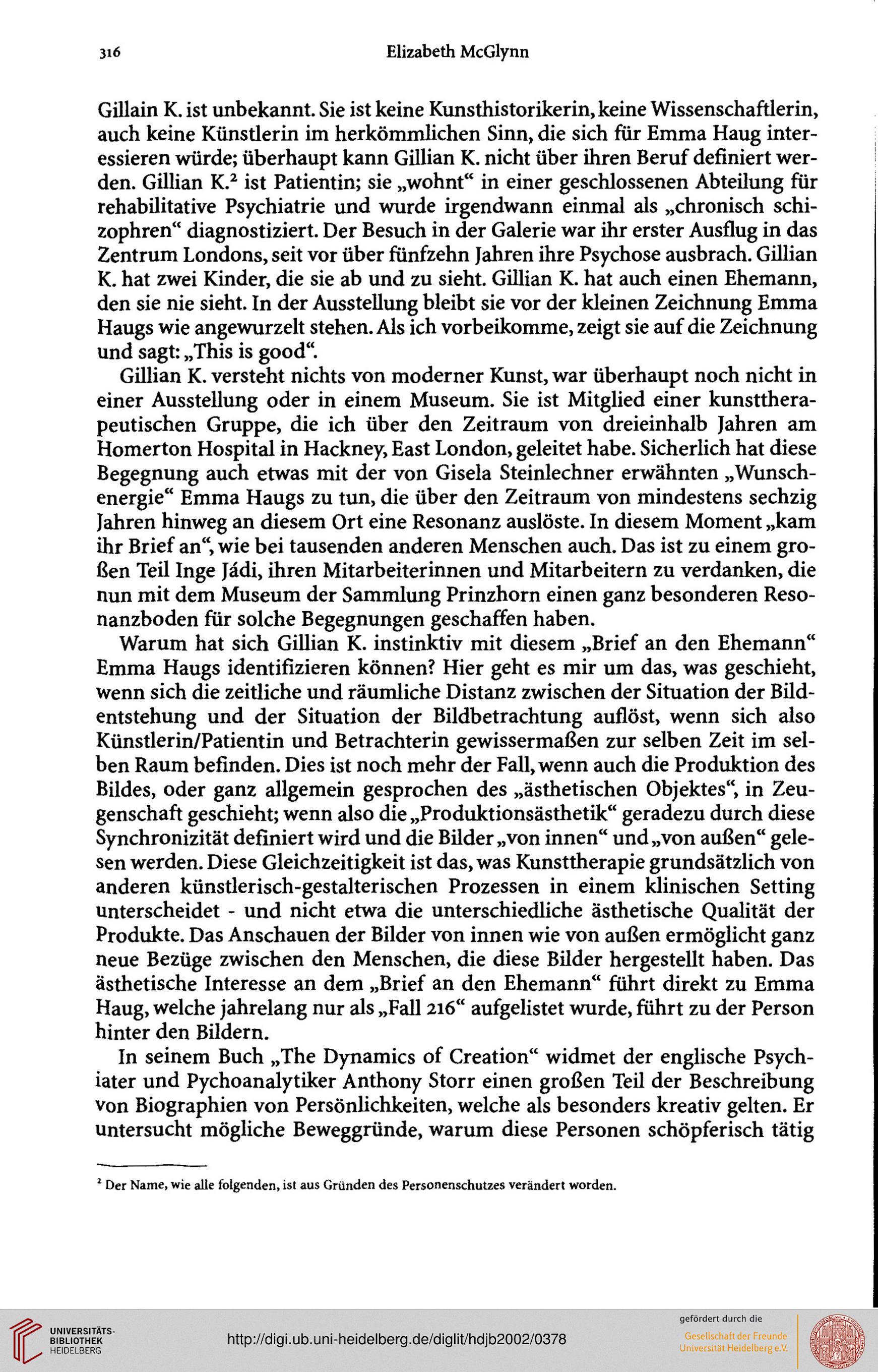ii6 Elizabeth McGlynn
Gillain K. ist unbekannt. Sie ist keine Kunsthistorikerin, keine Wissenschaftlerin,
auch keine Künstlerin im herkömmlichen Sinn, die sich für Emma Haug inter-
essieren würde; überhaupt kann Gillian K. nicht über ihren Beruf definiert wer-
den. Gillian K.2 ist Patientin; sie „wohnt" in einer geschlossenen Abteilung für
rehabilitative Psychiatrie und wurde irgendwann einmal als „chronisch schi-
zophren" diagnostiziert. Der Besuch in der Galerie war ihr erster Ausflug in das
Zentrum Londons, seit vor über fünfzehn Jahren ihre Psychose ausbrach. Gillian
K. hat zwei Kinder, die sie ab und zu sieht. Gillian K. hat auch einen Ehemann,
den sie nie sieht. In der Ausstellung bleibt sie vor der kleinen Zeichnung Emma
Haugs wie angewurzelt stehen. Als ich vorbeikomme, zeigt sie auf die Zeichnung
und sagt: „This is good".
Gillian K. versteht nichts von moderner Kunst, war überhaupt noch nicht in
einer Ausstellung oder in einem Museum. Sie ist Mitglied einer kunstthera-
peutischen Gruppe, die ich über den Zeitraum von dreieinhalb Jahren am
Homerton Hospital in Hackney, East London, geleitet habe. Sicherlich hat diese
Begegnung auch etwas mit der von Gisela Steinlechner erwähnten „Wunsch-
energie" Emma Haugs zu tun, die über den Zeitraum von mindestens sechzig
Jahren hinweg an diesem Ort eine Resonanz auslöste. In diesem Moment „kam
ihr Brief an", wie bei tausenden anderen Menschen auch. Das ist zu einem gro-
ßen Teil Inge Jädi, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die
nun mit dem Museum der Sammlung Prinzhorn einen ganz besonderen Reso-
nanzboden für solche Begegnungen geschaffen haben.
Warum hat sich Gillian K. instinktiv mit diesem „Brief an den Ehemann"
Emma Haugs identifizieren können? Hier geht es mir um das, was geschieht,
wenn sich die zeitliche und räumliche Distanz zwischen der Situation der Bild-
entstehung und der Situation der Bildbetrachtung auflöst, wenn sich also
Künstlerin/Patientin und Betrachterin gewissermaßen zur selben Zeit im sel-
ben Raum befinden. Dies ist noch mehr der Fall, wenn auch die Produktion des
Bildes, oder ganz allgemein gesprochen des „ästhetischen Objektes", in Zeu-
genschaft geschieht; wenn also die „Produktionsästhetik" geradezu durch diese
Synchronizität definiert wird und die Bilder „von innen" und „von außen" gele-
sen werden. Diese Gleichzeitigkeit ist das, was Kunsttherapie grundsätzlich von
anderen künstlerisch-gestalterischen Prozessen in einem klinischen Setting
unterscheidet - und nicht etwa die unterschiedliche ästhetische Qualität der
Produkte. Das Anschauen der Bilder von innen wie von außen ermöglicht ganz
neue Bezüge zwischen den Menschen, die diese Bilder hergestellt haben. Das
ästhetische Interesse an dem „Brief an den Ehemann" führt direkt zu Emma
Haug, welche jahrelang nur als „Fall 216" aufgelistet wurde, führt zu der Person
hinter den Bildern.
In seinem Buch „The Dynamics of Creation" widmet der englische Psych-
iater und Pychoanalytiker Anthony Storr einen großen Teil der Beschreibung
von Biographien von Persönlichkeiten, welche als besonders kreativ gelten. Er
untersucht mögliche Beweggründe, warum diese Personen schöpferisch tätig
2 Der Name, wie alle folgenden, ist aus Gründen des Personenschutzes verändert worden.
Gillain K. ist unbekannt. Sie ist keine Kunsthistorikerin, keine Wissenschaftlerin,
auch keine Künstlerin im herkömmlichen Sinn, die sich für Emma Haug inter-
essieren würde; überhaupt kann Gillian K. nicht über ihren Beruf definiert wer-
den. Gillian K.2 ist Patientin; sie „wohnt" in einer geschlossenen Abteilung für
rehabilitative Psychiatrie und wurde irgendwann einmal als „chronisch schi-
zophren" diagnostiziert. Der Besuch in der Galerie war ihr erster Ausflug in das
Zentrum Londons, seit vor über fünfzehn Jahren ihre Psychose ausbrach. Gillian
K. hat zwei Kinder, die sie ab und zu sieht. Gillian K. hat auch einen Ehemann,
den sie nie sieht. In der Ausstellung bleibt sie vor der kleinen Zeichnung Emma
Haugs wie angewurzelt stehen. Als ich vorbeikomme, zeigt sie auf die Zeichnung
und sagt: „This is good".
Gillian K. versteht nichts von moderner Kunst, war überhaupt noch nicht in
einer Ausstellung oder in einem Museum. Sie ist Mitglied einer kunstthera-
peutischen Gruppe, die ich über den Zeitraum von dreieinhalb Jahren am
Homerton Hospital in Hackney, East London, geleitet habe. Sicherlich hat diese
Begegnung auch etwas mit der von Gisela Steinlechner erwähnten „Wunsch-
energie" Emma Haugs zu tun, die über den Zeitraum von mindestens sechzig
Jahren hinweg an diesem Ort eine Resonanz auslöste. In diesem Moment „kam
ihr Brief an", wie bei tausenden anderen Menschen auch. Das ist zu einem gro-
ßen Teil Inge Jädi, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die
nun mit dem Museum der Sammlung Prinzhorn einen ganz besonderen Reso-
nanzboden für solche Begegnungen geschaffen haben.
Warum hat sich Gillian K. instinktiv mit diesem „Brief an den Ehemann"
Emma Haugs identifizieren können? Hier geht es mir um das, was geschieht,
wenn sich die zeitliche und räumliche Distanz zwischen der Situation der Bild-
entstehung und der Situation der Bildbetrachtung auflöst, wenn sich also
Künstlerin/Patientin und Betrachterin gewissermaßen zur selben Zeit im sel-
ben Raum befinden. Dies ist noch mehr der Fall, wenn auch die Produktion des
Bildes, oder ganz allgemein gesprochen des „ästhetischen Objektes", in Zeu-
genschaft geschieht; wenn also die „Produktionsästhetik" geradezu durch diese
Synchronizität definiert wird und die Bilder „von innen" und „von außen" gele-
sen werden. Diese Gleichzeitigkeit ist das, was Kunsttherapie grundsätzlich von
anderen künstlerisch-gestalterischen Prozessen in einem klinischen Setting
unterscheidet - und nicht etwa die unterschiedliche ästhetische Qualität der
Produkte. Das Anschauen der Bilder von innen wie von außen ermöglicht ganz
neue Bezüge zwischen den Menschen, die diese Bilder hergestellt haben. Das
ästhetische Interesse an dem „Brief an den Ehemann" führt direkt zu Emma
Haug, welche jahrelang nur als „Fall 216" aufgelistet wurde, führt zu der Person
hinter den Bildern.
In seinem Buch „The Dynamics of Creation" widmet der englische Psych-
iater und Pychoanalytiker Anthony Storr einen großen Teil der Beschreibung
von Biographien von Persönlichkeiten, welche als besonders kreativ gelten. Er
untersucht mögliche Beweggründe, warum diese Personen schöpferisch tätig
2 Der Name, wie alle folgenden, ist aus Gründen des Personenschutzes verändert worden.