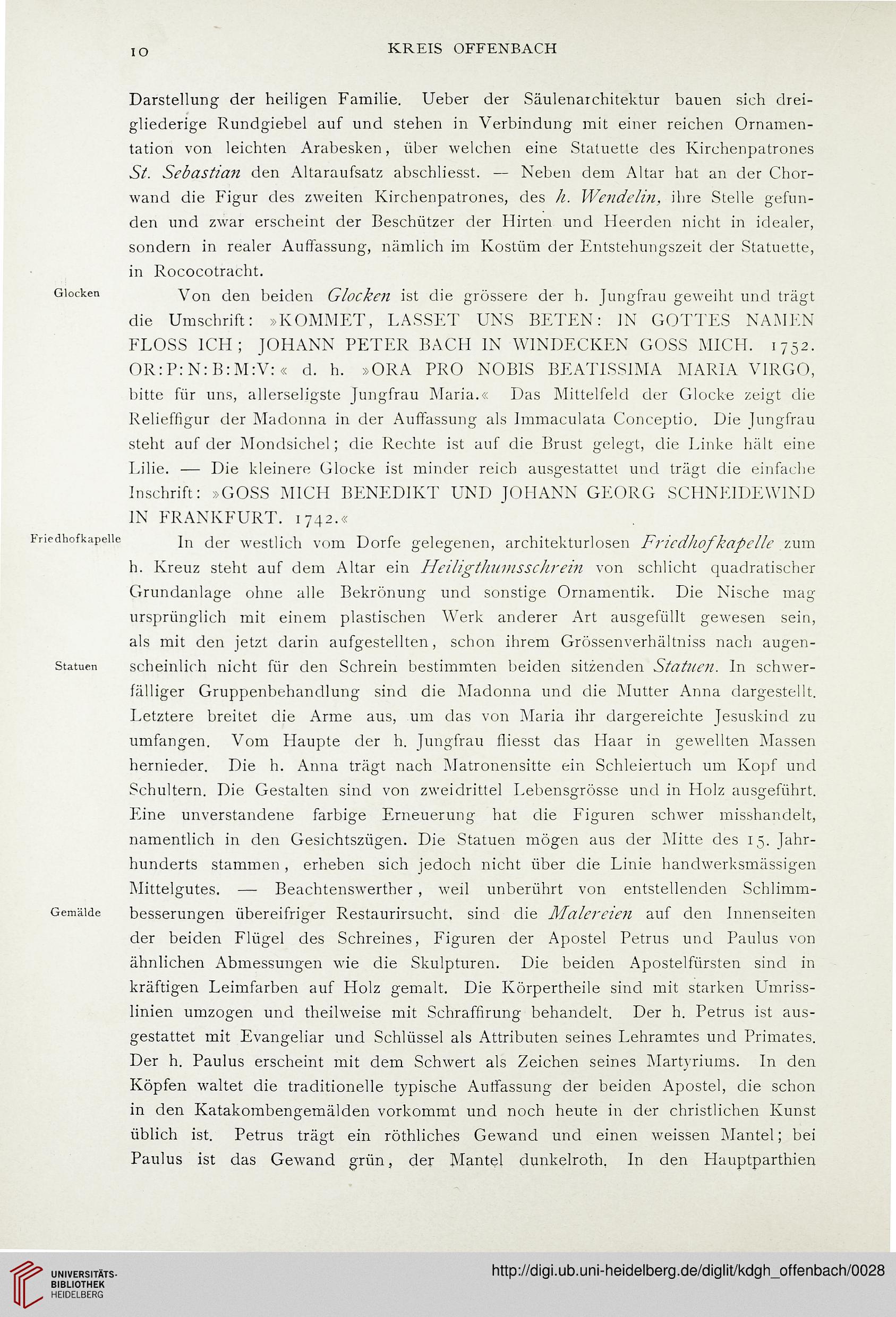IO
KREIS OFFENBACH
Darstellung der heiligen Familie. Ueber der Säulenarchitektur bauen sich drei-
gliederige Rundgiebel auf und stehen in Verbindung mit einer reichen Ornamen-
tation von leichten Arabesken, über welchen eine Statuette des Kirchenpatrones
.SV. Sebastian den Altaraufsatz abschliesst. — Neben d ein Altar hat an der Chor-
wand die Figur des zweiten Kirchenpatrones, des Wendeli7i. ihre Stelle gefun-
den und zwar erscheint der Beschützer der Hirten und Heerden nicht in idealer,
sondern in realer Auffassung, nämlich im Kostüm der Entstehungszeit der Statuette,
in Rococotracht.
Glockcn Von den beiden Glocken ist die grössere der h. Jungfrau geweiht und trägt
die Umschrift: »KOMMET, LASSET UNS BETEN: IN GOTTES NAMEN
FLOSS ICH; JOHANN PETER RÄCH IN WINDECKEN GOSS MICH. 1752.
OR:P:N:B:M:V:« d. h. »ORA PRO NOB1S BEATISS1MA MARIA VIRGO,
bitte für uns, allerseligste Jungfrau Maria.« Das Mittelfeld der Glocke zeigt die
Kelieffigur der Madonna in der Auffassung als Immaculata Conceptio. Die Jungfrau
steht auf der Mondsichel; die Rechte ist auf die Brust gelegt, die Linke hält eine
Lilie. — Die kleinere Glocke ist minder reich ausgestattet und trägt die einfache
Inschrift: »GOSS MICH BENEDIKT UND JOHANN GEORG SCHNEIDEWIND
IN FRANKFURT. 1742.«
edhofkapeiie jn t]er westlich V(,m Dorfe gelegenen, architekturlosen FricdJiofkapeile zum
h. Kreuz steht auf dem Altar ein HeiligthumsscJirein von schlicht quadratischer
Grundanlage ohne alle Bekrönung und sonstige Ornamentik. Die Nische mag
ursprünglich mit einem plastischen Werk anderer Art ausgefüllt gewesen sein,
als mit den jetzt darin aufgestellten, schon ihrem Grössenverhältniss nach augen-
Statuen scheinlich nicht für den Schrein bestimmten beiden sitzenden Statuen. In schwer-
fälliger Gruppenbehandlung sind die Madonna und die Mutter Anna dargestellt.
Letztere breitet die Arme aus, um das von Maria ihr dargereichte Jesuskind zu
umfangen. Vom Haupte der h. Jungfrau fiiesst das Haar in gewellten Massen
hernieder. Die h. Anna trägt nach Matronensitte ein Schleiertuch um Kopf und
Schultern. Die Gestalten sind von zwei drittel Lebens^rösse und in Holz ausgeführt.
Eine unverstandene farbige Erneuerung hat die Figuren schwer misshandelt,
namentlich in den Gesichtszügen. Die Statuen mögen aus der Mitte des 1,5. Jahr-
hunderts stammen , erheben sich jedoch nicht über die Linie handwerksmässigen
Mittelgutes. —• Beachtenswerther , weil unberührt von entstellenden Schlimm-
Gemäide besserungen übereifriger Restaurirsucht, sind die Malereien auf den Innenseiten
der beiden Flügel des Schreines, Figuren der Apostel Petrus und Paulus von
ähnlichen Abmessungen wie die Skulpturen. Die beiden Apostelfürsten sind in
kräftigen Leimfarben auf Holz gemalt. Die Körpertheile sind mit starken Umriss-
linien umzogen und theilweise mit Schraffirung behandelt. Der h. Petrus ist aus-
gestattet mit Evangeliar und Schlüssel als Attributen seines Lehramtes und Primates.
Der h. Paulus erscheint mit dem Schwert als Zeichen seines Martyriums. In den
Köpfen waltet die traditionelle typische Auffassung der beiden Apostel, die schon
in den Katakombengemälden vorkommt und noch heute in der christlichen Kunst
üblich ist. Petrus trägt ein röthliches Gewand und einen weissen Mantel; bei
Paulus ist das Gewand grün, der Mantel dunkelroth. In den Hauptparthien
KREIS OFFENBACH
Darstellung der heiligen Familie. Ueber der Säulenarchitektur bauen sich drei-
gliederige Rundgiebel auf und stehen in Verbindung mit einer reichen Ornamen-
tation von leichten Arabesken, über welchen eine Statuette des Kirchenpatrones
.SV. Sebastian den Altaraufsatz abschliesst. — Neben d ein Altar hat an der Chor-
wand die Figur des zweiten Kirchenpatrones, des Wendeli7i. ihre Stelle gefun-
den und zwar erscheint der Beschützer der Hirten und Heerden nicht in idealer,
sondern in realer Auffassung, nämlich im Kostüm der Entstehungszeit der Statuette,
in Rococotracht.
Glockcn Von den beiden Glocken ist die grössere der h. Jungfrau geweiht und trägt
die Umschrift: »KOMMET, LASSET UNS BETEN: IN GOTTES NAMEN
FLOSS ICH; JOHANN PETER RÄCH IN WINDECKEN GOSS MICH. 1752.
OR:P:N:B:M:V:« d. h. »ORA PRO NOB1S BEATISS1MA MARIA VIRGO,
bitte für uns, allerseligste Jungfrau Maria.« Das Mittelfeld der Glocke zeigt die
Kelieffigur der Madonna in der Auffassung als Immaculata Conceptio. Die Jungfrau
steht auf der Mondsichel; die Rechte ist auf die Brust gelegt, die Linke hält eine
Lilie. — Die kleinere Glocke ist minder reich ausgestattet und trägt die einfache
Inschrift: »GOSS MICH BENEDIKT UND JOHANN GEORG SCHNEIDEWIND
IN FRANKFURT. 1742.«
edhofkapeiie jn t]er westlich V(,m Dorfe gelegenen, architekturlosen FricdJiofkapeile zum
h. Kreuz steht auf dem Altar ein HeiligthumsscJirein von schlicht quadratischer
Grundanlage ohne alle Bekrönung und sonstige Ornamentik. Die Nische mag
ursprünglich mit einem plastischen Werk anderer Art ausgefüllt gewesen sein,
als mit den jetzt darin aufgestellten, schon ihrem Grössenverhältniss nach augen-
Statuen scheinlich nicht für den Schrein bestimmten beiden sitzenden Statuen. In schwer-
fälliger Gruppenbehandlung sind die Madonna und die Mutter Anna dargestellt.
Letztere breitet die Arme aus, um das von Maria ihr dargereichte Jesuskind zu
umfangen. Vom Haupte der h. Jungfrau fiiesst das Haar in gewellten Massen
hernieder. Die h. Anna trägt nach Matronensitte ein Schleiertuch um Kopf und
Schultern. Die Gestalten sind von zwei drittel Lebens^rösse und in Holz ausgeführt.
Eine unverstandene farbige Erneuerung hat die Figuren schwer misshandelt,
namentlich in den Gesichtszügen. Die Statuen mögen aus der Mitte des 1,5. Jahr-
hunderts stammen , erheben sich jedoch nicht über die Linie handwerksmässigen
Mittelgutes. —• Beachtenswerther , weil unberührt von entstellenden Schlimm-
Gemäide besserungen übereifriger Restaurirsucht, sind die Malereien auf den Innenseiten
der beiden Flügel des Schreines, Figuren der Apostel Petrus und Paulus von
ähnlichen Abmessungen wie die Skulpturen. Die beiden Apostelfürsten sind in
kräftigen Leimfarben auf Holz gemalt. Die Körpertheile sind mit starken Umriss-
linien umzogen und theilweise mit Schraffirung behandelt. Der h. Petrus ist aus-
gestattet mit Evangeliar und Schlüssel als Attributen seines Lehramtes und Primates.
Der h. Paulus erscheint mit dem Schwert als Zeichen seines Martyriums. In den
Köpfen waltet die traditionelle typische Auffassung der beiden Apostel, die schon
in den Katakombengemälden vorkommt und noch heute in der christlichen Kunst
üblich ist. Petrus trägt ein röthliches Gewand und einen weissen Mantel; bei
Paulus ist das Gewand grün, der Mantel dunkelroth. In den Hauptparthien