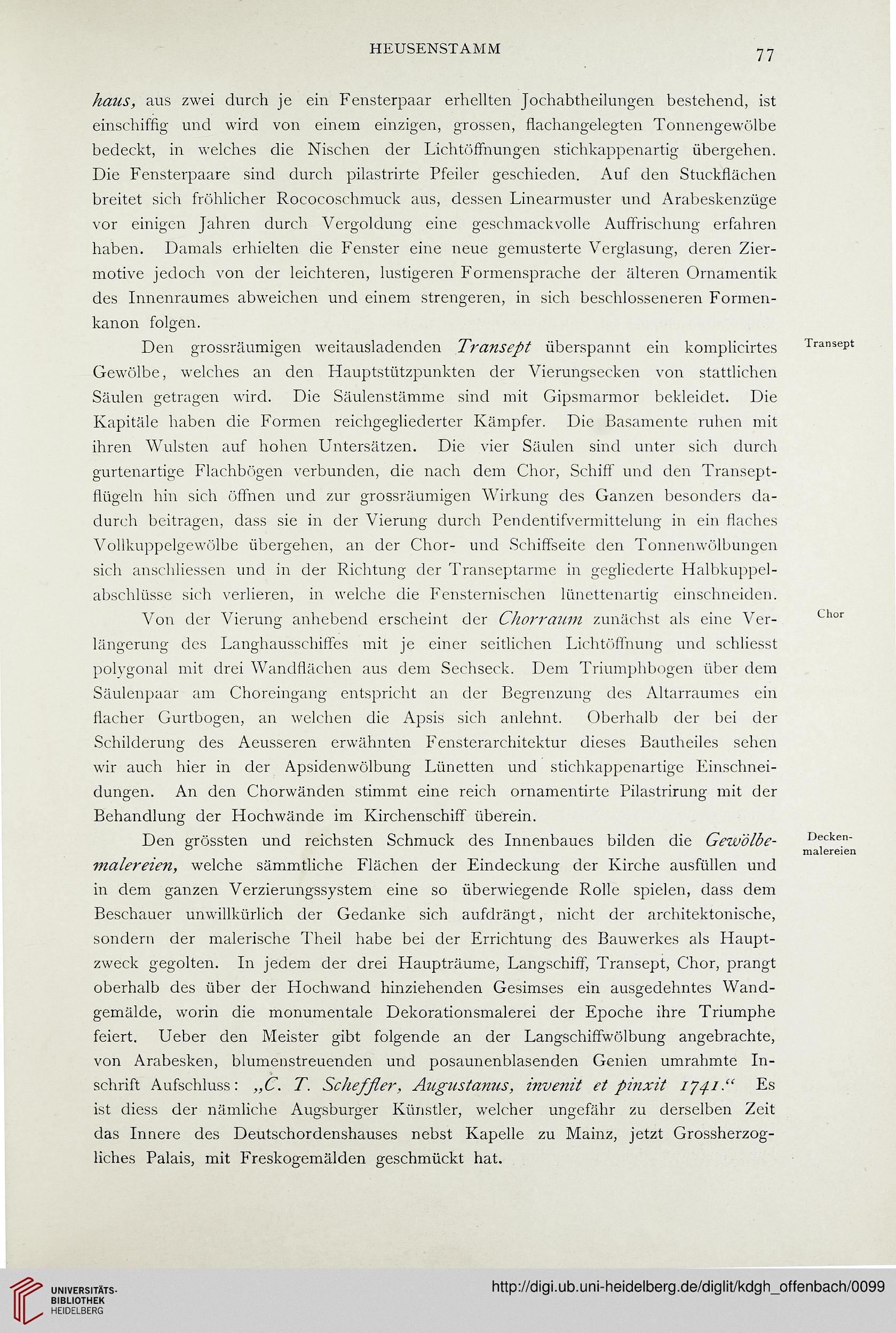HEUSENSTAMM
77
haus, aus zwei durch je ein Fensterpaar erhellten Jochabtheilungen bestehend, ist
einschiffig und wird von einem einzigen, grossen, flachangelegten Tonnengewölbe
bedeckt, in welches die Nischen der Lichtöffnungen stichkappenartig übergehen.
Die Fensterpaare sind durch pilastrirte Pfeiler geschieden. Auf den Stuckflächen
breitet sich fröhlicher Rococoschmuck aus, dessen Linearmuster und Arabeskenzüge
vor einigen Jahren durch Vergoldung eine geschmackvolle Auffrischung erfahren
haben. Damals erhielten die Fenster eine neue gemusterte Verglasung, deren Zier-
motive jedoch von der leichteren, lustigeren Formensprache der älteren Ornamentik
des Innenraumes abweichen und einem strengeren, in sich beschlosseneren Formen-
kanon folgen.
Den grossräumigen weitausladenden Transept überspannt ein komplicirtes Transept
Gewölbe, welches an den Hauptstützpunkten der Vierungsecken von stattlichen
Säulen getragen wird. Die Säulenstämme sind mit Gipsmarmor bekleidet. Die
Kapitale haben die Formen reichgegliederter Kämpfer. Die Basamente ruhen mit
ihren Wülsten auf hohen Untersätzen. Die vier Säulen sind unter sich durch
gurtenartige Flachbögen verbunden, die nach dem Chor, Schiff und den Transept-
flügeln hin sich öffnen und zur grossräumigen Wirkung des Ganzen besonders da-
durch beitragen, dass sie in der Vierung durch Pendentifvermittelung in ein flaches
Vollkuppelgewölbe übergehen, an der Chor- und Schiffseite den Tonnenwölbungen
sich anschliessen und in der Richtung der Transeptarme in gegliederte Halbkuppel-
abschlüsse sich verlieren, in welche die Fensternischen lüncttenartig einschneiden.
Von der Vierung anhebend erscheint der Chorraum zunächst als eine Ver- Chor
längerung des Langhausschiffes mit je einer seitlichen Lichtöffnung und schliesst
polygonal mit drei Wandflächen aus dem Sechseck. Dem Triumphbogen über dem
Säulenpaar am Choreingang entspricht an der Begrenzung des Altarraumcs ein
flacher Gurtbogen, an welchen die Apsis sich anlehnt. Oberhalb der bei der
Schilderuno- des Aeusseren erwähnten Fensterarchitektur dieses Bautheiles sehen
wir auch hier in der Apsidenwölbung Lünetten und stichkappenartige Einschnei-
dungen. An den Chorwänden stimmt eine reich ornamentirte Pilastrirung mit der
Behandlung der Hochwände im Kirchenschiff überein.
Den grössten und reichsten Schmuck des Innenbaues bilden die Gewölbe- Decken-
maiereien
maiereien, welche sämmtliche Flächen der Eindeckung der Kirche ausfüllen und
in dem ganzen Verzierungssystem eine so überwiegende Rolle spielen, dass dem
Beschauer unwillkürlich der Gedanke sich aufdrängt, nicht der architektonische,
sondern der malerische Theil habe bei der Errichtung des Bauwerkes als Haupt-
zweck gegolten. In jedem der drei Haupträume, Langschiff, Transept, Chor, prangt
oberhalb des über der Hochwand hinziehenden Gesimses ein ausgedehntes Wand-
gemälde, worin die monumentale Dekorationsmalerei der Epoche ihre Triumphe
feiert. Ueber den Meister gibt folgende an der Langschiffwölbung angebrachte,
von Arabesken, blumenstreuenden und posaunenblasenden Genien umrahmte In-
schrift Aufschluss: „C. T. Schefßer, Augustamis, invenit et pinxit 1.74.1."' Es
ist diess der nämliche Augsburger Künstler, welcher ungefähr zu derselben Zeit
das Innere des Deutschordenshauses nebst Kapelle zu Mainz, jetzt Grossherzog-
liches Palais, mit Freskogemälden geschmückt hat.
77
haus, aus zwei durch je ein Fensterpaar erhellten Jochabtheilungen bestehend, ist
einschiffig und wird von einem einzigen, grossen, flachangelegten Tonnengewölbe
bedeckt, in welches die Nischen der Lichtöffnungen stichkappenartig übergehen.
Die Fensterpaare sind durch pilastrirte Pfeiler geschieden. Auf den Stuckflächen
breitet sich fröhlicher Rococoschmuck aus, dessen Linearmuster und Arabeskenzüge
vor einigen Jahren durch Vergoldung eine geschmackvolle Auffrischung erfahren
haben. Damals erhielten die Fenster eine neue gemusterte Verglasung, deren Zier-
motive jedoch von der leichteren, lustigeren Formensprache der älteren Ornamentik
des Innenraumes abweichen und einem strengeren, in sich beschlosseneren Formen-
kanon folgen.
Den grossräumigen weitausladenden Transept überspannt ein komplicirtes Transept
Gewölbe, welches an den Hauptstützpunkten der Vierungsecken von stattlichen
Säulen getragen wird. Die Säulenstämme sind mit Gipsmarmor bekleidet. Die
Kapitale haben die Formen reichgegliederter Kämpfer. Die Basamente ruhen mit
ihren Wülsten auf hohen Untersätzen. Die vier Säulen sind unter sich durch
gurtenartige Flachbögen verbunden, die nach dem Chor, Schiff und den Transept-
flügeln hin sich öffnen und zur grossräumigen Wirkung des Ganzen besonders da-
durch beitragen, dass sie in der Vierung durch Pendentifvermittelung in ein flaches
Vollkuppelgewölbe übergehen, an der Chor- und Schiffseite den Tonnenwölbungen
sich anschliessen und in der Richtung der Transeptarme in gegliederte Halbkuppel-
abschlüsse sich verlieren, in welche die Fensternischen lüncttenartig einschneiden.
Von der Vierung anhebend erscheint der Chorraum zunächst als eine Ver- Chor
längerung des Langhausschiffes mit je einer seitlichen Lichtöffnung und schliesst
polygonal mit drei Wandflächen aus dem Sechseck. Dem Triumphbogen über dem
Säulenpaar am Choreingang entspricht an der Begrenzung des Altarraumcs ein
flacher Gurtbogen, an welchen die Apsis sich anlehnt. Oberhalb der bei der
Schilderuno- des Aeusseren erwähnten Fensterarchitektur dieses Bautheiles sehen
wir auch hier in der Apsidenwölbung Lünetten und stichkappenartige Einschnei-
dungen. An den Chorwänden stimmt eine reich ornamentirte Pilastrirung mit der
Behandlung der Hochwände im Kirchenschiff überein.
Den grössten und reichsten Schmuck des Innenbaues bilden die Gewölbe- Decken-
maiereien
maiereien, welche sämmtliche Flächen der Eindeckung der Kirche ausfüllen und
in dem ganzen Verzierungssystem eine so überwiegende Rolle spielen, dass dem
Beschauer unwillkürlich der Gedanke sich aufdrängt, nicht der architektonische,
sondern der malerische Theil habe bei der Errichtung des Bauwerkes als Haupt-
zweck gegolten. In jedem der drei Haupträume, Langschiff, Transept, Chor, prangt
oberhalb des über der Hochwand hinziehenden Gesimses ein ausgedehntes Wand-
gemälde, worin die monumentale Dekorationsmalerei der Epoche ihre Triumphe
feiert. Ueber den Meister gibt folgende an der Langschiffwölbung angebrachte,
von Arabesken, blumenstreuenden und posaunenblasenden Genien umrahmte In-
schrift Aufschluss: „C. T. Schefßer, Augustamis, invenit et pinxit 1.74.1."' Es
ist diess der nämliche Augsburger Künstler, welcher ungefähr zu derselben Zeit
das Innere des Deutschordenshauses nebst Kapelle zu Mainz, jetzt Grossherzog-
liches Palais, mit Freskogemälden geschmückt hat.