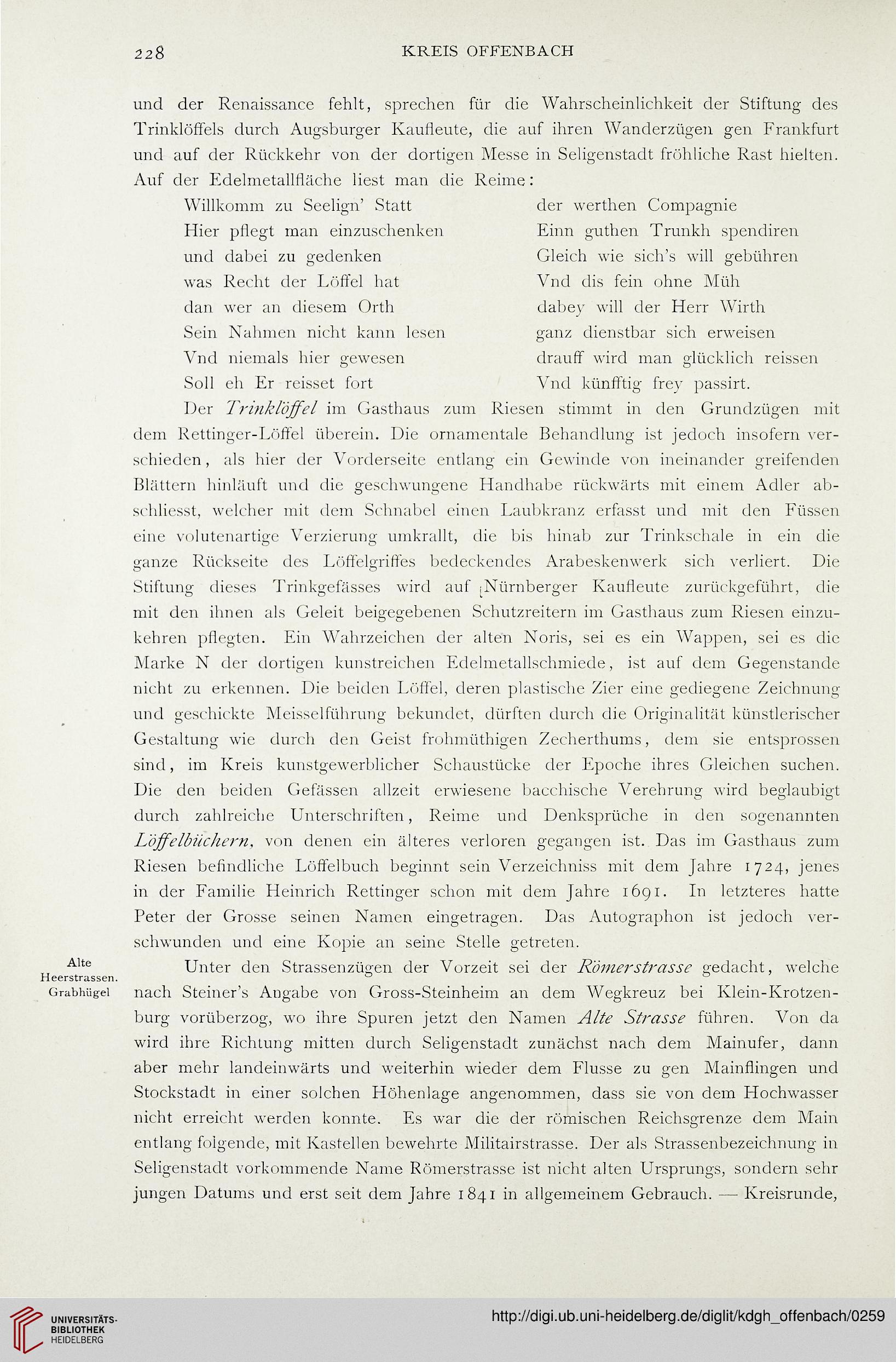22%
KREIS OFFENBACH
Alte
Heerstrassen
und der Renaissance fehlt, sprechen für die Wahrscheinlichkeit der Stiftung des
Trinklöffels durch Augsburger Kaufleute, die auf ihren Wanderzügen gen Frankfurt
und auf der Rückkehr von der dortigen Messe in Seligenstadt fröhliche Rast hielten.
Auf der Edelmetallfläche liest man die Reime:
Willkomm zu Seelign' Statt der werthen Compagnie
Hier pflegt man einzuschenken Einn guthen Trunkh spendiren
und dabei zu gedenken Gleich wie sich's will gebühren
was Recht der Löffel hat Vnd dis fein ohne Müh
dan wer an diesem Orth dabev will der Herr Wirth
Sein Nahmen nicht kann lesen ganz dienstbar sich erweisen
Vnd niemals hier gewesen drauff wird man glücklich reissen
Soll eh Er reisset fort Vnd künfftig frey passirt.
Der Trinklöffel im Gasthaus zum Riesen stimmt in den Grundzügen mit
dem Rettinger-Löffel überein. Die ornamentale Behandlung ist jedoch insofern ver-
schieden , als hier der Vorderseite entlang ein Gewinde von ineinander greifenden
Blättern hinläuft und die o-eschwuncrene Handhabe rückwärts mit einem Adler ab-
o o
schliesst, welcher mit dem Schnabel einen Laubkranz erfasst und mit den Füssen
eine volutenartige Verzierung umkrallt, die bis hinab zur Trinkschale in ein die
ganze Rückseite des Löffeltrriffes bedeckendes Arabeskenwerk sich verliert. Die
Stiftung dieses Trinkgefässes wird auf Nürnberger Kaufieute zurückgeführt, die
mit den ihnen als Geleit beigegebenen Schutzreitern im Gasthaus zum Riesen einzu-
kehren pflegten. Ein Wahrzeichen der alten Noris, sei es ein Wappen, sei es die
Marke N der dortigen kunstreichen Edelmetallschmiede, ist auf dem Gegenstände
nicht zu erkennen. Die beiden Löffel, deren plastische Zier eine gediegene Zeichnung
und geschickte Meisselführung bekundet, dürften durch die Originalität künstlerischer
Gestaltung wie durch den Geist frohmüthigen Zecherthums, dem sie entsprossen
sind, im Kreis kunstgewerblicher Schaustücke der Epoche ihres Gleichen suchen.
Die den beiden Gefässen allzeit erwiesene bacchische Verehrung wird beglaubigt
durch zahlreiche Unterschriften, Reime und Denksprüche in den sogenannten
Löjfclbücliern, von denen ein älteres verloren gegangen ist. Das im Gasthaus zum
Riesen befindliche Löffelbuch beginnt sein Verzeichniss mit dem [ahre 1724, jenes
in der Familie Heinrich Rettinger schon mit dem Jahre 1691. In letzteres hatte
Peter der Grosse seinen Namen eingetragen. Das Autographon ist jedoch ver-
schwunden und eine Kopie an seine Stelle getreten.
Unter den Strassenzügen der Vorzeit sei der Römerstrasse gedacht, welche
Grabhügel nach Steiuer's Angabe von Gross-Steinheim an dem Wegkreuz bei Klein-Krotzen-
burg vorüberzog, wo ihre Spuren jetzt den Namen Alte Strasse führen. Von da
wird ihre Richtung mitten durch Seligenstadt zunächst nach dem Mainufer, dann
aber mehr landeinwärts und weiterhin wieder dem Flusse zu gen Mainflingen und
Stockstadt in einer solchen Höhenlage angenommen, dass sie von dem Hochwasser
nicht erreicht werden konnte. Es war die der römischen Reichsgrenze dem Main
entlang folgende, mit Kastellen bewehrte Militairstrasse. Der als Strassenbezeichnung in
Seligenstadt vorkommende Name Römerstrasse ist nicht alten Ursprungs, sondern sehr
jungen Datums und erst seit dem Jahre 1841 in allgemeinem Gebrauch. — Kreisrunde,
KREIS OFFENBACH
Alte
Heerstrassen
und der Renaissance fehlt, sprechen für die Wahrscheinlichkeit der Stiftung des
Trinklöffels durch Augsburger Kaufleute, die auf ihren Wanderzügen gen Frankfurt
und auf der Rückkehr von der dortigen Messe in Seligenstadt fröhliche Rast hielten.
Auf der Edelmetallfläche liest man die Reime:
Willkomm zu Seelign' Statt der werthen Compagnie
Hier pflegt man einzuschenken Einn guthen Trunkh spendiren
und dabei zu gedenken Gleich wie sich's will gebühren
was Recht der Löffel hat Vnd dis fein ohne Müh
dan wer an diesem Orth dabev will der Herr Wirth
Sein Nahmen nicht kann lesen ganz dienstbar sich erweisen
Vnd niemals hier gewesen drauff wird man glücklich reissen
Soll eh Er reisset fort Vnd künfftig frey passirt.
Der Trinklöffel im Gasthaus zum Riesen stimmt in den Grundzügen mit
dem Rettinger-Löffel überein. Die ornamentale Behandlung ist jedoch insofern ver-
schieden , als hier der Vorderseite entlang ein Gewinde von ineinander greifenden
Blättern hinläuft und die o-eschwuncrene Handhabe rückwärts mit einem Adler ab-
o o
schliesst, welcher mit dem Schnabel einen Laubkranz erfasst und mit den Füssen
eine volutenartige Verzierung umkrallt, die bis hinab zur Trinkschale in ein die
ganze Rückseite des Löffeltrriffes bedeckendes Arabeskenwerk sich verliert. Die
Stiftung dieses Trinkgefässes wird auf Nürnberger Kaufieute zurückgeführt, die
mit den ihnen als Geleit beigegebenen Schutzreitern im Gasthaus zum Riesen einzu-
kehren pflegten. Ein Wahrzeichen der alten Noris, sei es ein Wappen, sei es die
Marke N der dortigen kunstreichen Edelmetallschmiede, ist auf dem Gegenstände
nicht zu erkennen. Die beiden Löffel, deren plastische Zier eine gediegene Zeichnung
und geschickte Meisselführung bekundet, dürften durch die Originalität künstlerischer
Gestaltung wie durch den Geist frohmüthigen Zecherthums, dem sie entsprossen
sind, im Kreis kunstgewerblicher Schaustücke der Epoche ihres Gleichen suchen.
Die den beiden Gefässen allzeit erwiesene bacchische Verehrung wird beglaubigt
durch zahlreiche Unterschriften, Reime und Denksprüche in den sogenannten
Löjfclbücliern, von denen ein älteres verloren gegangen ist. Das im Gasthaus zum
Riesen befindliche Löffelbuch beginnt sein Verzeichniss mit dem [ahre 1724, jenes
in der Familie Heinrich Rettinger schon mit dem Jahre 1691. In letzteres hatte
Peter der Grosse seinen Namen eingetragen. Das Autographon ist jedoch ver-
schwunden und eine Kopie an seine Stelle getreten.
Unter den Strassenzügen der Vorzeit sei der Römerstrasse gedacht, welche
Grabhügel nach Steiuer's Angabe von Gross-Steinheim an dem Wegkreuz bei Klein-Krotzen-
burg vorüberzog, wo ihre Spuren jetzt den Namen Alte Strasse führen. Von da
wird ihre Richtung mitten durch Seligenstadt zunächst nach dem Mainufer, dann
aber mehr landeinwärts und weiterhin wieder dem Flusse zu gen Mainflingen und
Stockstadt in einer solchen Höhenlage angenommen, dass sie von dem Hochwasser
nicht erreicht werden konnte. Es war die der römischen Reichsgrenze dem Main
entlang folgende, mit Kastellen bewehrte Militairstrasse. Der als Strassenbezeichnung in
Seligenstadt vorkommende Name Römerstrasse ist nicht alten Ursprungs, sondern sehr
jungen Datums und erst seit dem Jahre 1841 in allgemeinem Gebrauch. — Kreisrunde,