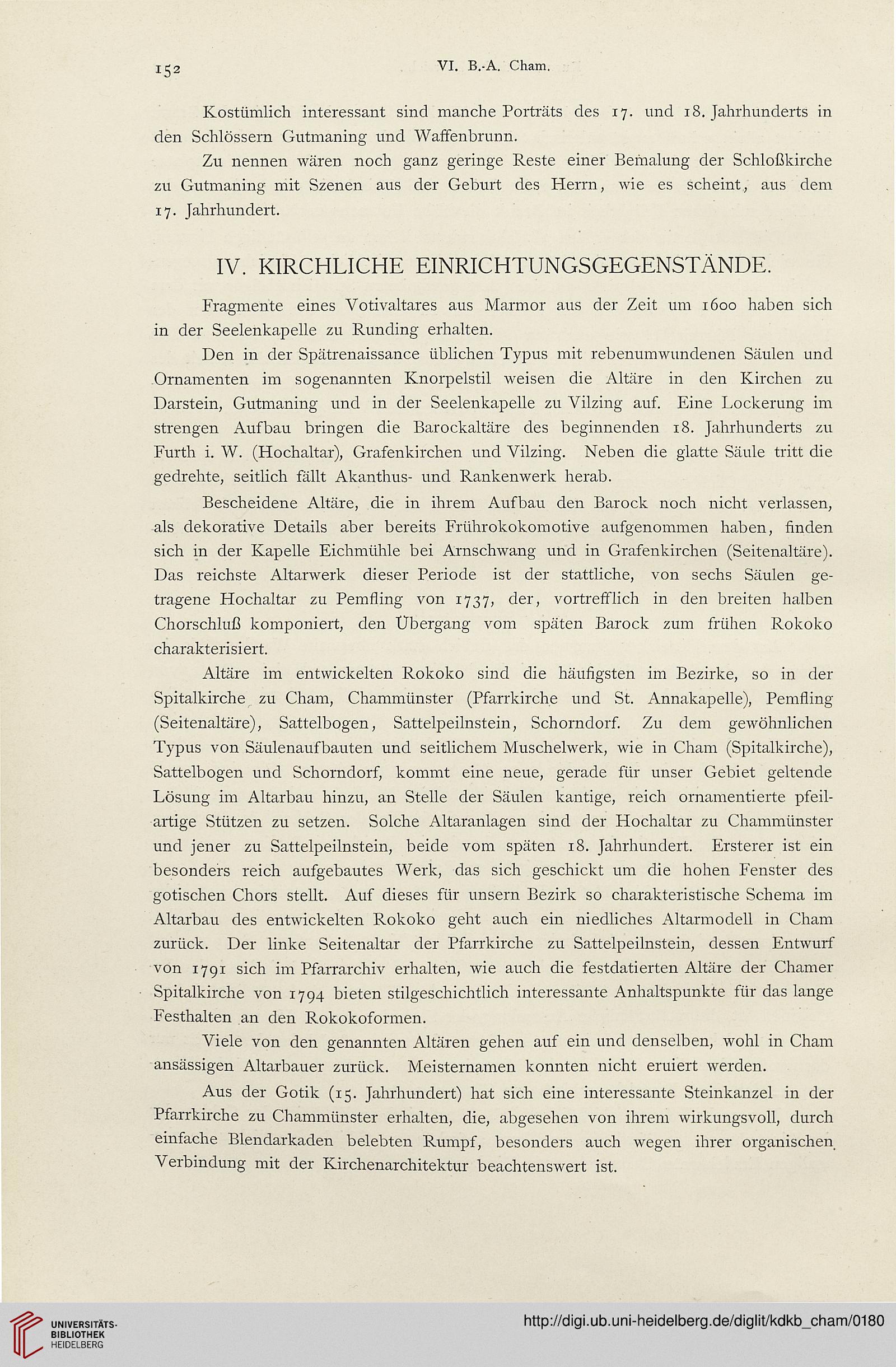152
VI. B.-A. Cham.
Kostümlich interessant sind manche Porträts des 17. und 18. Jahrhunderts in
den Schlössern Gutmaning und Waffenbrunn.
Zu nennen wären noch ganz geringe Reste einer Bemalung der Schloßkirche
zu Gutmaning mit Szenen aus der Geburt des Herrn, wie es scheint, aus dem
17. Jahrhundert.
IV. KIRCHLICHE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE.
Fragmente eines Votivaltares aus Marmor aus der Zeit um 1600 haben sich
in der Seelenkapelle zu Runding erhalten.
Den in der Spätrenaissance üblichen Typus mit rebenumwundenen Säulen und
Ornamenten im sogenannten Knorpelstil weisen die Altäre in den Kirchen zu
Darstein, Gutmaning und in der Seelenkapelle zu Vilzing auf. Eine Lockerung im
strengen Aufbau bringen die Barockaltäre des beginnenden 18. Jahrhunderts zu
Furth i. W. (Hochaltar), Grafenkirchen und Vilzing. Neben die glatte Säule tritt die
gedrehte, seitlich fällt Akanthus- und Ranken werk herab.
Bescheidene Altäre, die in ihrem Aufbau den Barock noch nicht verlassen,
als dekorative Details aber bereits Frührokokomotive aufgenommen haben, finden
sich in der Kapelle Eichmühle bei Arnschwang und in Grafenkirchen (Seitenaltäre).
Das reichste Altarwerk dieser Periode ist der stattliche, von sechs Säulen ge-
tragene Hochaltar zu Pemfling von 1737, der, vortrefflich in den breiten halben
Chorschluß komponiert, den Übergang vom späten Barock zum frühen Rokoko
charakterisiert.
Altäre im entwickelten Rokoko sind die häufigsten im Bezirke, so in der
Spitalkirche zu Cham, Chammünster (Pfarrkirche und St. Annakapelle), Pemfling
(Seitenaltäre), Sattelbogen, Sattelpeilnstein, Schorndorf. Zu dem gewöhnlichen
Typus von Säulenaufbauten und seitlichem Muschelwerk, wie in Cham (Spitalkirche),
Sattelbogen und Schorndorf, kommt eine neue, gerade für unser Gebiet geltende
Lösung im Altarbau hinzu, an Stelle der Säulen kantige, reich ornamentierte pfeil-
artige Stützen zu setzen. Solche Altaranlagen sind der Hochaltar zu Chammünster
und jener zu Sattelpeilnstein, beide vom späten 18. Jahrhundert. Ersterer ist ein
besonders reich aufgebautes Werk, das sich geschickt um die hohen Fenster des
gotischen Chors stellt. Auf dieses für unsern Bezirk so charakteristische Schema im
Altarbau des entwickelten Rokoko geht auch ein niedliches Altarmodell in Cham
zurück. Der linke Seitenaltar der Pfarrkirche zu Sattelpeilnstein, dessen Entwurf
von 1791 sich im Pfarrarchiv erhalten, wie auch die festdatierten Altäre der Chamer
Spitalkirche von 1794 bieten stilgeschichtlich interessante Anhaltspunkte für das lange
Festhalten an den Rokokoformen.
Viele von den genannten Altären gehen auf ein und denselben, wohl in Cham
ansässigen Altarbauer zurück. Meisternamen konnten nicht eruiert werden.
Aus der Gotik (ig. Jahrhundert) hat sich eine interessante Steinkanzel in der
Pfarrkirche zu Chammünster erhalten, die, abgesehen von ihrem wirkungsvoll, durch
einfache Blendarkaden belebten Rumpf, besonders auch wegen ihrer organischen
Verbindung mit der Kirchenarchitektur beachtenswert ist.
VI. B.-A. Cham.
Kostümlich interessant sind manche Porträts des 17. und 18. Jahrhunderts in
den Schlössern Gutmaning und Waffenbrunn.
Zu nennen wären noch ganz geringe Reste einer Bemalung der Schloßkirche
zu Gutmaning mit Szenen aus der Geburt des Herrn, wie es scheint, aus dem
17. Jahrhundert.
IV. KIRCHLICHE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE.
Fragmente eines Votivaltares aus Marmor aus der Zeit um 1600 haben sich
in der Seelenkapelle zu Runding erhalten.
Den in der Spätrenaissance üblichen Typus mit rebenumwundenen Säulen und
Ornamenten im sogenannten Knorpelstil weisen die Altäre in den Kirchen zu
Darstein, Gutmaning und in der Seelenkapelle zu Vilzing auf. Eine Lockerung im
strengen Aufbau bringen die Barockaltäre des beginnenden 18. Jahrhunderts zu
Furth i. W. (Hochaltar), Grafenkirchen und Vilzing. Neben die glatte Säule tritt die
gedrehte, seitlich fällt Akanthus- und Ranken werk herab.
Bescheidene Altäre, die in ihrem Aufbau den Barock noch nicht verlassen,
als dekorative Details aber bereits Frührokokomotive aufgenommen haben, finden
sich in der Kapelle Eichmühle bei Arnschwang und in Grafenkirchen (Seitenaltäre).
Das reichste Altarwerk dieser Periode ist der stattliche, von sechs Säulen ge-
tragene Hochaltar zu Pemfling von 1737, der, vortrefflich in den breiten halben
Chorschluß komponiert, den Übergang vom späten Barock zum frühen Rokoko
charakterisiert.
Altäre im entwickelten Rokoko sind die häufigsten im Bezirke, so in der
Spitalkirche zu Cham, Chammünster (Pfarrkirche und St. Annakapelle), Pemfling
(Seitenaltäre), Sattelbogen, Sattelpeilnstein, Schorndorf. Zu dem gewöhnlichen
Typus von Säulenaufbauten und seitlichem Muschelwerk, wie in Cham (Spitalkirche),
Sattelbogen und Schorndorf, kommt eine neue, gerade für unser Gebiet geltende
Lösung im Altarbau hinzu, an Stelle der Säulen kantige, reich ornamentierte pfeil-
artige Stützen zu setzen. Solche Altaranlagen sind der Hochaltar zu Chammünster
und jener zu Sattelpeilnstein, beide vom späten 18. Jahrhundert. Ersterer ist ein
besonders reich aufgebautes Werk, das sich geschickt um die hohen Fenster des
gotischen Chors stellt. Auf dieses für unsern Bezirk so charakteristische Schema im
Altarbau des entwickelten Rokoko geht auch ein niedliches Altarmodell in Cham
zurück. Der linke Seitenaltar der Pfarrkirche zu Sattelpeilnstein, dessen Entwurf
von 1791 sich im Pfarrarchiv erhalten, wie auch die festdatierten Altäre der Chamer
Spitalkirche von 1794 bieten stilgeschichtlich interessante Anhaltspunkte für das lange
Festhalten an den Rokokoformen.
Viele von den genannten Altären gehen auf ein und denselben, wohl in Cham
ansässigen Altarbauer zurück. Meisternamen konnten nicht eruiert werden.
Aus der Gotik (ig. Jahrhundert) hat sich eine interessante Steinkanzel in der
Pfarrkirche zu Chammünster erhalten, die, abgesehen von ihrem wirkungsvoll, durch
einfache Blendarkaden belebten Rumpf, besonders auch wegen ihrer organischen
Verbindung mit der Kirchenarchitektur beachtenswert ist.