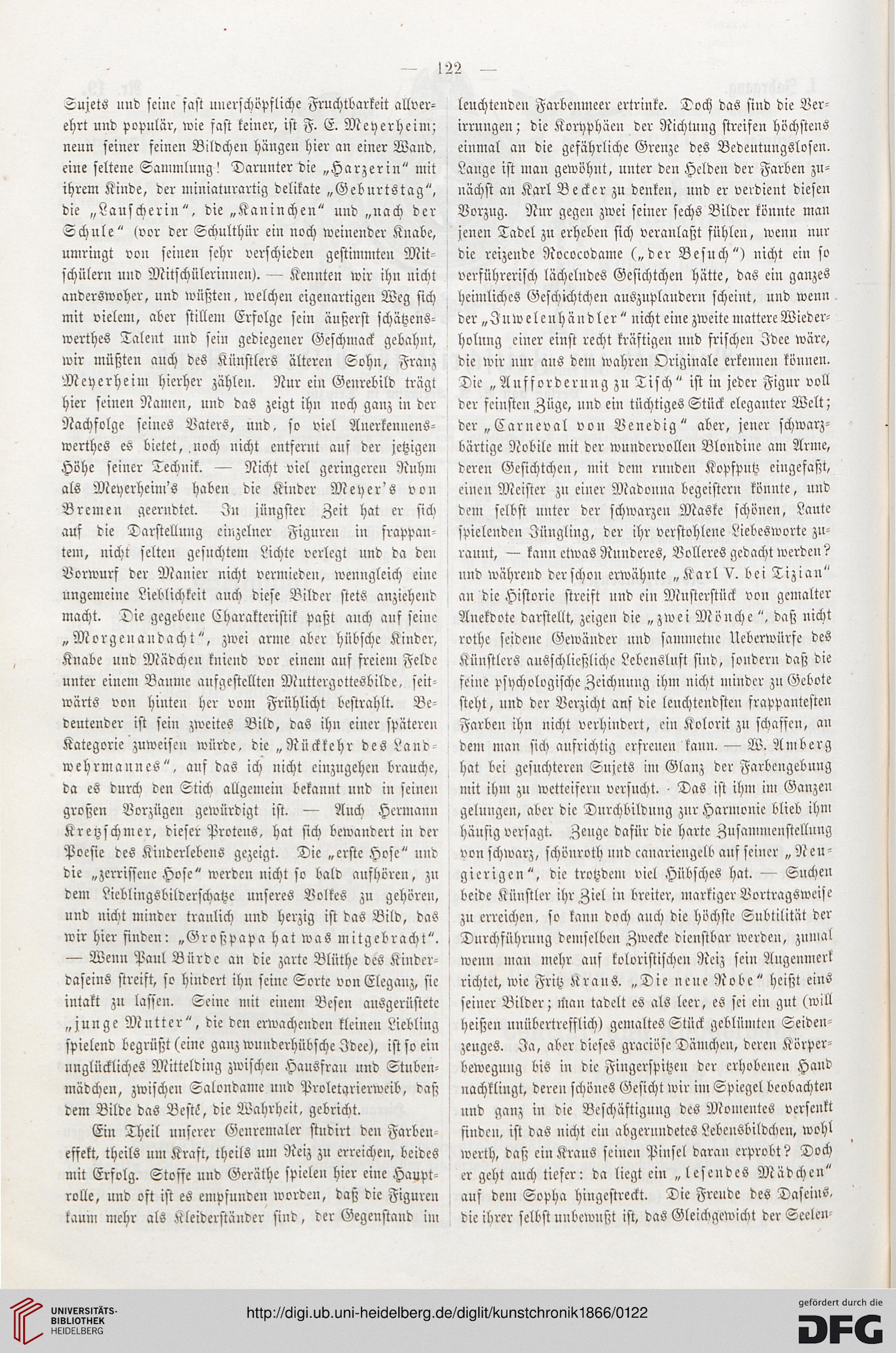Sujets und seine fast uuerschöpfliche Fruchtbarkeit allver-
ehrt und populär, wie sast keiner, ist F. E. Meyerheiui;
neun seiner feinen Bildchen hängen hier an einer Wand,
eine seltene Sammlung! Darunter die „Harzerin" mit
ihrem Kinde, der miniaturartig delikate „Geburtstag",
die „Lauscherin", die „Kaninchen" und „nach der
Schule" (vor der Schulthür ein noch weinender Knabe,
umringt von seinen sehr verschieden gestimmten Mit-
schülern und Mitschülerinnen). — Kennten wir ihn nicht
anderswoher, und wüßten, welchen eigenartigen Weg sich
mit vielem, aber stillem Erfolge sein äußerst schätzens-
werthes Talent und sein gediegener Geschmack gebahnt,
wir müßten auch des Künstlers ältereu Sohn, Franz
Meyerheim hierher zählen. Nur ein Genrebild trägt
hier seinen Namen, und das zeigt ihn noch ganz in der
Nachfolge seines Vaters, und, so viel Anerkennens-
werthes es bietet, ,noch nicht entfernt auf der jetzigen
Höhe seiner Technik. — Nicht viel geringeren Ruhm
als Meyerheim's haben die Kinder Meyer's von
Bremen geerndtet. Jn jüngster Zeit hat er sich
auf die Darstellung einzelner Figuren in frappan- ^
tem, nicht selten gesuchtem Lichte verlegt und da den
Borwurf der Manier nicht vermieden, wenngleich eine !
ungemeine Lieblichkeit anch diese Bilder stets anziehend
macht. Die gegebene Charakteristik paßt anch auf seinc
„ Morgenandacht", zwei arme aber hübsche Kinder,
Knabe und Mädchen kniend vor einem auf freiem Felde
unter einem Baume aufgestellten Muttergottesbilde, seit-
wärts von hinten her vom Frühlicht bestrahlt. Be-
beutender ist sein zwcites Bild, das ihn einer späteren
Kategorie zuweisen würdc, die „Rückkehr des Land-
wehrmannes", auf das ich nicht einzugehen brauche,
da es durch den Stich allgemein bekannt und in seinen
großen Vorzügen gewürdigt ist. — Auch Hermann
Kretzschmer, dieser Proteus, hat sich bewandert in der
Poesie des Kinderlebens gezeigt. Die „erste Hosc" und
die „zerrissene Hose" werden nicht so bald aufhören, zn
dem Lieblingsbilderschatze unseres Volkes zu gehören,
und nicht minder tranlich und herzig ist das Bild, das
wir hier finden: „Großpapa hat was mitgebracht". ,
— Wenn Paul Bürdc an die zarte Blüthe des Kinder-
daseins streift, so hindert ihn seinc Sorte von Elegauz, sie
intakt zu lassen. Seine mit einem Besen ansgerüstete
„junge Mntter", die den erwachenden kleinen Liebling
spielend begrüßt seine ganz wunderhübsche Jdee), ist so ein
unglückliches Mittelding zwischen Hausfrau und Stuben-
mädchen, zwischen Salondame und Proletarierweib, daß
dem Bilde das Bestö, die Wahrheit, gebricht.
Ein Theil unscrer Genremaler stndirt den Farben-
effekt, theils um Kraft, theils um Reiz zn crreicheu, beides
mit Erfolg. Stofse und Geräthe spielen hier eine Haupt-
rolle, und oft ist es empfunden worden, daß die Figuren
kaum mehr als Kleiderständer sind, der Gegenstand im
leuchtenden Farbenmeer ertrinke. Doch das sind die Ver-
irrungen; die Koryphäen der Richtung streifen höchstens
einmal an die gefährliche Grenze des Bedeutungslosen.
Lange ist man gewöhnt, unter den Helden der Farben zu-
nächst an Karl Becker zu denken, und er verdient diesen
Vorzug. Nur gegen zwei seiner sechs Bilder könnte man
jenen Tadel zu erheben sich veranlaßt fühlen, wenn nur
die reizende Rococodame („der Besuch") nicht ein so
verführerisch lächelndes Gesichtchen hätte, das ein ganzes
heimliches Geschichtchen auszuplaudern scheint, und wenn
der „Juwelenhändler " nicht eine zweite mattereWieder-
holnng einer einst recht kräftigen und frischen Jdee wäre,
die wir nur aus dem wahren Originale erkennen können.
Die „ Aufforderung zu Tisch" ist in jeder Figur voll
der feinsten Züge, und ein tüchtiges Stück eleganter Welt;
der„Carneval von Venedig" aber, jener schwarz-
bärtige Nobile mit der wundervollen Blondine am Arme,
deren Gesichtchen, mit dem runden Kopfputz eingefaßt,
einen Meister zn einer Madonna begeistern könnte, und
dem selbst unter der schwarzen Maske schönen, Laute
spielenden Iüngling, der ihr verstohlene Liebesworte zu-
raunt, — kann etwas Runderes, Volleres gedacht werden?
und während derschon erwähnte „Karl V. bei Tizian"
an die Historie streift und ein Musterstück von gemalter
Anekdote darstellt, zeigen dic „zwci Mönche ", daß nicht
rvthe seidene Gewänder und sammetue Ueberwürfe des
Künstlcrs ausschließlichc Lcbensluft sind, sondern daß die
feine psychologische Zeichnung ihm nicht mindcr zu Gebote
steht, und der Vcrzicht anf die lcnchtendsteu frappantesten
Farben ihn nicht verhindert, cin Kolorit zu schaffen, an
dem man sich aufrichtig crfreuen kaun. — W. Amberg
hat bei gesuchteren Sujets im Glanz der Farbengebung
mit ihm zu wetteiferu versncht. - Das ist ihm im Ganzen
gelungen, aber die Durchbildung znr Harmonie blieb ihni
häufig versagt. Zeuge dafür die harte Zusammcnstcllung
von schwarz, schönroth nnd canaricngelb anf scincr „ Neu-
gierigen", die trotzdem vicl Hübsches hat. — Suchen
beide Künstler ihr Ziel in breiter, markigerVortragsweise
zu erreichen, so kann doch auch die höchste Subtilität der
Durchführuug demselben Zweckc dienstbar wcrdcn, znmal
wenn man mehr auf koloristischcn Reiz sein Augenmerk
richtct, wie Fritz Kraus. „Die nene Nobe" heißt eins
seiner Bilder; ckan tadclt es als leer, es sei ein gut (will
heißen nnübertrefflich) gcmaltes Stück geblümtcn Seiden-
zeuges. Ja, aber dieses graciöse Dämchen, deren Körper-
bewcguug bis in die Fingerspitzen der erhobenen Haud
nachklingt, deren schönes Gesicht wir im Spiegel Leobachten
nnd ganz in die Beschäftigung des Momeutes versenkt
findeu, ist das nicht ein abgernudetcs Lebensbildchen, wohl
werth, daß ein Kraus seinen Pinsel daran erprobt? Doch
er geht anch tiefer: da liegt ein „lesendes Mädchen"
auf dem Sopha hingestreckt. Die Freude des Daseins,
die ihrer selbst unbcwnßt ist, das Gleichgewickit der Seelcn
ehrt und populär, wie sast keiner, ist F. E. Meyerheiui;
neun seiner feinen Bildchen hängen hier an einer Wand,
eine seltene Sammlung! Darunter die „Harzerin" mit
ihrem Kinde, der miniaturartig delikate „Geburtstag",
die „Lauscherin", die „Kaninchen" und „nach der
Schule" (vor der Schulthür ein noch weinender Knabe,
umringt von seinen sehr verschieden gestimmten Mit-
schülern und Mitschülerinnen). — Kennten wir ihn nicht
anderswoher, und wüßten, welchen eigenartigen Weg sich
mit vielem, aber stillem Erfolge sein äußerst schätzens-
werthes Talent und sein gediegener Geschmack gebahnt,
wir müßten auch des Künstlers ältereu Sohn, Franz
Meyerheim hierher zählen. Nur ein Genrebild trägt
hier seinen Namen, und das zeigt ihn noch ganz in der
Nachfolge seines Vaters, und, so viel Anerkennens-
werthes es bietet, ,noch nicht entfernt auf der jetzigen
Höhe seiner Technik. — Nicht viel geringeren Ruhm
als Meyerheim's haben die Kinder Meyer's von
Bremen geerndtet. Jn jüngster Zeit hat er sich
auf die Darstellung einzelner Figuren in frappan- ^
tem, nicht selten gesuchtem Lichte verlegt und da den
Borwurf der Manier nicht vermieden, wenngleich eine !
ungemeine Lieblichkeit anch diese Bilder stets anziehend
macht. Die gegebene Charakteristik paßt anch auf seinc
„ Morgenandacht", zwei arme aber hübsche Kinder,
Knabe und Mädchen kniend vor einem auf freiem Felde
unter einem Baume aufgestellten Muttergottesbilde, seit-
wärts von hinten her vom Frühlicht bestrahlt. Be-
beutender ist sein zwcites Bild, das ihn einer späteren
Kategorie zuweisen würdc, die „Rückkehr des Land-
wehrmannes", auf das ich nicht einzugehen brauche,
da es durch den Stich allgemein bekannt und in seinen
großen Vorzügen gewürdigt ist. — Auch Hermann
Kretzschmer, dieser Proteus, hat sich bewandert in der
Poesie des Kinderlebens gezeigt. Die „erste Hosc" und
die „zerrissene Hose" werden nicht so bald aufhören, zn
dem Lieblingsbilderschatze unseres Volkes zu gehören,
und nicht minder tranlich und herzig ist das Bild, das
wir hier finden: „Großpapa hat was mitgebracht". ,
— Wenn Paul Bürdc an die zarte Blüthe des Kinder-
daseins streift, so hindert ihn seinc Sorte von Elegauz, sie
intakt zu lassen. Seine mit einem Besen ansgerüstete
„junge Mntter", die den erwachenden kleinen Liebling
spielend begrüßt seine ganz wunderhübsche Jdee), ist so ein
unglückliches Mittelding zwischen Hausfrau und Stuben-
mädchen, zwischen Salondame und Proletarierweib, daß
dem Bilde das Bestö, die Wahrheit, gebricht.
Ein Theil unscrer Genremaler stndirt den Farben-
effekt, theils um Kraft, theils um Reiz zn crreicheu, beides
mit Erfolg. Stofse und Geräthe spielen hier eine Haupt-
rolle, und oft ist es empfunden worden, daß die Figuren
kaum mehr als Kleiderständer sind, der Gegenstand im
leuchtenden Farbenmeer ertrinke. Doch das sind die Ver-
irrungen; die Koryphäen der Richtung streifen höchstens
einmal an die gefährliche Grenze des Bedeutungslosen.
Lange ist man gewöhnt, unter den Helden der Farben zu-
nächst an Karl Becker zu denken, und er verdient diesen
Vorzug. Nur gegen zwei seiner sechs Bilder könnte man
jenen Tadel zu erheben sich veranlaßt fühlen, wenn nur
die reizende Rococodame („der Besuch") nicht ein so
verführerisch lächelndes Gesichtchen hätte, das ein ganzes
heimliches Geschichtchen auszuplaudern scheint, und wenn
der „Juwelenhändler " nicht eine zweite mattereWieder-
holnng einer einst recht kräftigen und frischen Jdee wäre,
die wir nur aus dem wahren Originale erkennen können.
Die „ Aufforderung zu Tisch" ist in jeder Figur voll
der feinsten Züge, und ein tüchtiges Stück eleganter Welt;
der„Carneval von Venedig" aber, jener schwarz-
bärtige Nobile mit der wundervollen Blondine am Arme,
deren Gesichtchen, mit dem runden Kopfputz eingefaßt,
einen Meister zn einer Madonna begeistern könnte, und
dem selbst unter der schwarzen Maske schönen, Laute
spielenden Iüngling, der ihr verstohlene Liebesworte zu-
raunt, — kann etwas Runderes, Volleres gedacht werden?
und während derschon erwähnte „Karl V. bei Tizian"
an die Historie streift und ein Musterstück von gemalter
Anekdote darstellt, zeigen dic „zwci Mönche ", daß nicht
rvthe seidene Gewänder und sammetue Ueberwürfe des
Künstlcrs ausschließlichc Lcbensluft sind, sondern daß die
feine psychologische Zeichnung ihm nicht mindcr zu Gebote
steht, und der Vcrzicht anf die lcnchtendsteu frappantesten
Farben ihn nicht verhindert, cin Kolorit zu schaffen, an
dem man sich aufrichtig crfreuen kaun. — W. Amberg
hat bei gesuchteren Sujets im Glanz der Farbengebung
mit ihm zu wetteiferu versncht. - Das ist ihm im Ganzen
gelungen, aber die Durchbildung znr Harmonie blieb ihni
häufig versagt. Zeuge dafür die harte Zusammcnstcllung
von schwarz, schönroth nnd canaricngelb anf scincr „ Neu-
gierigen", die trotzdem vicl Hübsches hat. — Suchen
beide Künstler ihr Ziel in breiter, markigerVortragsweise
zu erreichen, so kann doch auch die höchste Subtilität der
Durchführuug demselben Zweckc dienstbar wcrdcn, znmal
wenn man mehr auf koloristischcn Reiz sein Augenmerk
richtct, wie Fritz Kraus. „Die nene Nobe" heißt eins
seiner Bilder; ckan tadclt es als leer, es sei ein gut (will
heißen nnübertrefflich) gcmaltes Stück geblümtcn Seiden-
zeuges. Ja, aber dieses graciöse Dämchen, deren Körper-
bewcguug bis in die Fingerspitzen der erhobenen Haud
nachklingt, deren schönes Gesicht wir im Spiegel Leobachten
nnd ganz in die Beschäftigung des Momeutes versenkt
findeu, ist das nicht ein abgernudetcs Lebensbildchen, wohl
werth, daß ein Kraus seinen Pinsel daran erprobt? Doch
er geht anch tiefer: da liegt ein „lesendes Mädchen"
auf dem Sopha hingestreckt. Die Freude des Daseins,
die ihrer selbst unbcwnßt ist, das Gleichgewickit der Seelcn