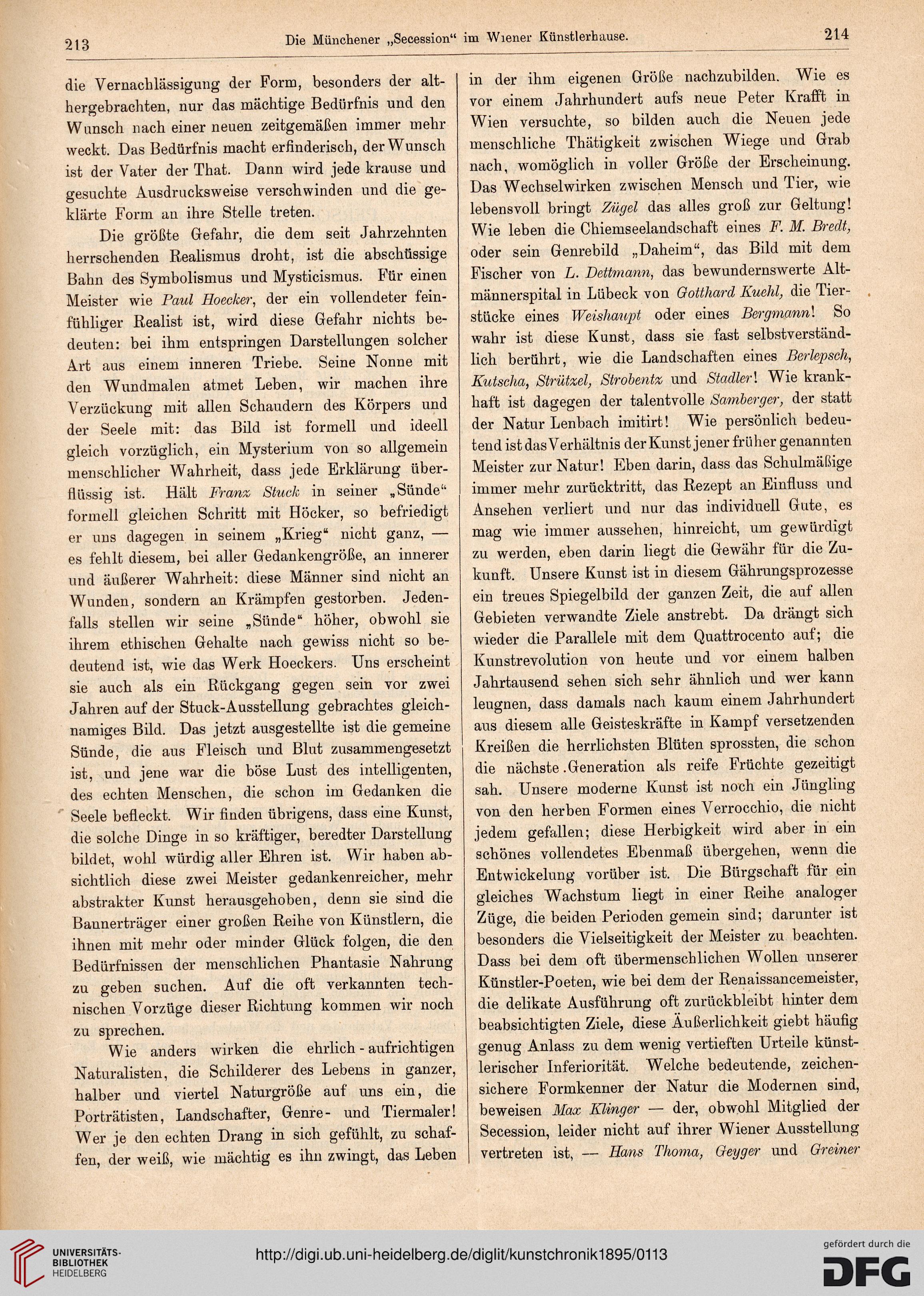213
Die Münchener „Seeession"
im Wiener Künstlerhuuse.
214
die Vernachlässigung der Form, besonders der alt-
hergebrachten, nur das mächtige Bedürfnis und den
Wunsch nach einer neuen zeitgemäßen immer mehr
weckt. Das Bedürfnis macht erfinderisch, der Wunsch
ist der Vater der That. Dann wird jede krause und
gesuchte Ausdrucksweise verschwinden und die ge-
klärte Form an ihre Stelle treten.
Die größte Gefahr, die dem seit Jahrzehnten
herrschenden Realismus droht, ist die abschüssige
Bahn des Symbolismus und Mysticismus. Für einen
Meister wie Paul Hoecker, der ein vollendeter fein-
fühliger Realist ist, wird diese Gefahr nichts be-
deuten: bei ihm entspringen Darstellungen solcher
Art aus einem inneren Triebe. Seine Nonne mit
den Wundmalen atmet Leben, wir machen ihre
Verzückung mit allen Schaudern des Körpers und
der Seele mit: das Bild ist formell und ideell
gleich vorzüglich, ein Mysterium von so allgemein
menschlicher Wahrheit, dass jede Erklärung über-
flüssig ist. Hält Franz Stuck in seiner „Sünde"
formell gleichen Schritt mit Höcker, so befriedigt
er uns dagegen in seinem „Krieg" nicht ganz, —
es fehlt diesem, bei aller Gedankengröße, an innerer
und äußerer Wahrheit: diese Männer sind nicht an
Wunden, sondern an Krämpfen gestorben. Jeden-
falls stellen wir seine „Sünde" höher, obwohl sie
ihrem ethischen Gehalte nach gewiss nicht so be-
deutend ist, wie das Werk Hoeckers. Uns erscheint
sie auch als ein Rückgang gegen sein vor zwei
Jahren auf der Stuck-Ausstellung gebrachtes gleich-
namiges Bild. Das jetzt ausgestellte ist die gemeine
Sünde, die aus Fleisch und Blut zusammengesetzt
ist, und jene war die böse Lust des intelligenten,
des echten Menschen, die schon im Gedanken die
Seele befleckt. Wir finden übrigens, dass eine Kunst,
die solche Dinge in so kräftiger, beredter Darstellung
bildet, wohl würdig aller Ehren ist. Wir haben ab-
sichtlich diese zwei Meister gedankenreicher, mehr
abstrakter Kunst herausgehoben, denn sie sind die
Bannerträger einer großen Reihe von Künstlern, die
ihnen mit mehr oder minder Glück folgen, die den
Bedürfnissen der menschlichen Phantasie Nahrung
zu geben suchen. Auf die oft verkannten tech-
nischen Vorzüge dieser Richtung kommen wir noch
zu sprechen.
Wie anders wirken die ehrlich - aufrichtigen
Naturalisten, die Schilderer des Lebens in ganzer,
halber und viertel Naturgröße auf uns ein, die
Porträtisten, Landschafter, Genre- und Tiermaler!
Wer je den echten Drang in sich gefühlt, zu schaf-
fen, der weiß, wie mächtig es ihn zwingt, das Leben
in der ihm eigenen Größe nachzubilden. Wie es
vor einem Jahrhundert aufs neue Peter Krafft in
Wien versuchte, so bilden auch die Neuen jede
menschliche Thätigkeit zwischen Wiege und Grab
nach, womöglich in voller Größe der Erscheinung.
Das Wechselwirken zwischen Mensch und Tier, wie
lebensvoll bringt Zügel das alles groß zur Geltung!
Wie leben die Chiemseelandschaft eines F. M. Bredt,
oder sein Genrebild „Daheim", das Bild mit dem
Fischer von L. Dettmann, das bewundernswerte Alt-
männerspital in Lübeck von Gotthard Kuehl, die Tier-
stücke eines Weishaupt oder eines Bergmannl So
wahr ist diese Kunst, dass sie fast selbstverständ-
lich berührt, wie die Landschaften eines Berlepsch,
Kutscha, Strützel, Strobentx, und Stadlerl Wie krank-
haft ist dagegen der talentvolle Samberger, der statt
der Natur Lenbach imitirt! Wie persönlich bedeu-
tend ist das Verhältnis der Kunst jener früher genannten
Meister zur Natur! P^ben darin, dass das Schulmäßige
immer mehr zurücktritt, das Rezept an Einfluss und
Ansehen verliert und nur das individuell Gute, es
mag wie immer aussehen, hinreicht, um gewürdigt
zu werden, eben darin liegt die Gewähr für die Zu-
kunft. Unsere Kunst ist in diesem Gährungsprozesse
ein treues Spiegelbild der ganzen Zeit, die auf allen
Gebieten verwandte Ziele anstrebt. Da drängt sich
wieder die Parallele mit dem Quattrocento auf; die
Kunstrevolution von heute und vor einem halben
Jahrtausend sehen sich sehr ähnlich und wer kann
leugnen, dass damals nach kaum einem Jahrhundert
aus diesem alle Geisteskräfte in Kampf versetzenden
Kreißen die herrlichsten Blüten sprossten, die schon
die nächste .Generation als reife Früchte gezeitigt
sah. Unsere moderne Kunst ist noch ein Jüngling
von den herben Formen eines Verrocchio, die nicht
jedem gefallen; diese Herbigkeit wird aber in ein
schönes vollendetes Ebenmaß übergehen, wenn die
Entwickelung vorüber ist. Die Bürgschaft für ein
gleiches Wachstum liegt in einer Reihe analoger
Züge, die beiden Perioden gemein sind; darunter ist
besonders die Vielseitigkeit der Meister zu beachten.
Dass bei dem oft übermenschlichen Wollen unserer
Künstler-Poeten, wie bei dem der Renaissancemeister,
die delikate Ausführung oft zurückbleibt hinter dem
beabsichtigten Ziele, diese Äußerlichkeit giebt häufig
genug Anlass zu dem wenig vertieften Urteile künst-
lerischer Inferiorität. Welche bedeutende, zeichen-
sichere Formkenner der Natur die Modernen sind,
beweisen Max Klinger — der, obwohl Mitglied der
Secession, leider nicht auf ihrer Wiener Ausstellung
vertreten ist, — Hans Thoma, Geyger und Greiner
Die Münchener „Seeession"
im Wiener Künstlerhuuse.
214
die Vernachlässigung der Form, besonders der alt-
hergebrachten, nur das mächtige Bedürfnis und den
Wunsch nach einer neuen zeitgemäßen immer mehr
weckt. Das Bedürfnis macht erfinderisch, der Wunsch
ist der Vater der That. Dann wird jede krause und
gesuchte Ausdrucksweise verschwinden und die ge-
klärte Form an ihre Stelle treten.
Die größte Gefahr, die dem seit Jahrzehnten
herrschenden Realismus droht, ist die abschüssige
Bahn des Symbolismus und Mysticismus. Für einen
Meister wie Paul Hoecker, der ein vollendeter fein-
fühliger Realist ist, wird diese Gefahr nichts be-
deuten: bei ihm entspringen Darstellungen solcher
Art aus einem inneren Triebe. Seine Nonne mit
den Wundmalen atmet Leben, wir machen ihre
Verzückung mit allen Schaudern des Körpers und
der Seele mit: das Bild ist formell und ideell
gleich vorzüglich, ein Mysterium von so allgemein
menschlicher Wahrheit, dass jede Erklärung über-
flüssig ist. Hält Franz Stuck in seiner „Sünde"
formell gleichen Schritt mit Höcker, so befriedigt
er uns dagegen in seinem „Krieg" nicht ganz, —
es fehlt diesem, bei aller Gedankengröße, an innerer
und äußerer Wahrheit: diese Männer sind nicht an
Wunden, sondern an Krämpfen gestorben. Jeden-
falls stellen wir seine „Sünde" höher, obwohl sie
ihrem ethischen Gehalte nach gewiss nicht so be-
deutend ist, wie das Werk Hoeckers. Uns erscheint
sie auch als ein Rückgang gegen sein vor zwei
Jahren auf der Stuck-Ausstellung gebrachtes gleich-
namiges Bild. Das jetzt ausgestellte ist die gemeine
Sünde, die aus Fleisch und Blut zusammengesetzt
ist, und jene war die böse Lust des intelligenten,
des echten Menschen, die schon im Gedanken die
Seele befleckt. Wir finden übrigens, dass eine Kunst,
die solche Dinge in so kräftiger, beredter Darstellung
bildet, wohl würdig aller Ehren ist. Wir haben ab-
sichtlich diese zwei Meister gedankenreicher, mehr
abstrakter Kunst herausgehoben, denn sie sind die
Bannerträger einer großen Reihe von Künstlern, die
ihnen mit mehr oder minder Glück folgen, die den
Bedürfnissen der menschlichen Phantasie Nahrung
zu geben suchen. Auf die oft verkannten tech-
nischen Vorzüge dieser Richtung kommen wir noch
zu sprechen.
Wie anders wirken die ehrlich - aufrichtigen
Naturalisten, die Schilderer des Lebens in ganzer,
halber und viertel Naturgröße auf uns ein, die
Porträtisten, Landschafter, Genre- und Tiermaler!
Wer je den echten Drang in sich gefühlt, zu schaf-
fen, der weiß, wie mächtig es ihn zwingt, das Leben
in der ihm eigenen Größe nachzubilden. Wie es
vor einem Jahrhundert aufs neue Peter Krafft in
Wien versuchte, so bilden auch die Neuen jede
menschliche Thätigkeit zwischen Wiege und Grab
nach, womöglich in voller Größe der Erscheinung.
Das Wechselwirken zwischen Mensch und Tier, wie
lebensvoll bringt Zügel das alles groß zur Geltung!
Wie leben die Chiemseelandschaft eines F. M. Bredt,
oder sein Genrebild „Daheim", das Bild mit dem
Fischer von L. Dettmann, das bewundernswerte Alt-
männerspital in Lübeck von Gotthard Kuehl, die Tier-
stücke eines Weishaupt oder eines Bergmannl So
wahr ist diese Kunst, dass sie fast selbstverständ-
lich berührt, wie die Landschaften eines Berlepsch,
Kutscha, Strützel, Strobentx, und Stadlerl Wie krank-
haft ist dagegen der talentvolle Samberger, der statt
der Natur Lenbach imitirt! Wie persönlich bedeu-
tend ist das Verhältnis der Kunst jener früher genannten
Meister zur Natur! P^ben darin, dass das Schulmäßige
immer mehr zurücktritt, das Rezept an Einfluss und
Ansehen verliert und nur das individuell Gute, es
mag wie immer aussehen, hinreicht, um gewürdigt
zu werden, eben darin liegt die Gewähr für die Zu-
kunft. Unsere Kunst ist in diesem Gährungsprozesse
ein treues Spiegelbild der ganzen Zeit, die auf allen
Gebieten verwandte Ziele anstrebt. Da drängt sich
wieder die Parallele mit dem Quattrocento auf; die
Kunstrevolution von heute und vor einem halben
Jahrtausend sehen sich sehr ähnlich und wer kann
leugnen, dass damals nach kaum einem Jahrhundert
aus diesem alle Geisteskräfte in Kampf versetzenden
Kreißen die herrlichsten Blüten sprossten, die schon
die nächste .Generation als reife Früchte gezeitigt
sah. Unsere moderne Kunst ist noch ein Jüngling
von den herben Formen eines Verrocchio, die nicht
jedem gefallen; diese Herbigkeit wird aber in ein
schönes vollendetes Ebenmaß übergehen, wenn die
Entwickelung vorüber ist. Die Bürgschaft für ein
gleiches Wachstum liegt in einer Reihe analoger
Züge, die beiden Perioden gemein sind; darunter ist
besonders die Vielseitigkeit der Meister zu beachten.
Dass bei dem oft übermenschlichen Wollen unserer
Künstler-Poeten, wie bei dem der Renaissancemeister,
die delikate Ausführung oft zurückbleibt hinter dem
beabsichtigten Ziele, diese Äußerlichkeit giebt häufig
genug Anlass zu dem wenig vertieften Urteile künst-
lerischer Inferiorität. Welche bedeutende, zeichen-
sichere Formkenner der Natur die Modernen sind,
beweisen Max Klinger — der, obwohl Mitglied der
Secession, leider nicht auf ihrer Wiener Ausstellung
vertreten ist, — Hans Thoma, Geyger und Greiner