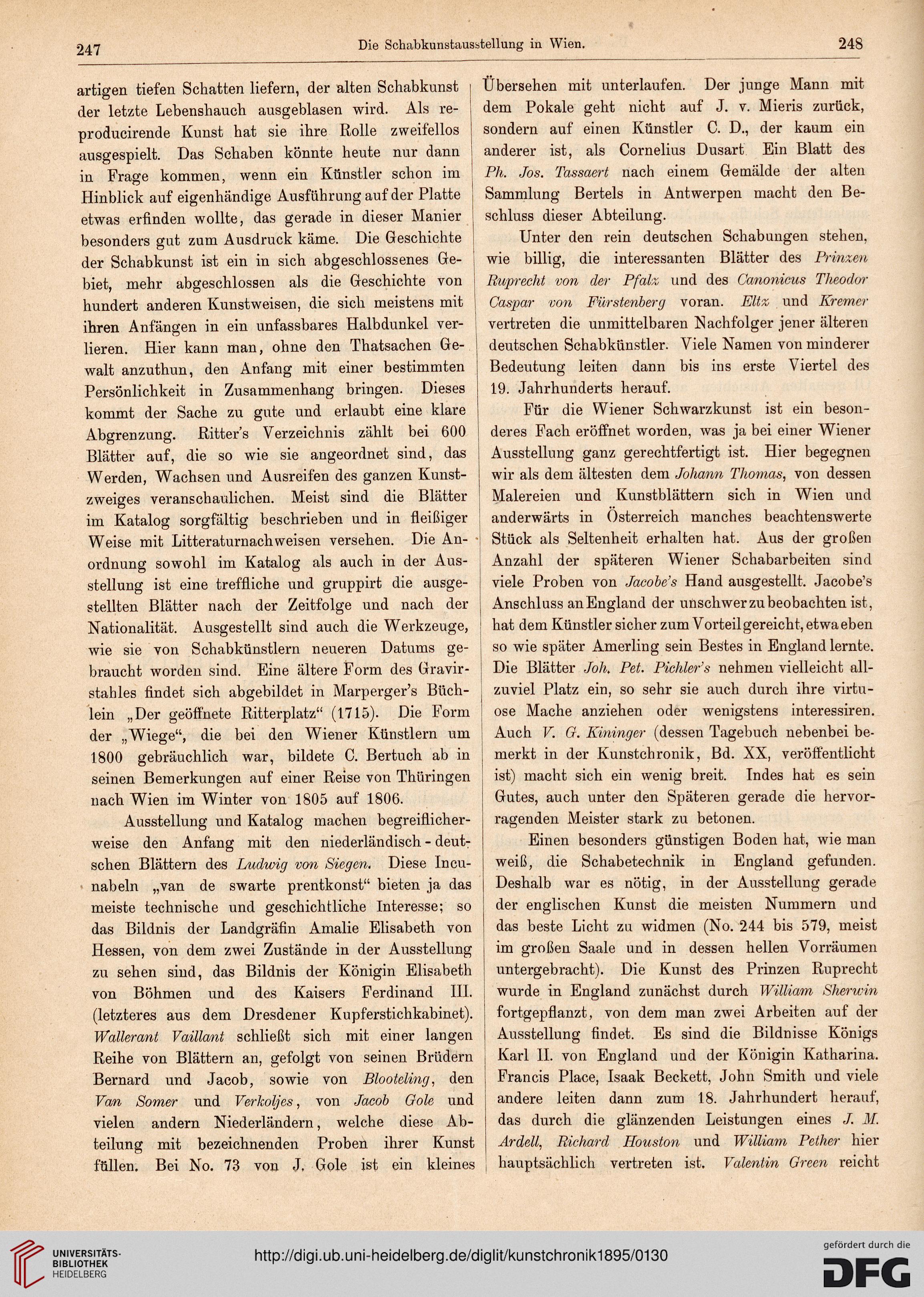247
Die Schabkunstausstellung in Wien. 248
artigen tiefen Schatten liefern, der alten Schabkunst |
der letzte Lebenshauch ausgeblasen wird. Als re-
producirende Kunst hat sie ihre Rolle zweifellos
ausgespielt. Das Schaben könnte heute nur dann
in Frage kommen, wenn ein Künstler schon im
Hinblick auf eigenhändige Ausführung auf der Platte
etwas erfinden wollte, das gerade in dieser Manier
besonders gut zum Ausdruck käme. Die Geschichte
der Schabkunst ist ein in sich abgeschlossenes Ge-
biet, mehr abgeschlossen als die Geschichte von
hundert anderen Kunstweisen, die sich meistens mit
ihren Anfängen in ein unfassbares Halbdunkel ver-
lieren. Hier kann man, ohne den Thatsachen Ge-
walt anzuthun, den Anfang mit einer bestimmten
Persönlichkeit in Zusammenhang bringen. Dieses
kommt der Sache zu gute und erlaubt eine klare
Abgrenzung, ßitter's Verzeichnis zählt bei 600
Blätter auf, die so wie sie angeordnet sind, das
Werden, Wachsen und Ausreifen des ganzen Kunst-
zweiges veranschaulichen. Meist sind die Blätter
im Katalog sorgfältig beschrieben und in fleißiger
Weise mit Literaturnachweisen versehen. Die An-
ordnung sowohl im Katalog als auch in der Aus-
stellung ist eine treffliche und gruppirt die ausge-
stellten Blätter nach der Zeitfolge und nach der
Nationalität. Ausgestellt sind auch die Werkzeuge,
wie sie von Schabkünstlern neueren Datums ge-
braucht worden sind. Eine ältere Form des Gravir-
stahles findet sich abgebildet in Marperger's Büch-
lein „Der geöffnete Ritterplatz" (1715). Die Form
der „Wiege", die bei den Wiener Künstlern um
1800 gebräuchlich war, bildete C. Bertuch ab in
seinen Bemerkungen auf einer Reise von Thüringen
nach Wien im Winter von 1805 auf 1806.
Ausstellung und Katalog machen begreiflicher-
weise den Anfang mit den niederländisch - deut-
schen Blättern des Ludwig von Siegen. Diese Incu-
nabeln „van de swarte prentkonst" bieten ja das
meiste technische und geschichtliche Interesse; so
das Bildnis der Landgräfin Amalie Elisabeth von
Hessen, von dem zwei Zustände in der Ausstellung
zu sehen sind, das Bildnis der Königin Elisabeth
von Böhmen und des Kaisers Ferdinand III.
(letzteres aus dem Dresdener Kupferstichkabinet).
Wallerant Vaillant schließt sich mit einer langen
Reihe von Blättern an, gefolgt von seinen Brüdern
Bernard und Jacob, sowie von Blooteling, den
Van Somer und Verkoljes, von Jacob Gole und
vielen andern Niederländern, welche diese Ab-
teilung mit bezeichnenden Proben ihrer Kunst
füllen. Bei No. 73 von J. Gole ist ein kleines
Übersehen mit unterlaufen. Der junge Mann mit
dem Pokale geht nicht auf J. v. Mieris zurück,
sondern auf einen Künstler C. D., der kaum ein
anderer ist, als Cornelius Dusart Ein Blatt des
Ph. Jos. Tassaert nach einem Gemälde der alten
Sammlung Berteis in Antwerpen macht den Be-
schluss dieser Abteilung.
Unter den rein deutschen Schabungen stehen,
wie billig, die interessanten Blätter des Prinzen
Ruprecht von der Pfalz und des Canonicus Theodor
Caspar von Fürstenberg voran. Eitz und Kremer
vertreten die unmittelbaren Nachfolger jener älteren
deutschen Schabkünstler. Viele Namen von minderer
Bedeutung leiten dann bis ins erste Viertel des
19. Jahrhunderts herauf.
Für die Wiener Schwarzkunst ist ein beson-
deres Fach eröffnet worden, was ja bei einer Wiener
Ausstellung ganz gerechtfertigt ist. Hier begegnen
wir als dem ältesten dem Johann Thomas, von dessen
Malereien und Kunstblättern sich in Wien und
anderwärts in Osterreich manches beachtenswerte
Stück als Seltenheit erhalten hat. Aus der großen
Anzahl der späteren Wiener Schabarbeiten sind
viele Proben von Jacobe's Hand ausgestellt. Jacobe's
Anschluss an England der unschwer zu beobachten ist,
hat dem Künstler sicher zum Vorteil gereicht, etwa eben
so wie später Amerling sein Bestes in England lernte.
Die Blätter Joh. Pet. Pichler's nehmen vielleicht all-
zuviel Platz ein, so sehr sie auch durch ihre virtu-
ose Mache anziehen oder wenigstens interessiren.
Auch V. G. Kininger (dessen Tagebuch nebenbei be-
merkt in der Kunstcbronik, Bd. XX, veröffentlicht
ist) macht sich ein wenig breit. Indes hat es sein
Gutes, auch unter den Späteren gerade die hervor-
ragenden Meister stark zu betonen.
Einen besonders günstigen Boden hat, wie man
weiß, die Schabetechnik in England gefunden.
Deshalb war es nötig, in der Ausstellung gerade
der englischen Kunst die meisten Nummern und
das beste Licht zu widmen (No. 244 bis 579, meist
im großen Saale und in dessen hellen Vorräumen
untergebracht). Die Kunst des Prinzen Ruprecht
! wurde in England zunächst durch William Sherwin
fortgepflanzt, von dem man zwei Arbeiten auf der
Ausstellung findet. Es sind die Bildnisse Königs
Karl II. von England und der Königin Katharina.
Francis Place, Isaak Beckett, John Smith und viele
andere leiten dann zum 18. Jahrhundert herauf,
das durch die glänzenden Leistungen eines J. M.
Ardell, Richard Houston und William Pether hier
| hauptsächlich vertreten ist. Valentin Green reicht
Die Schabkunstausstellung in Wien. 248
artigen tiefen Schatten liefern, der alten Schabkunst |
der letzte Lebenshauch ausgeblasen wird. Als re-
producirende Kunst hat sie ihre Rolle zweifellos
ausgespielt. Das Schaben könnte heute nur dann
in Frage kommen, wenn ein Künstler schon im
Hinblick auf eigenhändige Ausführung auf der Platte
etwas erfinden wollte, das gerade in dieser Manier
besonders gut zum Ausdruck käme. Die Geschichte
der Schabkunst ist ein in sich abgeschlossenes Ge-
biet, mehr abgeschlossen als die Geschichte von
hundert anderen Kunstweisen, die sich meistens mit
ihren Anfängen in ein unfassbares Halbdunkel ver-
lieren. Hier kann man, ohne den Thatsachen Ge-
walt anzuthun, den Anfang mit einer bestimmten
Persönlichkeit in Zusammenhang bringen. Dieses
kommt der Sache zu gute und erlaubt eine klare
Abgrenzung, ßitter's Verzeichnis zählt bei 600
Blätter auf, die so wie sie angeordnet sind, das
Werden, Wachsen und Ausreifen des ganzen Kunst-
zweiges veranschaulichen. Meist sind die Blätter
im Katalog sorgfältig beschrieben und in fleißiger
Weise mit Literaturnachweisen versehen. Die An-
ordnung sowohl im Katalog als auch in der Aus-
stellung ist eine treffliche und gruppirt die ausge-
stellten Blätter nach der Zeitfolge und nach der
Nationalität. Ausgestellt sind auch die Werkzeuge,
wie sie von Schabkünstlern neueren Datums ge-
braucht worden sind. Eine ältere Form des Gravir-
stahles findet sich abgebildet in Marperger's Büch-
lein „Der geöffnete Ritterplatz" (1715). Die Form
der „Wiege", die bei den Wiener Künstlern um
1800 gebräuchlich war, bildete C. Bertuch ab in
seinen Bemerkungen auf einer Reise von Thüringen
nach Wien im Winter von 1805 auf 1806.
Ausstellung und Katalog machen begreiflicher-
weise den Anfang mit den niederländisch - deut-
schen Blättern des Ludwig von Siegen. Diese Incu-
nabeln „van de swarte prentkonst" bieten ja das
meiste technische und geschichtliche Interesse; so
das Bildnis der Landgräfin Amalie Elisabeth von
Hessen, von dem zwei Zustände in der Ausstellung
zu sehen sind, das Bildnis der Königin Elisabeth
von Böhmen und des Kaisers Ferdinand III.
(letzteres aus dem Dresdener Kupferstichkabinet).
Wallerant Vaillant schließt sich mit einer langen
Reihe von Blättern an, gefolgt von seinen Brüdern
Bernard und Jacob, sowie von Blooteling, den
Van Somer und Verkoljes, von Jacob Gole und
vielen andern Niederländern, welche diese Ab-
teilung mit bezeichnenden Proben ihrer Kunst
füllen. Bei No. 73 von J. Gole ist ein kleines
Übersehen mit unterlaufen. Der junge Mann mit
dem Pokale geht nicht auf J. v. Mieris zurück,
sondern auf einen Künstler C. D., der kaum ein
anderer ist, als Cornelius Dusart Ein Blatt des
Ph. Jos. Tassaert nach einem Gemälde der alten
Sammlung Berteis in Antwerpen macht den Be-
schluss dieser Abteilung.
Unter den rein deutschen Schabungen stehen,
wie billig, die interessanten Blätter des Prinzen
Ruprecht von der Pfalz und des Canonicus Theodor
Caspar von Fürstenberg voran. Eitz und Kremer
vertreten die unmittelbaren Nachfolger jener älteren
deutschen Schabkünstler. Viele Namen von minderer
Bedeutung leiten dann bis ins erste Viertel des
19. Jahrhunderts herauf.
Für die Wiener Schwarzkunst ist ein beson-
deres Fach eröffnet worden, was ja bei einer Wiener
Ausstellung ganz gerechtfertigt ist. Hier begegnen
wir als dem ältesten dem Johann Thomas, von dessen
Malereien und Kunstblättern sich in Wien und
anderwärts in Osterreich manches beachtenswerte
Stück als Seltenheit erhalten hat. Aus der großen
Anzahl der späteren Wiener Schabarbeiten sind
viele Proben von Jacobe's Hand ausgestellt. Jacobe's
Anschluss an England der unschwer zu beobachten ist,
hat dem Künstler sicher zum Vorteil gereicht, etwa eben
so wie später Amerling sein Bestes in England lernte.
Die Blätter Joh. Pet. Pichler's nehmen vielleicht all-
zuviel Platz ein, so sehr sie auch durch ihre virtu-
ose Mache anziehen oder wenigstens interessiren.
Auch V. G. Kininger (dessen Tagebuch nebenbei be-
merkt in der Kunstcbronik, Bd. XX, veröffentlicht
ist) macht sich ein wenig breit. Indes hat es sein
Gutes, auch unter den Späteren gerade die hervor-
ragenden Meister stark zu betonen.
Einen besonders günstigen Boden hat, wie man
weiß, die Schabetechnik in England gefunden.
Deshalb war es nötig, in der Ausstellung gerade
der englischen Kunst die meisten Nummern und
das beste Licht zu widmen (No. 244 bis 579, meist
im großen Saale und in dessen hellen Vorräumen
untergebracht). Die Kunst des Prinzen Ruprecht
! wurde in England zunächst durch William Sherwin
fortgepflanzt, von dem man zwei Arbeiten auf der
Ausstellung findet. Es sind die Bildnisse Königs
Karl II. von England und der Königin Katharina.
Francis Place, Isaak Beckett, John Smith und viele
andere leiten dann zum 18. Jahrhundert herauf,
das durch die glänzenden Leistungen eines J. M.
Ardell, Richard Houston und William Pether hier
| hauptsächlich vertreten ist. Valentin Green reicht