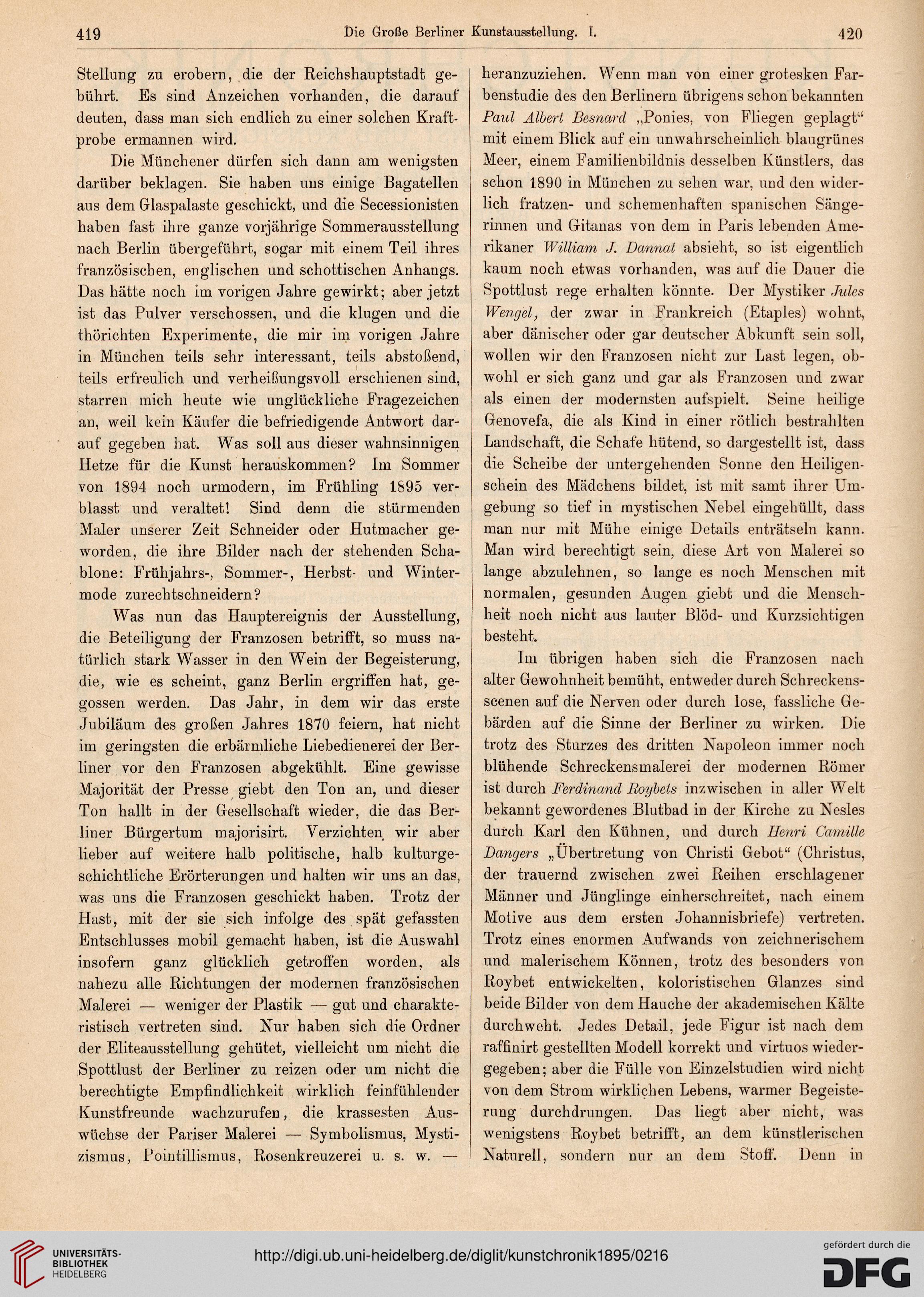419
Die Große Berliner
Kunstausstellung. I.
420
Stellung zu erobern, die der Reichshauptstadt ge-
bührt. Es sind Anzeichen vorhanden, die darauf
deuten, dass man sich endlich zu einer solchen Kraft-
probe ermannen wird.
Die Münchener dürfen sich dann am wenigsten
darüber beklagen. Sie haben uns einige Bagatellen
aus dem Glaspalaste geschickt, und die Secessionisten
haben fast ihre ganze vorjährige Sommerausstellung
nach Berlin übergeführt, sogar mit einem Teil ihres
französischen, englischen und schottischen Anhangs.
Das hätte noch im vorigen Jahre gewirkt; aber jetzt
ist das Pulver verschossen, und die klugen und die
thörichten Experimente, die mir im vorigen Jahre
in München teils sehr interessant, teils abstoßend,
teils erfreulich und verheißungsvoll erschienen sind,
starren mich heute wie unglückliche Fragezeichen
an, weil kein Käufer die befriedigende Antwort dar-
auf gegeben hat. Was soll aus dieser wahnsinnigen
Hetze für die Kunst herauskommen? Im Sommer
von 1894 noch urmodern, im Frühling 1895 ver-
blasst und veraltet! Sind denn die stürmenden
Maler unserer Zeit Schneider oder Hutmacher ge-
worden, die ihre Bilder nach der stehenden Scha-
blone: Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winter-
mode zurech tschn eidern?
Was nun das Hauptereignis der Ausstellung,
die Beteiligung der Franzosen betrifft, so muss na-
türlich stark Wasser in den Wein der Begeisterung,
die, wie es scheint, ganz Berlin ergriffen hat, ge-
gossen werden. Das Jahr, in dem wir das erste
Jubiläum des großen Jahres 1870 feiern, hat nicht
im geringsten die erbärmliche Liebedienerei der Ber-
liner vor den Franzosen abgekühlt. Eine gewisse
Majorität der Presse giebt den Ton an, und dieser
Ton hallt in der Gesellschaft wieder, die das Ber-
liner Bürgertum majorisirt. Verzichten wir aber
lieber auf weitere halb politische, halb kulturge-
schichtliche Erörterungen und halten wir uns an das,
was uns die Franzosen geschickt haben. Trotz der
Hast, mit der sie sich infolge des spät gefassten
Entschlusses mobil gemacht haben, ist die Auswahl
insofern ganz glücklich getroffen worden, als
nahezu alle Richtungen der modernen französischen
Malerei — weniger der Plastik — gut und charakte-
ristisch vertreten sind. Nur haben sich die Ordner
der Eliteausstellung gehütet, vielleicht um nicht die
Spottlust der Berliner zu reizen oder um nicht die
berechtigte Empfindlichkeit wirklich feinfühlender
Kunstfreunde wachzurufen, die krassesten Aus-
wüchse der Pariser Malerei — Symbolismus, Mysti-
zismus, Pointiiiismus, Rosenkreuzerei u. s. w. —
heranzuziehen. Wenn man von einer grotesken Far-
benstudie des den Berlinern übrigens schon bekannten
Paul Albert Besnard „Ponies, von Fliegen geplagt"
mit einem Blick auf ein unwahrscheinlich blaugrünes
Meer, einem Familienbildnis desselben Künstlers, das
schon 1890 in München zu sehen war, und den wider-
lich fratzen- und schemenhaften spanischen Sänge-
rinnen und Gitanas von dem in Paris lebenden Ame-
rikaner William J. Dannat absieht, so ist eigentlich
kaum noch etwas vorhanden, was auf die Dauer die
Spottlust rege erhalten könnte. Der Mystiker Jules
Wengel, der zwar in Frankreich (Etaples) wohnt,
aber dänischer oder gar deutscher Abkunft sein soll,
wollen wir den Franzosen nicht zur Last legen, ob-
wohl er sich ganz und gar als Franzosen und zwar
als einen der modernsten aufspielt. Seine heilige
Genovefa, die als Kind in einer rötlich bestrahlten
Landschaft, die Schafe hütend, so dargestellt ist, dass
die Scheibe der untergehenden Sonne den Heiligen-
schein des Mädchens bildet, ist mit samt ihrer Um-
gebung so tief in mystischen Nebel eingehüllt, dass
man nur mit Mühe einige Details enträtseln kann.
Man wird berechtigt sein, diese Art von Malerei so
lange abzulehnen, so lange es noch Menschen mit
normalen, gesunden Augen giebt und die Mensch-
heit noch nicht aus lauter Blöd- und Kurzsichtigen
besteht.
Im übrigen haben sich die Franzosen nach
alter Gewohnheit bemüht, entweder durch Schreckens-
scenen auf die Nerven oder durch lose, fassliche Ge-
bärden auf die Sinne der Berliner zu wirken. Die
trotz des Sturzes des dritten Napoleon immer noch
blühende Schreckensmalerei der modernen Römer
ist durch Ferdinand Iloybets inzwischen in aller Welt
bekannt gewordenes Blutbad in der Kirche zu Nesles
durch Karl den Kühnen, und durch Henri Camille
Dangers „Übertretung von Christi Gebot" (Christus,
der trauernd zwischen zwei Reihen erschlagener
Männer und Jünglinge einherschreitet, nach einem
Motive aus dem ersten Johannisbriefe) vertreten.
Trotz eines enormen Aufwands von zeichnerischem
und malerischem Können, trotz des besonders von
Roybet entwickelten, koloristischen Glanzes sind
beide Bilder von dem Hauche der akademischen Kälte
durchweht. Jedes Detail, jede Figur ist nach dem
raffinirt gestellten Modell korrekt und virtuos wieder-
gegeben; aber die Fülle von Einzelstudien wird nicht
von dem Strom wirklichen Lebens, warmer Begeiste-
rung durchdrungen. Das liegt aber nicht, was
wenigstens Roybet betrifft, an dem künstlerischen
Naturell, sondern nur an dem Stoff. Denn in
Die Große Berliner
Kunstausstellung. I.
420
Stellung zu erobern, die der Reichshauptstadt ge-
bührt. Es sind Anzeichen vorhanden, die darauf
deuten, dass man sich endlich zu einer solchen Kraft-
probe ermannen wird.
Die Münchener dürfen sich dann am wenigsten
darüber beklagen. Sie haben uns einige Bagatellen
aus dem Glaspalaste geschickt, und die Secessionisten
haben fast ihre ganze vorjährige Sommerausstellung
nach Berlin übergeführt, sogar mit einem Teil ihres
französischen, englischen und schottischen Anhangs.
Das hätte noch im vorigen Jahre gewirkt; aber jetzt
ist das Pulver verschossen, und die klugen und die
thörichten Experimente, die mir im vorigen Jahre
in München teils sehr interessant, teils abstoßend,
teils erfreulich und verheißungsvoll erschienen sind,
starren mich heute wie unglückliche Fragezeichen
an, weil kein Käufer die befriedigende Antwort dar-
auf gegeben hat. Was soll aus dieser wahnsinnigen
Hetze für die Kunst herauskommen? Im Sommer
von 1894 noch urmodern, im Frühling 1895 ver-
blasst und veraltet! Sind denn die stürmenden
Maler unserer Zeit Schneider oder Hutmacher ge-
worden, die ihre Bilder nach der stehenden Scha-
blone: Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winter-
mode zurech tschn eidern?
Was nun das Hauptereignis der Ausstellung,
die Beteiligung der Franzosen betrifft, so muss na-
türlich stark Wasser in den Wein der Begeisterung,
die, wie es scheint, ganz Berlin ergriffen hat, ge-
gossen werden. Das Jahr, in dem wir das erste
Jubiläum des großen Jahres 1870 feiern, hat nicht
im geringsten die erbärmliche Liebedienerei der Ber-
liner vor den Franzosen abgekühlt. Eine gewisse
Majorität der Presse giebt den Ton an, und dieser
Ton hallt in der Gesellschaft wieder, die das Ber-
liner Bürgertum majorisirt. Verzichten wir aber
lieber auf weitere halb politische, halb kulturge-
schichtliche Erörterungen und halten wir uns an das,
was uns die Franzosen geschickt haben. Trotz der
Hast, mit der sie sich infolge des spät gefassten
Entschlusses mobil gemacht haben, ist die Auswahl
insofern ganz glücklich getroffen worden, als
nahezu alle Richtungen der modernen französischen
Malerei — weniger der Plastik — gut und charakte-
ristisch vertreten sind. Nur haben sich die Ordner
der Eliteausstellung gehütet, vielleicht um nicht die
Spottlust der Berliner zu reizen oder um nicht die
berechtigte Empfindlichkeit wirklich feinfühlender
Kunstfreunde wachzurufen, die krassesten Aus-
wüchse der Pariser Malerei — Symbolismus, Mysti-
zismus, Pointiiiismus, Rosenkreuzerei u. s. w. —
heranzuziehen. Wenn man von einer grotesken Far-
benstudie des den Berlinern übrigens schon bekannten
Paul Albert Besnard „Ponies, von Fliegen geplagt"
mit einem Blick auf ein unwahrscheinlich blaugrünes
Meer, einem Familienbildnis desselben Künstlers, das
schon 1890 in München zu sehen war, und den wider-
lich fratzen- und schemenhaften spanischen Sänge-
rinnen und Gitanas von dem in Paris lebenden Ame-
rikaner William J. Dannat absieht, so ist eigentlich
kaum noch etwas vorhanden, was auf die Dauer die
Spottlust rege erhalten könnte. Der Mystiker Jules
Wengel, der zwar in Frankreich (Etaples) wohnt,
aber dänischer oder gar deutscher Abkunft sein soll,
wollen wir den Franzosen nicht zur Last legen, ob-
wohl er sich ganz und gar als Franzosen und zwar
als einen der modernsten aufspielt. Seine heilige
Genovefa, die als Kind in einer rötlich bestrahlten
Landschaft, die Schafe hütend, so dargestellt ist, dass
die Scheibe der untergehenden Sonne den Heiligen-
schein des Mädchens bildet, ist mit samt ihrer Um-
gebung so tief in mystischen Nebel eingehüllt, dass
man nur mit Mühe einige Details enträtseln kann.
Man wird berechtigt sein, diese Art von Malerei so
lange abzulehnen, so lange es noch Menschen mit
normalen, gesunden Augen giebt und die Mensch-
heit noch nicht aus lauter Blöd- und Kurzsichtigen
besteht.
Im übrigen haben sich die Franzosen nach
alter Gewohnheit bemüht, entweder durch Schreckens-
scenen auf die Nerven oder durch lose, fassliche Ge-
bärden auf die Sinne der Berliner zu wirken. Die
trotz des Sturzes des dritten Napoleon immer noch
blühende Schreckensmalerei der modernen Römer
ist durch Ferdinand Iloybets inzwischen in aller Welt
bekannt gewordenes Blutbad in der Kirche zu Nesles
durch Karl den Kühnen, und durch Henri Camille
Dangers „Übertretung von Christi Gebot" (Christus,
der trauernd zwischen zwei Reihen erschlagener
Männer und Jünglinge einherschreitet, nach einem
Motive aus dem ersten Johannisbriefe) vertreten.
Trotz eines enormen Aufwands von zeichnerischem
und malerischem Können, trotz des besonders von
Roybet entwickelten, koloristischen Glanzes sind
beide Bilder von dem Hauche der akademischen Kälte
durchweht. Jedes Detail, jede Figur ist nach dem
raffinirt gestellten Modell korrekt und virtuos wieder-
gegeben; aber die Fülle von Einzelstudien wird nicht
von dem Strom wirklichen Lebens, warmer Begeiste-
rung durchdrungen. Das liegt aber nicht, was
wenigstens Roybet betrifft, an dem künstlerischen
Naturell, sondern nur an dem Stoff. Denn in