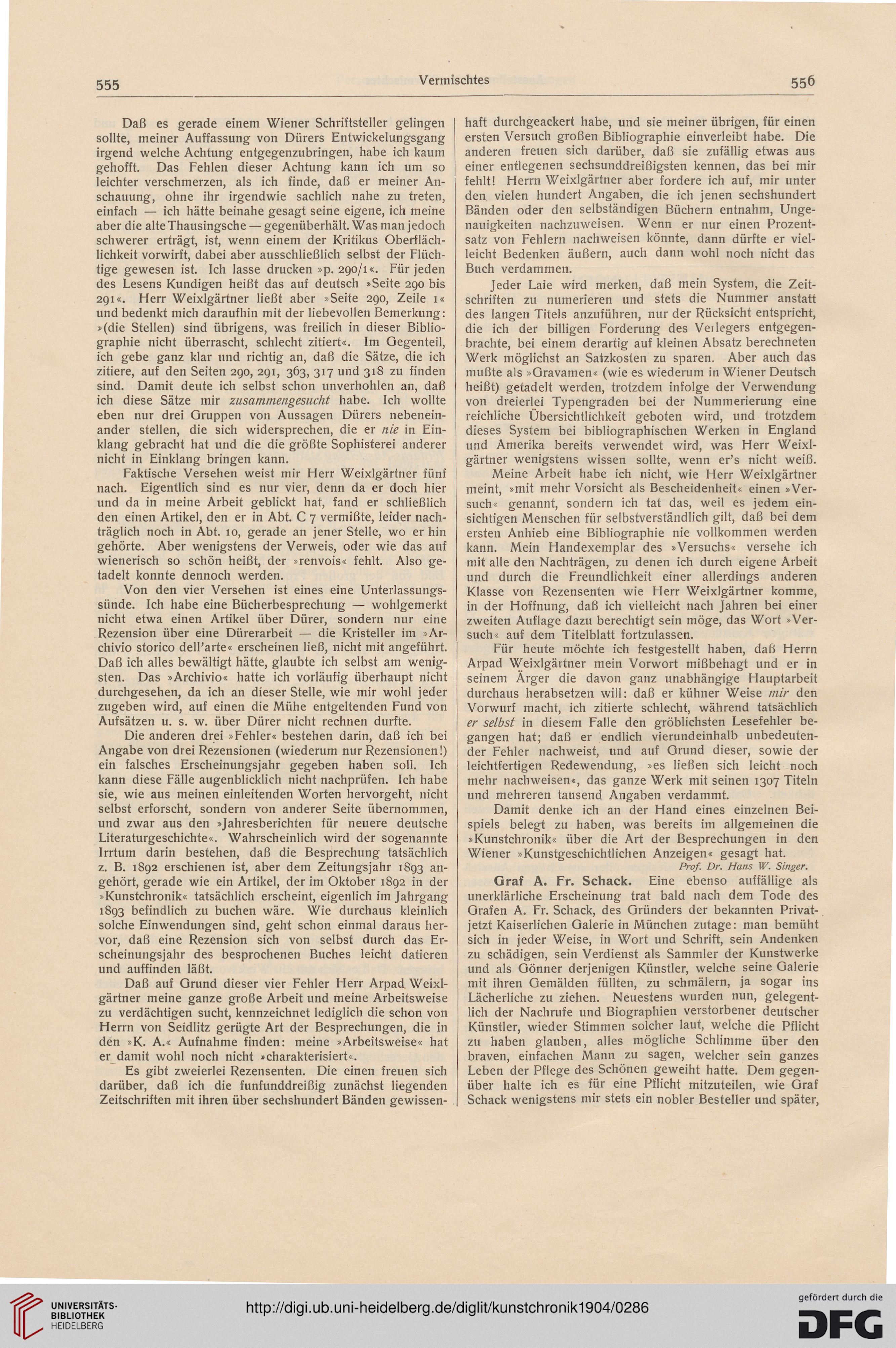555
Vermischtes
556
Daß es gerade einem Wiener Schriftsteller gelingen
sollte, meiner Auffassung von Dürers Entwickelungsgang
irgend welche Achtung entgegenzubringen, habe ich kaum
gehofft. Das Fehlen dieser Achtung kann ich um so
leichter verschmerzen, als ich finde, daß er meiner An-
schauung, ohne ihr irgendwie sachlich nahe zu treten,
einfach — ich hätte beinahe gesagt seine eigene, ich meine
aber die alteThausingsche — gegenüberhält. Was man jedoch
schwerer erträgt, ist, wenn einem der Kritikus Oberfläch-
lichkeit vorwirft, dabei aber ausschließlich selbst der Flüch-
tige gewesen ist. Ich lasse drucken »p. 290/1«. Für jeden
des Lesens Kundigen heißt das auf deutsch »Seite 290 bis
291«. Herr Weixlgärtner ließt aber »Seite 290, Zeile 1«
und bedenkt mich daraufhin mit der liebevollen Bemerkung:
»(die Stellen) sind übrigens, was freilich in dieser Biblio-
graphie nicht überrascht, schlecht zitiert«. Im Gegenteil,
ich gebe ganz klar und richtig an, daß die Sätze, die ich
zitiere, auf den Seiten 290, 291, 363, 317 und 318 zu finden
sind. Damit deute ich selbst schon unverhohlen an, daß
ich diese Sätze mir zusammengesucht habe. Ich wollte
eben nur drei Gruppen von Aussagen Dürers nebenein-
ander stellen, die sich widersprechen, die er nie in Ein-
klang gebracht hat und die die größte Sophisterei anderer
nicht in Einklang bringen kann.
Faktische Versehen weist mir Herr Weixlgärtner fünf
nach. Eigentlich sind es nur vier, denn da er doch hier
und da in meine Arbeit geblickt hat, fand er schließlich
den einen Artikel, den er in Abt. C 7 vermißte, leider nach-
träglich noch in Abt. 10, gerade an jener Stelle, wo er hin
gehörte. Aber wenigstens der Verweis, oder wie das auf
wienerisch so schön heißt, der »renvois« fehlt. Also ge-
tadelt konnte dennoch werden.
Von den vier Versehen ist eines eine Unterlassungs-
sünde. Ich habe eine Bücherbesprechung — wohlgemerkt
nicht etwa einen Artikel über Dürer, sondern nur eine
Rezension über eine Dürerarbeit — die Kristeller im »Ar-
chivio storico dell'arte« erscheinen ließ, nicht mit angeführt.
Daß ich alles bewältigt hätte, glaubte ich selbst am wenig-
sten. Das »Archivio« hatte ich vorläufig überhaupt nicht
durchgesehen, da ich an dieser Stelle, wie mir wohl jeder
zugeben wird, auf einen die Mühe entgeltenden Fund von
Aufsätzen u. s. w. über Dürer nicht rechnen durfte.
Die anderen drei »Fehler« bestehen darin, daß ich bei
Angabe von drei Rezensionen (wiederum nur Rezensionen!)
ein falsches Erscheinungsjahr gegeben haben soll. Ich
kann diese Fälle augenblicklich nicht nachprüfen. Ich habe
sie, wie aus meinen einleitenden Worten hervorgeht, nicht
selbst erforscht, sondern von anderer Seite übernommen,
und zwar aus den »Jahresberichten für neuere deutsche
Literaturgeschichte «. Wahrscheinlich wird der sogenannte
Irrtum darin bestehen, daß die Besprechung tatsächlich
z. B. 1892 erschienen ist, aber dem Zeitungsjahr 1893 an-
gehört, gerade wie ein Artikel, der im Oktober 1892 in der
»Kunstchronik« tatsächlich erscheint, eigenlich im Jahrgang
1893 befindlich zu buchen wäre. Wie durchaus kleinlich
solche Einwendungen sind, geht schon einmal daraus her-
vor, daß eine Rezension sich von selbst durch das Er-
scheinungsjahr des besprochenen Buches leicht datieren
und auffinden läßt.
Daß auf Grund dieser vier Fehler Herr Arpad Weixl-
gärtner meine ganze große Arbeit und meine Arbeitsweise
zu verdächtigen sucht, kennzeichnet lediglich die schon von
Herrn von Seidlitz gerügte Art der Besprechungen, die in
den »K. A.« Aufnahme finden: meine »Arbeitsweise« hat
er damit wohl noch nicht »charakterisiert«.
Es gibt zweierlei Rezensenten. Die einen freuen sich
darüber, daß ich die funfunddreißig zunächst liegenden
Zeitschriften mit ihren über sechshundert Bänden gewissen-
haft durchgeackert habe, und sie meiner übrigen, für einen
ersten Versuch großen Bibliographie einverleibt habe. Die
anderen freuen sich darüber, daß sie zufällig etwas aus
einer entlegenen sechsunddreißigsten kennen, das bei mir
fehlt! Herrn Weixlgärtner aber fordere ich auf, mir unter
den vielen hundert Angaben, die ich jenen sechshundert
Bänden oder den selbständigen Büchern entnahm, Unge-
nauigkeiten nachzuweisen. Wenn er nur einen Prozent-
satz von Fehlern nachweisen könnte, dann dürfte er viel-
leicht Bedenken äußern, auch dann wohl noch nicht das
Buch verdammen.
Jeder Laie wird merken, daß mein System, die Zeit-
schriften zu numerieren und stets die Nummer anstatt
des langen Titels anzuführen, nur der Rücksicht entspricht,
die ich der billigen Forderung des Veilegers entgegen-
brachte, bei einem derartig auf kleinen Absatz berechneten
Werk möglichst an Satzkosten zu sparen. Aber auch das
mußte als »Gravamen« (wie es wiederum in Wiener Deutsch
heißt) getadelt werden, trotzdem infolge der Verwendung
von dreierlei Typengraden bei der Nummerierung eine
reichliche Übersichtlichkeit geboten wird, und trotzdem
dieses System bei bibliographischen Werken in England
und Amerika bereits verwendet wird, was Herr Weixl-
gärtner wenigstens wissen sollte, wenn er's nicht weiß.
Meine Arbeit habe ich nicht, wie Herr Weixlgärtner
meint, »mit mehr Vorsicht als Bescheidenheit« einen »Ver-
such« genannt, sondern ich tat das, weil es jedem ein-
sichtigen Menschen für selbstverständlich gilt, daß bei dem
ersten Anhieb eine Bibliographie nie vollkommen werden
kann. Mein Handexemplar des »Versuchs« versehe ich
mit alle den Nachträgen, zu denen ich durch eigene Arbeit
und durch die Freundlichkeit einer allerdings anderen
Klasse von Rezensenten wie Herr Weixlgärtner komme,
in der Hoffnung, daß ich vielleicht nach Jahren bei einer
zweiten Auflage dazu berechtigt sein möge, das Wort »Ver-
such« auf dem Titelblatt fortzulassen.
Für heute möchte ich festgestellt haben, daß Herrn
Arpad Weixlgärtner mein Vorwort mißbehagt und er in
seinem Arger die davon ganz unabhängige Hauptarbeit
durchaus herabsetzen will: daß er kühner Weise mir den
Vorwurf macht, ich zitierte schlecht, während tatsächlich
er selbst in diesem Falle den gröblichsten Lesefehler be-
gangen hat; daß er endlich vierundeinhalb unbedeuten-
der Fehler nachweist, und auf Grund dieser, sowie der
leichtfertigen Redewendung, »es ließen sich leicht noch
mehr nachweisen«, das ganze Werk mit seinen 1307 Titeln
und mehreren tausend Angaben verdammt.
Damit denke ich an der Hand eines einzelnen Bei-
spiels belegt zu haben, was bereits im allgemeinen die
»Kunstchronik« über die Art der Besprechungen in den
Wiener »Kunstgeschichtlichen Anzeigen« gesagt hat.
Prof. Dr. Hans W. Singer.
Graf A. Fr. Schack. Eine ebenso auffällige als
unerklärliche Erscheinung trat bald nach dem Tode des
Grafen A. Fr. Schack, des Gründers der bekannten Privat-
jetzt Kaiserlichen Galerie in München zutage: man bemüht
sich in jeder Weise, in Wort und Schrift, sein Andenken
zu schädigen, sein Verdienst als Sammler der Kunstwerke
und als Gönner derjenigen Künstler, welche seine Galerie
mit ihren Gemälden füllten, zu schmälern, ja sogar ins
Lächerliche zu ziehen. Neuestens wurden nun, gelegent-
lich der Nachrufe und Biographien verstorbener deutscher
Künstler, wieder Stimmen solcher laut, welche die Pflicht
zu haben glauben, alles mögliche Schlimme über den
braven, einfachen Mann zu sagen, welcher sein ganzes
Leben der Pflege des Schönen geweiht hatte. Dem gegen-
über halte ich es für eine Pflicht mitzuteilen, wie Graf
Schack wenigstens mir stets ein nobler Besteller und später,
Vermischtes
556
Daß es gerade einem Wiener Schriftsteller gelingen
sollte, meiner Auffassung von Dürers Entwickelungsgang
irgend welche Achtung entgegenzubringen, habe ich kaum
gehofft. Das Fehlen dieser Achtung kann ich um so
leichter verschmerzen, als ich finde, daß er meiner An-
schauung, ohne ihr irgendwie sachlich nahe zu treten,
einfach — ich hätte beinahe gesagt seine eigene, ich meine
aber die alteThausingsche — gegenüberhält. Was man jedoch
schwerer erträgt, ist, wenn einem der Kritikus Oberfläch-
lichkeit vorwirft, dabei aber ausschließlich selbst der Flüch-
tige gewesen ist. Ich lasse drucken »p. 290/1«. Für jeden
des Lesens Kundigen heißt das auf deutsch »Seite 290 bis
291«. Herr Weixlgärtner ließt aber »Seite 290, Zeile 1«
und bedenkt mich daraufhin mit der liebevollen Bemerkung:
»(die Stellen) sind übrigens, was freilich in dieser Biblio-
graphie nicht überrascht, schlecht zitiert«. Im Gegenteil,
ich gebe ganz klar und richtig an, daß die Sätze, die ich
zitiere, auf den Seiten 290, 291, 363, 317 und 318 zu finden
sind. Damit deute ich selbst schon unverhohlen an, daß
ich diese Sätze mir zusammengesucht habe. Ich wollte
eben nur drei Gruppen von Aussagen Dürers nebenein-
ander stellen, die sich widersprechen, die er nie in Ein-
klang gebracht hat und die die größte Sophisterei anderer
nicht in Einklang bringen kann.
Faktische Versehen weist mir Herr Weixlgärtner fünf
nach. Eigentlich sind es nur vier, denn da er doch hier
und da in meine Arbeit geblickt hat, fand er schließlich
den einen Artikel, den er in Abt. C 7 vermißte, leider nach-
träglich noch in Abt. 10, gerade an jener Stelle, wo er hin
gehörte. Aber wenigstens der Verweis, oder wie das auf
wienerisch so schön heißt, der »renvois« fehlt. Also ge-
tadelt konnte dennoch werden.
Von den vier Versehen ist eines eine Unterlassungs-
sünde. Ich habe eine Bücherbesprechung — wohlgemerkt
nicht etwa einen Artikel über Dürer, sondern nur eine
Rezension über eine Dürerarbeit — die Kristeller im »Ar-
chivio storico dell'arte« erscheinen ließ, nicht mit angeführt.
Daß ich alles bewältigt hätte, glaubte ich selbst am wenig-
sten. Das »Archivio« hatte ich vorläufig überhaupt nicht
durchgesehen, da ich an dieser Stelle, wie mir wohl jeder
zugeben wird, auf einen die Mühe entgeltenden Fund von
Aufsätzen u. s. w. über Dürer nicht rechnen durfte.
Die anderen drei »Fehler« bestehen darin, daß ich bei
Angabe von drei Rezensionen (wiederum nur Rezensionen!)
ein falsches Erscheinungsjahr gegeben haben soll. Ich
kann diese Fälle augenblicklich nicht nachprüfen. Ich habe
sie, wie aus meinen einleitenden Worten hervorgeht, nicht
selbst erforscht, sondern von anderer Seite übernommen,
und zwar aus den »Jahresberichten für neuere deutsche
Literaturgeschichte «. Wahrscheinlich wird der sogenannte
Irrtum darin bestehen, daß die Besprechung tatsächlich
z. B. 1892 erschienen ist, aber dem Zeitungsjahr 1893 an-
gehört, gerade wie ein Artikel, der im Oktober 1892 in der
»Kunstchronik« tatsächlich erscheint, eigenlich im Jahrgang
1893 befindlich zu buchen wäre. Wie durchaus kleinlich
solche Einwendungen sind, geht schon einmal daraus her-
vor, daß eine Rezension sich von selbst durch das Er-
scheinungsjahr des besprochenen Buches leicht datieren
und auffinden läßt.
Daß auf Grund dieser vier Fehler Herr Arpad Weixl-
gärtner meine ganze große Arbeit und meine Arbeitsweise
zu verdächtigen sucht, kennzeichnet lediglich die schon von
Herrn von Seidlitz gerügte Art der Besprechungen, die in
den »K. A.« Aufnahme finden: meine »Arbeitsweise« hat
er damit wohl noch nicht »charakterisiert«.
Es gibt zweierlei Rezensenten. Die einen freuen sich
darüber, daß ich die funfunddreißig zunächst liegenden
Zeitschriften mit ihren über sechshundert Bänden gewissen-
haft durchgeackert habe, und sie meiner übrigen, für einen
ersten Versuch großen Bibliographie einverleibt habe. Die
anderen freuen sich darüber, daß sie zufällig etwas aus
einer entlegenen sechsunddreißigsten kennen, das bei mir
fehlt! Herrn Weixlgärtner aber fordere ich auf, mir unter
den vielen hundert Angaben, die ich jenen sechshundert
Bänden oder den selbständigen Büchern entnahm, Unge-
nauigkeiten nachzuweisen. Wenn er nur einen Prozent-
satz von Fehlern nachweisen könnte, dann dürfte er viel-
leicht Bedenken äußern, auch dann wohl noch nicht das
Buch verdammen.
Jeder Laie wird merken, daß mein System, die Zeit-
schriften zu numerieren und stets die Nummer anstatt
des langen Titels anzuführen, nur der Rücksicht entspricht,
die ich der billigen Forderung des Veilegers entgegen-
brachte, bei einem derartig auf kleinen Absatz berechneten
Werk möglichst an Satzkosten zu sparen. Aber auch das
mußte als »Gravamen« (wie es wiederum in Wiener Deutsch
heißt) getadelt werden, trotzdem infolge der Verwendung
von dreierlei Typengraden bei der Nummerierung eine
reichliche Übersichtlichkeit geboten wird, und trotzdem
dieses System bei bibliographischen Werken in England
und Amerika bereits verwendet wird, was Herr Weixl-
gärtner wenigstens wissen sollte, wenn er's nicht weiß.
Meine Arbeit habe ich nicht, wie Herr Weixlgärtner
meint, »mit mehr Vorsicht als Bescheidenheit« einen »Ver-
such« genannt, sondern ich tat das, weil es jedem ein-
sichtigen Menschen für selbstverständlich gilt, daß bei dem
ersten Anhieb eine Bibliographie nie vollkommen werden
kann. Mein Handexemplar des »Versuchs« versehe ich
mit alle den Nachträgen, zu denen ich durch eigene Arbeit
und durch die Freundlichkeit einer allerdings anderen
Klasse von Rezensenten wie Herr Weixlgärtner komme,
in der Hoffnung, daß ich vielleicht nach Jahren bei einer
zweiten Auflage dazu berechtigt sein möge, das Wort »Ver-
such« auf dem Titelblatt fortzulassen.
Für heute möchte ich festgestellt haben, daß Herrn
Arpad Weixlgärtner mein Vorwort mißbehagt und er in
seinem Arger die davon ganz unabhängige Hauptarbeit
durchaus herabsetzen will: daß er kühner Weise mir den
Vorwurf macht, ich zitierte schlecht, während tatsächlich
er selbst in diesem Falle den gröblichsten Lesefehler be-
gangen hat; daß er endlich vierundeinhalb unbedeuten-
der Fehler nachweist, und auf Grund dieser, sowie der
leichtfertigen Redewendung, »es ließen sich leicht noch
mehr nachweisen«, das ganze Werk mit seinen 1307 Titeln
und mehreren tausend Angaben verdammt.
Damit denke ich an der Hand eines einzelnen Bei-
spiels belegt zu haben, was bereits im allgemeinen die
»Kunstchronik« über die Art der Besprechungen in den
Wiener »Kunstgeschichtlichen Anzeigen« gesagt hat.
Prof. Dr. Hans W. Singer.
Graf A. Fr. Schack. Eine ebenso auffällige als
unerklärliche Erscheinung trat bald nach dem Tode des
Grafen A. Fr. Schack, des Gründers der bekannten Privat-
jetzt Kaiserlichen Galerie in München zutage: man bemüht
sich in jeder Weise, in Wort und Schrift, sein Andenken
zu schädigen, sein Verdienst als Sammler der Kunstwerke
und als Gönner derjenigen Künstler, welche seine Galerie
mit ihren Gemälden füllten, zu schmälern, ja sogar ins
Lächerliche zu ziehen. Neuestens wurden nun, gelegent-
lich der Nachrufe und Biographien verstorbener deutscher
Künstler, wieder Stimmen solcher laut, welche die Pflicht
zu haben glauben, alles mögliche Schlimme über den
braven, einfachen Mann zu sagen, welcher sein ganzes
Leben der Pflege des Schönen geweiht hatte. Dem gegen-
über halte ich es für eine Pflicht mitzuteilen, wie Graf
Schack wenigstens mir stets ein nobler Besteller und später,