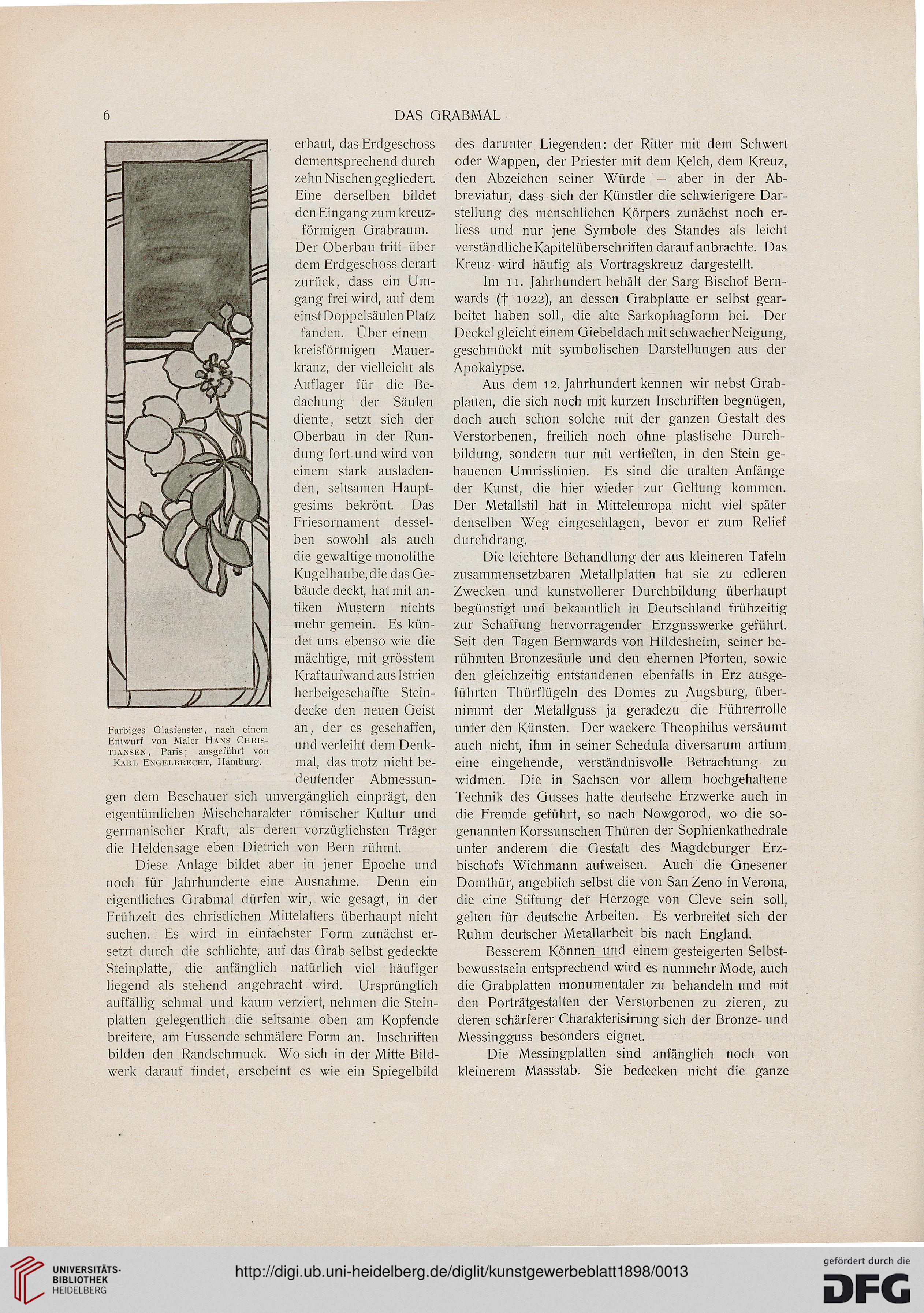DAS GRABMAL
erbaut, das Erdgeschoss
dementsprechend durch
zehn Nischen gegliedert.
Eine derselben bildet
den Eingang zum kreuz-
förmigen Orabraum.
Der Oberbau tritt über
dem Erdgeschoss derart
zurück, dass ein Um-
gang frei wird, auf dem
einst Doppelsäulen Platz
fanden. Ober einem
kreisförmigen Mauer-
kranz, der vielleicht als
Auflager für die Be-
dachung der Säulen
diente, setzt sich der
Oberbau in der Run-
dung fort und wird von
einem stark ausladen-
den, seltsamen Haupt-
gesims bekrönt. Das
Friesornament dessel-
ben sowohl als auch
die gewaltige monolithe
Kugelhaube, die das Ge-
bäude deckt, hat mit an-
tiken Mustern nichts
mehr gemein. Es kün-
det uns ebenso wie die
mächtige, mit grösstem
Kraftaufwand aus Istrien
herbeigeschaffte Stein-
decke den neuen Geist
an, der es geschaffen,
und verleiht dem Denk-
mal, das trotz nicht be-
deutender Abmessun-
gen dem Beschauer sich unvergänglich einprägt, den
eigentümlichen Mischcharakter römischer Kultur und
germanischer Kraft, als deren vorzüglichsten Träger
die Heldensage eben Dietrich von Bern rühmt.
Diese Anlage bildet aber in jener Epoche und
noch für Jahrhunderte eine Ausnahme. Denn ein
eigentliches Grabmal dürfen wir, wie gesagt, in der
Frühzeit des christlichen Mittelalters überhaupt nicht
suchen. Es wird in einfachster Form zunächst er-
setzt durch die schlichte, auf das Grab selbst gedeckte
Steinplatte, die anfänglich natürlich viel häufiger
liegend als stehend angebracht wird. Ursprünglich
auffällig schmal und kaum verziert, nehmen die Stein-
platten gelegentlich die seltsame oben am Kopfende
breitere, am Fussende schmälere Form an. Inschriften
bilden den Randschmuck. Wo sich in der Mitte Bild-
werk darauf findet, erscheint es wie ein Spiegelbild
Farbiges Glasfenster, nach einem
Entwurf von Maler Hans Chkis-
tianskn, Paris; ausgeführt von
Kart, EngeMRECHT, Hamburg.
des darunter Liegenden: der Ritter mit dem Schwert
oder Wappen, der Priester mit dem Kelch, dem Kreuz,
den Abzeichen seiner Würde - - aber in der Ab-
breviatur, dass sich der Künstler die schwierigere Dar-
stellung des menschlichen Körpers zunächst noch er-
liess und nur jene Symbole des Standes als leicht
verständliche Kapitelüberschriften darauf anbrachte. Das
Kreuz wird häufig als Vortragskreuz dargestellt.
Im 11. Jahrhundert behält der Sarg Bischof Bern-
wards (f 1022), an dessen Grabplatte er selbst gear-
beitet haben soll, die alte Sarkophagform bei. Der
Deckel gleicht einem Giebeldach mit schwacher Neigung,
geschmückt mit symbolischen Darstellungen aus der
Apokalypse.
Aus dem 12. Jahrhundert kennen wir nebst Grab-
platten, die sich noch mit kurzen Inschriften begnügen,
doch auch schon solche mit der ganzen Gestalt des
Verstorbenen, freilich noch ohne plastische Durch-
bildung, sondern nur mit vertieften, in den Stein ge-
hauenen Umrisslinien. Es sind die uralten Anfänge
der Kunst, die hier wieder zur Geltung kommen.
Der Metallstil hat in Mitteleuropa nicht viel später
denselben Weg eingeschlagen, bevor er zum Relief
durchdrang.
Die leichtere Behandlung der aus kleineren Tafeln
zusammensetzbaren Metallplatten hat sie zu edleren
Zwecken und kunstvollerer Durchbildung überhaupt
begünstigt und bekanntlich in Deutschland frühzeitig
zur Schaffung hervorragender Erzgusswerke geführt.
Seit den Tagen Bernwards von Hildesheim, seiner be-
rühmten Bronzesäule und den ehernen Pforten, sowie
den gleichzeitig entstandenen ebenfalls in Erz ausge-
führten Thürflügeln des Domes zu Augsburg, über-
nimmt der Metallguss ja geradezu die Führerrolle
unter den Künsten. Der wackere Theophilus versäumt
auch nicht, ihm in seiner Schedula diversarum artium
eine eingehende, verständnisvolle Betrachtung zu
widmen. Die in Sachsen vor allem hochgehaltene
Technik des Gusses hatte deutsche Erzwerke auch in
die Fremde geführt, so nach Nowgorod, wo die so-
genannten Korssunschen Thüren der Sophienkathedrale
unter anderem die Gestalt des Magdeburger Erz-
bischofs Wichmann aufweisen. Auch die Gnesener
Domthür, angeblich selbst die von San Zeno in Verona,
die eine Stiftung der Herzoge von Cleve sein soll,
gelten für deutsche Arbeiten. Es verbreitet sich der
Ruhm deutscher Metallarbeit bis nach England.
Besserem Können und einem gesteigerten Selbst-
bewusstsein entsprechend wird es nunmehr Mode, auch
die Grabplatten monumentaler zu behandeln und mit
den Porträtgestalten der Verstorbenen zu zieren, zu
deren schärferer Charakterisirung sich der Bronze- und
Messingguss besonders eignet.
Die Messingplatten sind anfänglich noch von
kleinerem Massstab. Sie bedecken nicht die ganze
erbaut, das Erdgeschoss
dementsprechend durch
zehn Nischen gegliedert.
Eine derselben bildet
den Eingang zum kreuz-
förmigen Orabraum.
Der Oberbau tritt über
dem Erdgeschoss derart
zurück, dass ein Um-
gang frei wird, auf dem
einst Doppelsäulen Platz
fanden. Ober einem
kreisförmigen Mauer-
kranz, der vielleicht als
Auflager für die Be-
dachung der Säulen
diente, setzt sich der
Oberbau in der Run-
dung fort und wird von
einem stark ausladen-
den, seltsamen Haupt-
gesims bekrönt. Das
Friesornament dessel-
ben sowohl als auch
die gewaltige monolithe
Kugelhaube, die das Ge-
bäude deckt, hat mit an-
tiken Mustern nichts
mehr gemein. Es kün-
det uns ebenso wie die
mächtige, mit grösstem
Kraftaufwand aus Istrien
herbeigeschaffte Stein-
decke den neuen Geist
an, der es geschaffen,
und verleiht dem Denk-
mal, das trotz nicht be-
deutender Abmessun-
gen dem Beschauer sich unvergänglich einprägt, den
eigentümlichen Mischcharakter römischer Kultur und
germanischer Kraft, als deren vorzüglichsten Träger
die Heldensage eben Dietrich von Bern rühmt.
Diese Anlage bildet aber in jener Epoche und
noch für Jahrhunderte eine Ausnahme. Denn ein
eigentliches Grabmal dürfen wir, wie gesagt, in der
Frühzeit des christlichen Mittelalters überhaupt nicht
suchen. Es wird in einfachster Form zunächst er-
setzt durch die schlichte, auf das Grab selbst gedeckte
Steinplatte, die anfänglich natürlich viel häufiger
liegend als stehend angebracht wird. Ursprünglich
auffällig schmal und kaum verziert, nehmen die Stein-
platten gelegentlich die seltsame oben am Kopfende
breitere, am Fussende schmälere Form an. Inschriften
bilden den Randschmuck. Wo sich in der Mitte Bild-
werk darauf findet, erscheint es wie ein Spiegelbild
Farbiges Glasfenster, nach einem
Entwurf von Maler Hans Chkis-
tianskn, Paris; ausgeführt von
Kart, EngeMRECHT, Hamburg.
des darunter Liegenden: der Ritter mit dem Schwert
oder Wappen, der Priester mit dem Kelch, dem Kreuz,
den Abzeichen seiner Würde - - aber in der Ab-
breviatur, dass sich der Künstler die schwierigere Dar-
stellung des menschlichen Körpers zunächst noch er-
liess und nur jene Symbole des Standes als leicht
verständliche Kapitelüberschriften darauf anbrachte. Das
Kreuz wird häufig als Vortragskreuz dargestellt.
Im 11. Jahrhundert behält der Sarg Bischof Bern-
wards (f 1022), an dessen Grabplatte er selbst gear-
beitet haben soll, die alte Sarkophagform bei. Der
Deckel gleicht einem Giebeldach mit schwacher Neigung,
geschmückt mit symbolischen Darstellungen aus der
Apokalypse.
Aus dem 12. Jahrhundert kennen wir nebst Grab-
platten, die sich noch mit kurzen Inschriften begnügen,
doch auch schon solche mit der ganzen Gestalt des
Verstorbenen, freilich noch ohne plastische Durch-
bildung, sondern nur mit vertieften, in den Stein ge-
hauenen Umrisslinien. Es sind die uralten Anfänge
der Kunst, die hier wieder zur Geltung kommen.
Der Metallstil hat in Mitteleuropa nicht viel später
denselben Weg eingeschlagen, bevor er zum Relief
durchdrang.
Die leichtere Behandlung der aus kleineren Tafeln
zusammensetzbaren Metallplatten hat sie zu edleren
Zwecken und kunstvollerer Durchbildung überhaupt
begünstigt und bekanntlich in Deutschland frühzeitig
zur Schaffung hervorragender Erzgusswerke geführt.
Seit den Tagen Bernwards von Hildesheim, seiner be-
rühmten Bronzesäule und den ehernen Pforten, sowie
den gleichzeitig entstandenen ebenfalls in Erz ausge-
führten Thürflügeln des Domes zu Augsburg, über-
nimmt der Metallguss ja geradezu die Führerrolle
unter den Künsten. Der wackere Theophilus versäumt
auch nicht, ihm in seiner Schedula diversarum artium
eine eingehende, verständnisvolle Betrachtung zu
widmen. Die in Sachsen vor allem hochgehaltene
Technik des Gusses hatte deutsche Erzwerke auch in
die Fremde geführt, so nach Nowgorod, wo die so-
genannten Korssunschen Thüren der Sophienkathedrale
unter anderem die Gestalt des Magdeburger Erz-
bischofs Wichmann aufweisen. Auch die Gnesener
Domthür, angeblich selbst die von San Zeno in Verona,
die eine Stiftung der Herzoge von Cleve sein soll,
gelten für deutsche Arbeiten. Es verbreitet sich der
Ruhm deutscher Metallarbeit bis nach England.
Besserem Können und einem gesteigerten Selbst-
bewusstsein entsprechend wird es nunmehr Mode, auch
die Grabplatten monumentaler zu behandeln und mit
den Porträtgestalten der Verstorbenen zu zieren, zu
deren schärferer Charakterisirung sich der Bronze- und
Messingguss besonders eignet.
Die Messingplatten sind anfänglich noch von
kleinerem Massstab. Sie bedecken nicht die ganze