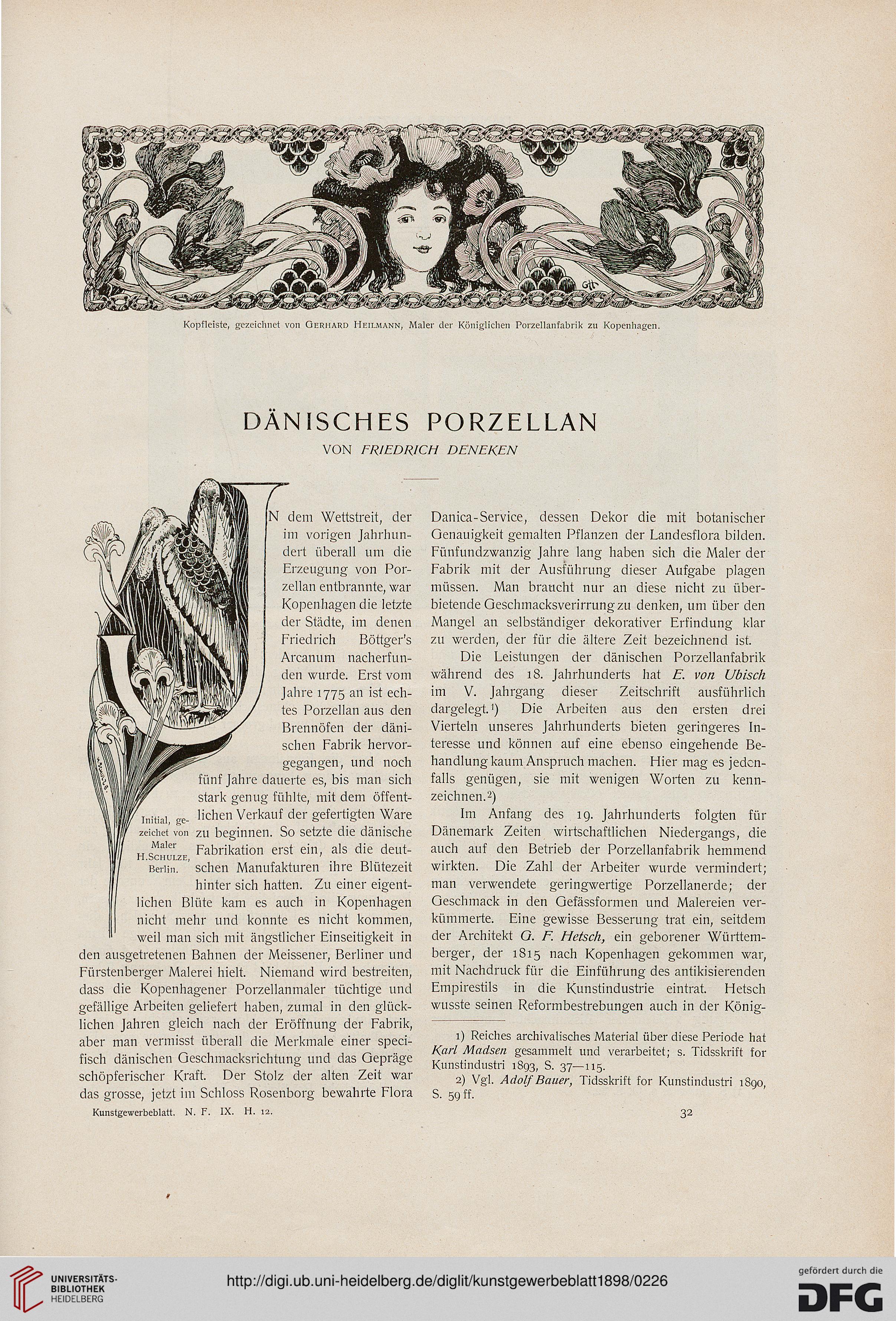Kopfleiste, gezeichnet von Gerhard Heilmann, Maler der Königlichen Porzellanfabrik zu Kopenhagen.
DÄNISCHES PORZELLAN
VON FRIEDRICH DENEREN
N dem Wettstreit, der
im vorigen Jahrhun-
dert überall um die
Erzeugung von Por-
zellan entbrannte, war
Kopenhagen die letzte
der Städte, im denen
Tiedrich Böttger's
Arcanum nacherfun-
den wurde. Erst vom
Jahre 1775 an ist ech-
tes Porzellan aus den
Brennöfen der däni-
schen Fabrik hervor-
gegangen, und noch
fünf Jahre dauerte es, bis man sich
stark genug fühlte, mit dem öffent-
e_ liehen Verkauf der gefertigten Ware
zeichet von zu beginnen. So setzte die dänische
Maier Fabrikation erst ein, als die deut-
H.Schulze,
Berlin, sehen Manufakturen ihre Blütezeit
hinter sich hatten. Zu einer eigent-
lichen Blüte kam es auch in Kopenhagen
nicht mehr und konnte es nicht kommen,
weil man sich mit ängstlicher Einseitigkeit in
den ausgetretenen Bahnen der Meissener, Berliner und
Fürstenberger Malerei hielt. Niemand wird bestreiten,
dass die Kopenhagener Porzellanmaler tüchtige und
gefällige Arbeiten geliefert haben, zumal in den glück-
lichen Jahren gleich nach der Eröffnung der Fabrik,
aber man vermisst überall die Merkmale einer speci-
fisch dänischen Geschmacksrichtung und das Gepräge
schöpferischer Kraft. Der Stolz der alten Zeit war
das grosse, jetzt im Schloss Rosenborg bewahrte Flora
Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 12.
Danica-Service, dessen Dekor die mit botanischer
Genauigkeit gemalten Pflanzen der Landesflora bilden.
Fünfundzwanzig Jahre lang haben sich die Maler der
Fabrik mit der Ausführung dieser Aufgabe plagen
müssen. Man braucht nur an diese nicht zu über-
bietende Geschmacksverirrung zu denken, um über den
Mangel an selbständiger dekorativer Erfindung klar
zu werden, der für die ältere Zeit bezeichnend ist.
Die Leistungen der dänischen Porzellanfabrik
während des 18. Jahrhunderts hat E. von Ubisch
im V. Jahrgang dieser Zeitschrift ausführlich
dargelegt.1) Die Arbeiten aus den ersten drei
Vierteln unseres Jahrhunderts bieten geringeres In-
teresse und können auf eine ebenso eingehende Be-
handlung kaum Anspruch machen. Hier mag es jeden-
falls genügen, sie mit wenigen Worten zu kenn-
zeichnen.-)
Im Anfang des 19. Jahrhunderts folgten für
Dänemark Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs, die
auch auf den Betrieb der Porzellanfabrik hemmend
wirkten. Die Zahl der Arbeiter wurde vermindert;
man verwendete geringwertige Porzellanerde; der
Geschmack in den Gefässformen und Malereien ver-
kümmerte. Eine gewisse Besserung trat ein, seitdem
der Architekt O. F. Hetsch, ein geborener Württem-
berger, der 1815 nach Kopenhagen gekommen war,
mit Nachdruck für die Einführung des antikisierenden
Empirestils in die Kunstindustrie eintrat. Hetsch
wusste seinen Reformbestrebungen auch in der König-
1) Reiches archivalisches Material über diese Periode hat
Rad Madsen gesammelt und verarbeitet; s. Tidsskrift for
Kunstindustri 1893, S. 37—115.
2) Vgl Adolf Bauer, Tidsskrift for Kunstindustri 1890,
S. 59 ff-
32
DÄNISCHES PORZELLAN
VON FRIEDRICH DENEREN
N dem Wettstreit, der
im vorigen Jahrhun-
dert überall um die
Erzeugung von Por-
zellan entbrannte, war
Kopenhagen die letzte
der Städte, im denen
Tiedrich Böttger's
Arcanum nacherfun-
den wurde. Erst vom
Jahre 1775 an ist ech-
tes Porzellan aus den
Brennöfen der däni-
schen Fabrik hervor-
gegangen, und noch
fünf Jahre dauerte es, bis man sich
stark genug fühlte, mit dem öffent-
e_ liehen Verkauf der gefertigten Ware
zeichet von zu beginnen. So setzte die dänische
Maier Fabrikation erst ein, als die deut-
H.Schulze,
Berlin, sehen Manufakturen ihre Blütezeit
hinter sich hatten. Zu einer eigent-
lichen Blüte kam es auch in Kopenhagen
nicht mehr und konnte es nicht kommen,
weil man sich mit ängstlicher Einseitigkeit in
den ausgetretenen Bahnen der Meissener, Berliner und
Fürstenberger Malerei hielt. Niemand wird bestreiten,
dass die Kopenhagener Porzellanmaler tüchtige und
gefällige Arbeiten geliefert haben, zumal in den glück-
lichen Jahren gleich nach der Eröffnung der Fabrik,
aber man vermisst überall die Merkmale einer speci-
fisch dänischen Geschmacksrichtung und das Gepräge
schöpferischer Kraft. Der Stolz der alten Zeit war
das grosse, jetzt im Schloss Rosenborg bewahrte Flora
Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 12.
Danica-Service, dessen Dekor die mit botanischer
Genauigkeit gemalten Pflanzen der Landesflora bilden.
Fünfundzwanzig Jahre lang haben sich die Maler der
Fabrik mit der Ausführung dieser Aufgabe plagen
müssen. Man braucht nur an diese nicht zu über-
bietende Geschmacksverirrung zu denken, um über den
Mangel an selbständiger dekorativer Erfindung klar
zu werden, der für die ältere Zeit bezeichnend ist.
Die Leistungen der dänischen Porzellanfabrik
während des 18. Jahrhunderts hat E. von Ubisch
im V. Jahrgang dieser Zeitschrift ausführlich
dargelegt.1) Die Arbeiten aus den ersten drei
Vierteln unseres Jahrhunderts bieten geringeres In-
teresse und können auf eine ebenso eingehende Be-
handlung kaum Anspruch machen. Hier mag es jeden-
falls genügen, sie mit wenigen Worten zu kenn-
zeichnen.-)
Im Anfang des 19. Jahrhunderts folgten für
Dänemark Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs, die
auch auf den Betrieb der Porzellanfabrik hemmend
wirkten. Die Zahl der Arbeiter wurde vermindert;
man verwendete geringwertige Porzellanerde; der
Geschmack in den Gefässformen und Malereien ver-
kümmerte. Eine gewisse Besserung trat ein, seitdem
der Architekt O. F. Hetsch, ein geborener Württem-
berger, der 1815 nach Kopenhagen gekommen war,
mit Nachdruck für die Einführung des antikisierenden
Empirestils in die Kunstindustrie eintrat. Hetsch
wusste seinen Reformbestrebungen auch in der König-
1) Reiches archivalisches Material über diese Periode hat
Rad Madsen gesammelt und verarbeitet; s. Tidsskrift for
Kunstindustri 1893, S. 37—115.
2) Vgl Adolf Bauer, Tidsskrift for Kunstindustri 1890,
S. 59 ff-
32