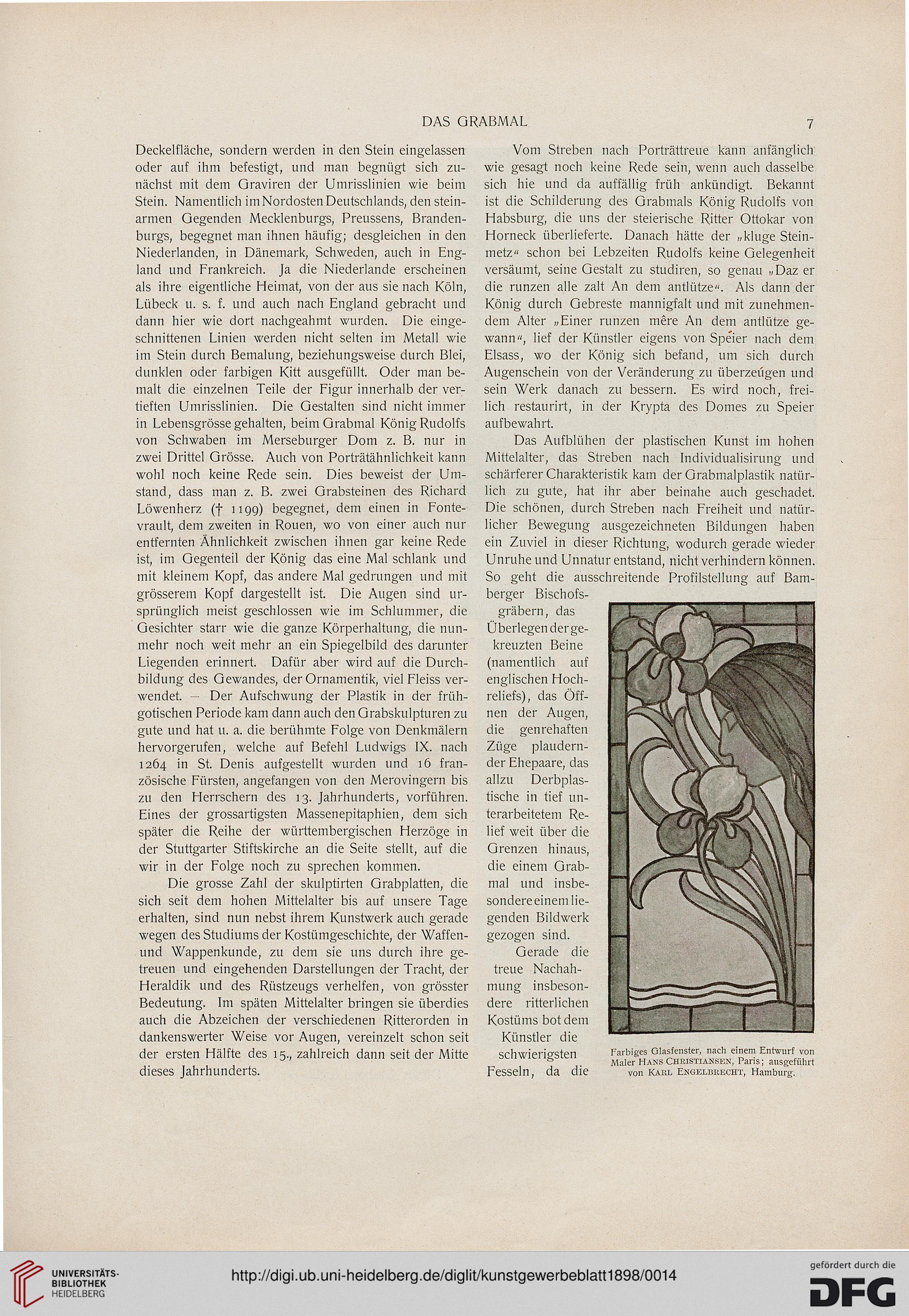DAS GRABMAL
Deckelfläche, sondern werden in den Stein eingelassen
oder auf ihm befestigt, und man begnügt sich zu-
nächst mit dem Graviren der Umrisslinien wie beim
Stein. Namentlich im Nordosten Deutschlands, den stein-
armen Gegenden Mecklenburgs, Preussens, Branden-
burgs, begegnet man ihnen häufig; desgleichen in den
Niederlanden, in Dänemark, Schweden, auch in Eng-
land und Frankreich. Ja die Niederlande erscheinen
als ihre eigentliche Heimat, von der aus sie nach Köln,
Lübeck u. s. f. und auch nach England gebracht und
dann hier wie dort nachgeahmt wurden. Die einge-
schnittenen Linien werden nicht selten im Metall wie
im Stein durch Bemalung, beziehungsweise durch Blei,
dunklen oder farbigen Kitt ausgefüllt. Oder man be-
malt die einzelnen Teile der Figur innerhalb der ver-
tieften Umrisslinien. Die Gestalten sind nicht immer
in Lebensgrösse gehalten, beim Grabmal König Rudolfs
von Schwaben im Merseburger Dom z. B. nur in
zwei Drittel Grösse. Auch von Porträtähnlichkeit kann
wohl noch keine Rede sein. Dies beweist der Um-
stand, dass man z. B. zwei Grabsteinen des Richard
Löwenherz (t 1199) begegnet, dem einen in Fonte-
vrault, dem zweiten in Rouen, wo von einer auch nur
entfernten Ähnlichkeit zwischen ihnen gar keine Rede
ist, im Gegenteil der König das eine Mal schlank und
mit kleinem Kopf, das andere Mal gedrungen und mit
grösserem Kopf dargestellt ist. Die Augen sind ur-
sprünglich meist geschlossen wie im Schlummer, die
Gesichter starr wie die ganze Körperhaltung, die nun-
mehr noch weit mehr an ein Spiegelbild des darunter
Liegenden erinnert. Dafür aber wird auf die Durch-
bildung des Gewandes, der Ornamentik, viel Fleiss ver-
wendet. — Der Aufschwung der Plastik in der früh-
gotischen Periode kam dann auch den Grabskulpturen zu
gute und hat u. a. die berühmte Folge von Denkmälern
hervorgerufen, welche auf Befehl Ludwigs IX. nach
1264 in St. Denis aufgestellt wurden und 16 fran-
zösische Fürsten, angefangen von den Merovingern bis
zu den Herrschern des 13. Jahrhunderts, vorführen.
Eines der grossartigsten Massenepitaphien, dem sich
später die Reihe der württembergischen Herzöge in
der Stuttgarter Stiftskirche an die Seite stellt, auf die
wir in der Folge noch zu sprechen kommen.
Die grosse Zahl der skulptirten Grabplatten, die
sich seit dem hohen Mittelalter bis auf unsere Tage
erhalten, sind nun nebst ihrem Kunstwerk auch gerade
wegen des Studiums der Kostümgeschichte, der Waffen-
und Wappenkunde, zu dem sie uns durch ihre ge-
treuen und eingehenden Darstellungen der Tracht, der
Heraldik und des Rüstzeugs verhelfen, von grösster
Bedeutung. Im späten Mittelalter bringen sie überdies
auch die Abzeichen der verschiedenen Ritterorden in
dankenswerter Weise vor Augen, vereinzelt schon seit
der ersten Hälfte des 15., zahlreich dann seit der Mitte
dieses Jahrhunderts.
Vom Streben nach Porträttreue kann anfänglich
wie gesagt noch keine Rede sein, wenn auch dasselbe
sich hie und da auffällig früh ankündigt. Bekannt
ist die Schilderung des Grabmals König Rudolfs von
Habsburg, die uns der steierische Ritter Ottokar von
Horneck überlieferte. Danach hätte der „kluge Stein-
metz" schon bei Lebzeiten Rudolfs keine Gelegenheit
versäumt, seine Gestalt zu studircn, so genau „Daz er
die runzen alle zalt An dem antlütze". Als dann der
König durch Gebreste mannigfalt und mit zunehmen-
dem Alter „Einer runzen mere An dem antlütze ge-
wann«, lief der Künstler eigens von Speier nach dem
Elsass, wo der König sich befand, um sich durch
Augenschein von der Veränderung zu überzeugen und
sein Werk danach zu bessern. Es wird noch, frei-
lich restaurirt, in der Krypta des Domes zu Speier
auf bewahrt.
Das Aufblühen der plastischen Kunst im hohen
Mittelalter, das Streben nach Individualisirung und
schärferer Charakteristik kam der Grabmalplastik natür-
lich zu gute, hat ihr aber beinahe auch geschadet.
Die schönen, durch Streben nach Freiheit und natür-
licher Bewegung ausgezeichneten Bildungen haben
ein Zuviel in dieser Richtung, wodurch gerade wieder
Unruhe und Unnatur entstand, nicht verhindern können.
So geht die ausschreitende Profilstellung auf Bam-
berger Bischofs- ____________________
gräbern, das "*" f f$*c^
Überlegen der ge-
kreuzten Beine
(namentlich auf
englischen Hoch-
reliefs), das Öff-
nen der Augen,
die genrehaften
Züge plaudern-
der Ehepaare, das
allzu Derbplas-
tische in tief un-
terarbeitetem Re-
lief weit über die
Grenzen hinaus,
die einem Grab-
mal und insbe-
sondereeinem lie-
genden Bildwerk
gezogen sind.
Gerade die
treue Nachah-
mung insbeson-
dere ritterlichen
Kostüms bot dem
Künstler die
srhwipriosten Farbiges Olasfenster, nach einem Entwurf von
ö Maler HANS Christiansen, Paris; ausgeführt
Fesseln, da die von Karl Engelbrecht, Hamburg.
Deckelfläche, sondern werden in den Stein eingelassen
oder auf ihm befestigt, und man begnügt sich zu-
nächst mit dem Graviren der Umrisslinien wie beim
Stein. Namentlich im Nordosten Deutschlands, den stein-
armen Gegenden Mecklenburgs, Preussens, Branden-
burgs, begegnet man ihnen häufig; desgleichen in den
Niederlanden, in Dänemark, Schweden, auch in Eng-
land und Frankreich. Ja die Niederlande erscheinen
als ihre eigentliche Heimat, von der aus sie nach Köln,
Lübeck u. s. f. und auch nach England gebracht und
dann hier wie dort nachgeahmt wurden. Die einge-
schnittenen Linien werden nicht selten im Metall wie
im Stein durch Bemalung, beziehungsweise durch Blei,
dunklen oder farbigen Kitt ausgefüllt. Oder man be-
malt die einzelnen Teile der Figur innerhalb der ver-
tieften Umrisslinien. Die Gestalten sind nicht immer
in Lebensgrösse gehalten, beim Grabmal König Rudolfs
von Schwaben im Merseburger Dom z. B. nur in
zwei Drittel Grösse. Auch von Porträtähnlichkeit kann
wohl noch keine Rede sein. Dies beweist der Um-
stand, dass man z. B. zwei Grabsteinen des Richard
Löwenherz (t 1199) begegnet, dem einen in Fonte-
vrault, dem zweiten in Rouen, wo von einer auch nur
entfernten Ähnlichkeit zwischen ihnen gar keine Rede
ist, im Gegenteil der König das eine Mal schlank und
mit kleinem Kopf, das andere Mal gedrungen und mit
grösserem Kopf dargestellt ist. Die Augen sind ur-
sprünglich meist geschlossen wie im Schlummer, die
Gesichter starr wie die ganze Körperhaltung, die nun-
mehr noch weit mehr an ein Spiegelbild des darunter
Liegenden erinnert. Dafür aber wird auf die Durch-
bildung des Gewandes, der Ornamentik, viel Fleiss ver-
wendet. — Der Aufschwung der Plastik in der früh-
gotischen Periode kam dann auch den Grabskulpturen zu
gute und hat u. a. die berühmte Folge von Denkmälern
hervorgerufen, welche auf Befehl Ludwigs IX. nach
1264 in St. Denis aufgestellt wurden und 16 fran-
zösische Fürsten, angefangen von den Merovingern bis
zu den Herrschern des 13. Jahrhunderts, vorführen.
Eines der grossartigsten Massenepitaphien, dem sich
später die Reihe der württembergischen Herzöge in
der Stuttgarter Stiftskirche an die Seite stellt, auf die
wir in der Folge noch zu sprechen kommen.
Die grosse Zahl der skulptirten Grabplatten, die
sich seit dem hohen Mittelalter bis auf unsere Tage
erhalten, sind nun nebst ihrem Kunstwerk auch gerade
wegen des Studiums der Kostümgeschichte, der Waffen-
und Wappenkunde, zu dem sie uns durch ihre ge-
treuen und eingehenden Darstellungen der Tracht, der
Heraldik und des Rüstzeugs verhelfen, von grösster
Bedeutung. Im späten Mittelalter bringen sie überdies
auch die Abzeichen der verschiedenen Ritterorden in
dankenswerter Weise vor Augen, vereinzelt schon seit
der ersten Hälfte des 15., zahlreich dann seit der Mitte
dieses Jahrhunderts.
Vom Streben nach Porträttreue kann anfänglich
wie gesagt noch keine Rede sein, wenn auch dasselbe
sich hie und da auffällig früh ankündigt. Bekannt
ist die Schilderung des Grabmals König Rudolfs von
Habsburg, die uns der steierische Ritter Ottokar von
Horneck überlieferte. Danach hätte der „kluge Stein-
metz" schon bei Lebzeiten Rudolfs keine Gelegenheit
versäumt, seine Gestalt zu studircn, so genau „Daz er
die runzen alle zalt An dem antlütze". Als dann der
König durch Gebreste mannigfalt und mit zunehmen-
dem Alter „Einer runzen mere An dem antlütze ge-
wann«, lief der Künstler eigens von Speier nach dem
Elsass, wo der König sich befand, um sich durch
Augenschein von der Veränderung zu überzeugen und
sein Werk danach zu bessern. Es wird noch, frei-
lich restaurirt, in der Krypta des Domes zu Speier
auf bewahrt.
Das Aufblühen der plastischen Kunst im hohen
Mittelalter, das Streben nach Individualisirung und
schärferer Charakteristik kam der Grabmalplastik natür-
lich zu gute, hat ihr aber beinahe auch geschadet.
Die schönen, durch Streben nach Freiheit und natür-
licher Bewegung ausgezeichneten Bildungen haben
ein Zuviel in dieser Richtung, wodurch gerade wieder
Unruhe und Unnatur entstand, nicht verhindern können.
So geht die ausschreitende Profilstellung auf Bam-
berger Bischofs- ____________________
gräbern, das "*" f f$*c^
Überlegen der ge-
kreuzten Beine
(namentlich auf
englischen Hoch-
reliefs), das Öff-
nen der Augen,
die genrehaften
Züge plaudern-
der Ehepaare, das
allzu Derbplas-
tische in tief un-
terarbeitetem Re-
lief weit über die
Grenzen hinaus,
die einem Grab-
mal und insbe-
sondereeinem lie-
genden Bildwerk
gezogen sind.
Gerade die
treue Nachah-
mung insbeson-
dere ritterlichen
Kostüms bot dem
Künstler die
srhwipriosten Farbiges Olasfenster, nach einem Entwurf von
ö Maler HANS Christiansen, Paris; ausgeführt
Fesseln, da die von Karl Engelbrecht, Hamburg.