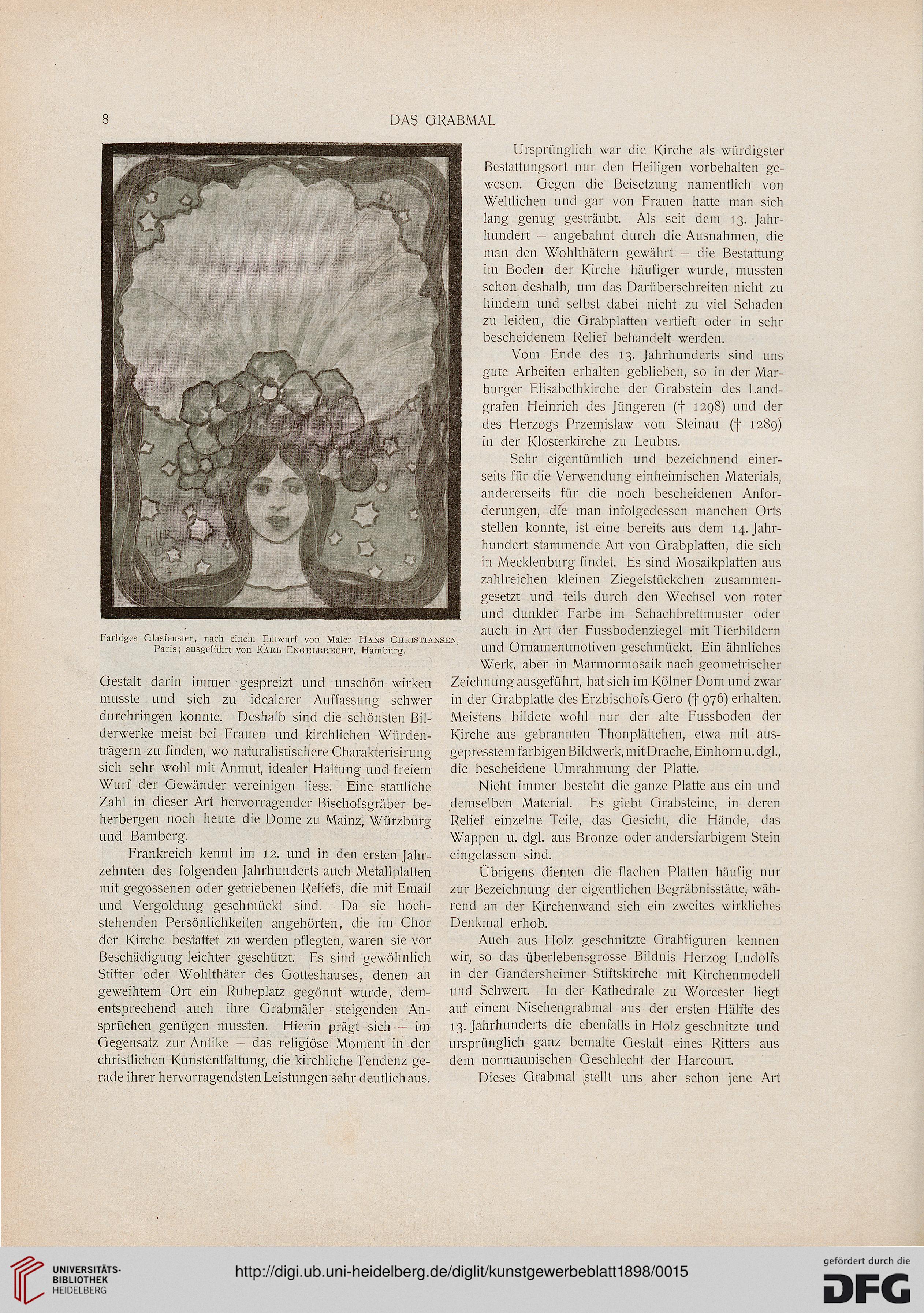DAS GRABMAL
Farbiges Glasfenster, nach einem Entwurf von Maler Hams Chüisteansen,
Paris; ausgeführt von KAKL Ejtc-BLBREOHT, Hamburg.
Gestalt darin immer gespreizt und unschön wirken
musste und sich zu idealerer Auffassung schwer
durchringen konnte. Deshalb sind die schönsten Bil-
derwerke meist bei Frauen und kirchlichen Würden-
trägern zu finden, wo naturalistischere Charakterisirung
sich sehr wohl mit Anmut, idealer Haltung und freiem
Wurf der Gewänder vereinigen liess. Eine stattliche
Zahl in dieser Art hervorragender Bischofsgräber be-
herbergen noch heute die Dome zu Mainz, Würzburg
und Bamberg.
Frankreich kennt im 12. und in den ersten Jahr-
zehnten des folgenden Jahrhunderts auch Metallplatten
mit gegossenen oder getriebenen Reliefs, die mit Email
und Vergoldung geschmückt sind. Da sie hoch-
stehenden Persönlichkeiten angehörten, die im Chor
der Kirche bestattet zu werden pflegten, waren sie vor
Beschädigung leichter geschützt. Es sind gewöhnlich
Stifter oder Wohlthäter des Gotteshauses, denen an
geweihtem Ort ein Ruheplatz gegönnt wurde, dem-
entsprechend auch ihre Grabmäler steigenden An-
sprüchen genügen mussten. Hierin prägt sich — im
Gegensatz zur Antike - das religiöse Moment in der
christlichen Kunstentfaltung, die kirchliche Tendenz ge-
rade ihrer hervorragendsten Leistungen sehr deutlich aus.
Ursprünglich war die Kirche als würdigster
Bestattungsort nur den Heiligen vorbehalten ge-
wesen. Gegen die Beisetzung namentlich von
Weltlichen und gar von Frauen hatte man sich
lang genug gesträubt. Als seit dem 13. Jahr-
hundert — angebahnt durch die Ausnahmen, die
man den Wohlthätern gewährt — die Bestattung
im Boden der Kirche häufiger wurde, mussten
schon deshalb, um das Darüberschreiten nicht zu
hindern und selbst dabei nicht zu viel Schaden
zu leiden, die Grabplatten vertieft oder in sehr
bescheidenem Relief behandelt werden.
Vom Ende des 13. Jahrhunderts sind uns
gute Arbeiten erhalten geblieben, so in der Mar-
burger Elisabethkirche der Grabstein des Land-
grafen Heinrich des Jüngeren (f 1298) und der
des Herzogs Przemislaw von Steinau (f 1289)
in der Klosterkirche zu Leubus.
Sehr eigentümlich und bezeichnend einer-
seits für die Verwendung einheimischen Materials,
andererseits für die noch bescheidenen Anfor-
derungen, die man infolgedessen manchen Orts
stellen konnte, ist eine bereits aus dem 14. Jahr-
hundert stammende Art von Grabplatten, die sich
in Mecklenburg findet. Es sind Mosaikplatten aus
zahlreichen kleinen Ziegelstückchen zusammen-
gesetzt und teils durch den Wechsel von roter
und dunkler Farbe im Schachbrettmuster oder
auch in Art der Fussbodenziegel mit Tierbildern
und Ornamentmotiven geschmückt. Ein ähnliches
Werk, aber in Marmormosaik nach geometrischer
Zeichnung ausgeführt, hat sich im Kölner Dom und zwar
in der Grabplatte des Erzbischofs Gero (f 976) erhalten.
Meistens bildete wohl nur der alte Fussboden der
Kirche aus gebrannten Thonplättchen, etwa mit aus-
gepresstem farbigen Bildwerk, mit Drache, Einhorn u.dgl.,
die bescheidene Umrahmung der Platte.
Nicht immer besteht die ganze Platte aus ein und
demselben Material. Es giebt Grabsteine, in deren
Relief einzelne Teile, das Gesicht, die Hände, das
Wappen u. dgl. aus Bronze oder andersfarbigem Stein
eingelassen sind.
Übrigens dienten die flachen Platten häufig nur
zur Bezeichnung der eigentlichen Begräbnisstätte, wäh-
rend an der Kirchenwand sich ein zweites wirkliches
Denkmal erhob.
Auch aus Holz geschnitzte Grabfiguren kennen
wir, so das überlebensgrosse Bildnis Herzog Ludolfs
in der Gandersheimer Stiftskirche mit Kirchenmodell
und Schwert. In der Kathedrale zu Worcester liegt
auf einem Nischengrabmal aus der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts die ebenfalls in Holz geschnitzte und
ursprünglich ganz bemalte Gestalt eines Ritters aus
dem normannischen Geschlecht der Harcourt.
Dieses Grabmal stellt uns aber schon jene Art