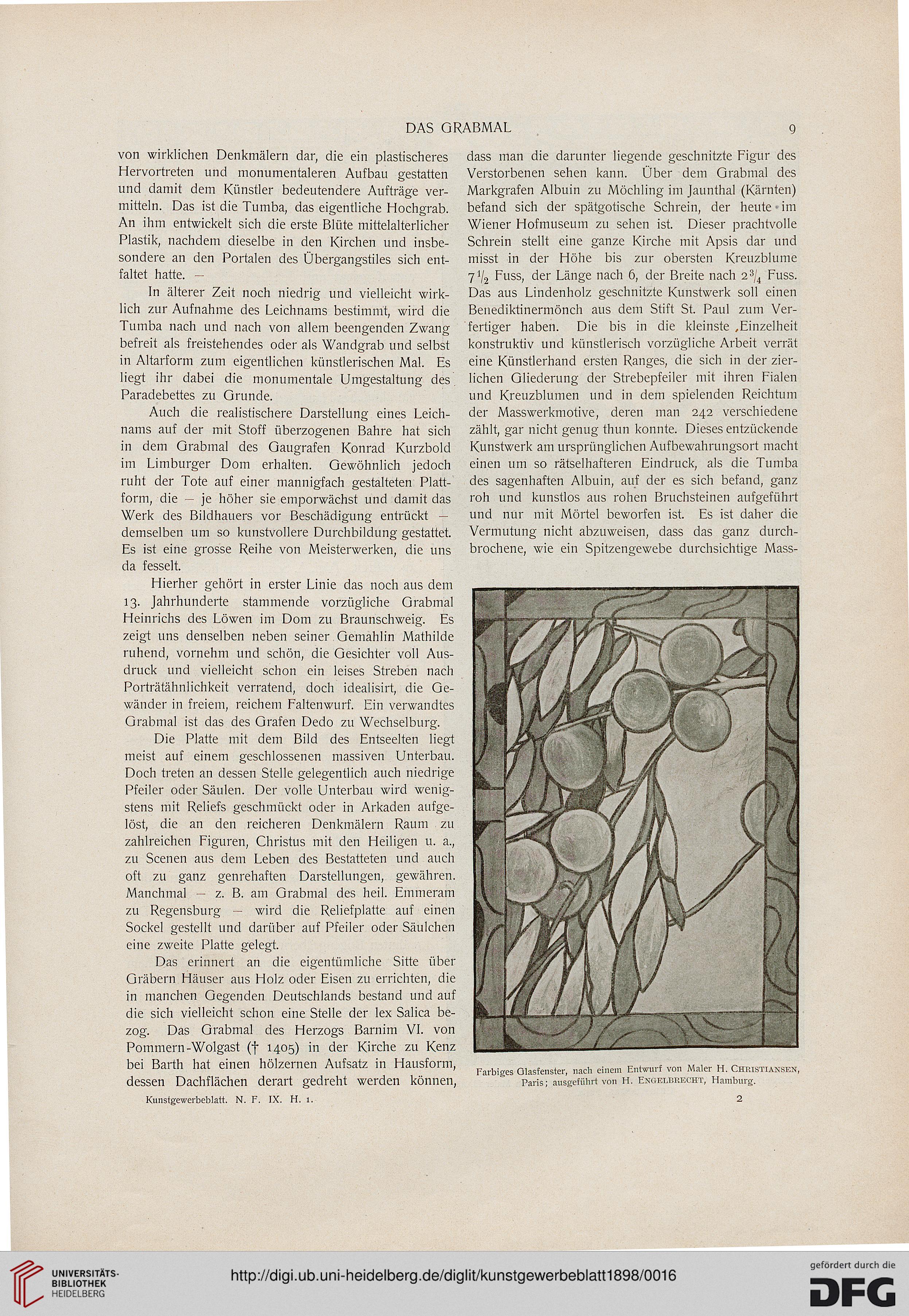DAS GRABMAL
von wirklichen Denkmälern dar, die ein plastischeres
Hervortreten und monumentaleren Aufbau gestatten
und damit dem Künstler bedeutendere Aufträge ver-
mitteln. Das ist die Tumba, das eigentliche Hochgrab.
An ihm entwickelt sich die erste Blüte mittelalterlicher
Plastik, nachdem dieselbe in den Kirchen und insbe-
sondere an den Portalen des Übergangstiles sich ent-
faltet hatte. -
In älterer Zeit noch niedrig und vielleicht wirk-
lich zur Aufnahme des Leichnams bestimmt, wird die
Tumba nach und nach von allem beengenden Zwang
befreit als freistehendes oder als Wandgrab und selbst
in Altarform zum eigentlichen künstlerischen Mal. Es
liegt ihr dabei die monumentale Umgestaltung des
Paradebettes zu Grunde.
Auch die realistischere Darstellung eines Leich-
nams auf der mit Stoff überzogenen Bahre hat sich
in dem Grabmal des Gaugrafen Konrad Kurzbold
im Limburger Dom erhalten. Gewöhnlich jedoch
ruht der Tote auf einer mannigfach gestalteten Platt-
form, die — je höher sie emporwächst und damit das
Werk des Bildhauers vor Beschädigung entrückt -
demselben um so kunstvollere Durchbildung gestattet.
Es ist eine grosse Reihe von Meisterwerken, die uns
da fesselt.
Hierher gehört in erster Linie das noch aus dem
13. Jahrhunderte stammende vorzügliche Grabmal
Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig. Es
zeigt uns denselben neben seiner Gemahlin Mathilde
ruhend, vornehm und schön, die Gesichter voll Aus-
druck und vielleicht schon ein leises Streben nach
Porträtähnlichkeit verratend, doch idealisirt, die Ge-
wänder in freiem, reichem Faltenwurf. Ein verwandtes
Grabmal ist das des Grafen Dedo zu Wechselburg.
Die Platte mit dem Bild des Entseelten liegt
meist auf einem geschlossenen massiven Unterbau.
Doch treten an dessen Stelle gelegentlich auch niedrige
Pfeiler oder Säulen. Der volle Unterbau wird wenig-
stens mit Reliefs geschmückt oder in Arkaden aufge-
löst, die an den reicheren Denkmälern Raum zu
zahlreichen Figuren, Christus mit den Heiligen u. a.,
zu Scenen aus dem Leben des Bestatteten und auch
oft zu ganz genrehaften Darstellungen, gewähren.
Manchmal -- z. B. am Grabmal des heil. Emmeram
zu Regensburg — wird die Reliefplatte auf einen
Sockel gestellt und darüber auf Pfeiler oder Säulchen
eine zweite Platte gelegt.
Das erinnert an die eigentümliche Sitte über
Gräbern Häuser aus Holz oder Eisen zu errichten, die
in manchen Gegenden Deutschlands bestand und auf
die sich vielleicht schon eine Stelle der lex Salica be-
zog. Das Grabmal des Herzogs Barnim VI. von
Pommern-Wolgast (f 1405) in der Kirche zu Kenz
bei Barth hat einen hölzernen Aufsatz in Hausform,
dessen Dachflächen derart gedreht werden können,
Kunstgeverbeblatt. N. F. IX. H. 1.
dass man die darunter liegende geschnitzte Figur des
Verstorbenen sehen kann. Über dem Grabmal des
Markgrafen Albuin zu Möchling im Jaunthal (Kärnten)
befand sich der spätgotische Schrein, der heute • im
Wiener Hofmuseum zu sehen ist. Dieser prachtvolle
Schrein stellt eine ganze Kirche mit Apsis dar und
misst in der Höhe bis zur obersten Kreuzblume
7J/2 Fuss, der Länge nach 6, der Breite nach 23/4 Fuss.
Das aus Lindenholz geschnitzte Kunstwerk soll einen
Benediktinermönch aus dem Stift St. Paul zum Ver-
fertiger haben. Die bis in die kleinste ,Einzelheit
konstruktiv und künstlerisch vorzügliche Arbeit verrät
eine Künstlerhand ersten Ranges, die sich in der zier-
lichen Gliederung der Strebepfeiler mit ihren Fialen
und Kreuzblumen und in dem spielenden Reichtum
der Masswerkmotive, deren man 242 verschiedene
zählt, gar nicht genug thun konnte. Dieses entzückende
Kunstwerk am ursprünglichen Aufbewahrungsort macht
einen um so rätselhafteren Eindruck, als die Tumba
des sagenhaften Albuin, auf der es sich befand, ganz
roh und kunstlos aus rohen Bruchsteinen aufgeführt
und nur mit Mörtel beworfen ist. Es ist daher die
Vermutung nicht abzuweisen, dass das ganz durch-
brochene, wie ein Spitzengewebe durchsichtige Mass-
Farbiges Glasfenster, nach einem Entwurf von Maler H. CHRISTIANSEN,
Paris; ausgeführt von H. Engeltsrecht, Hamburg.
von wirklichen Denkmälern dar, die ein plastischeres
Hervortreten und monumentaleren Aufbau gestatten
und damit dem Künstler bedeutendere Aufträge ver-
mitteln. Das ist die Tumba, das eigentliche Hochgrab.
An ihm entwickelt sich die erste Blüte mittelalterlicher
Plastik, nachdem dieselbe in den Kirchen und insbe-
sondere an den Portalen des Übergangstiles sich ent-
faltet hatte. -
In älterer Zeit noch niedrig und vielleicht wirk-
lich zur Aufnahme des Leichnams bestimmt, wird die
Tumba nach und nach von allem beengenden Zwang
befreit als freistehendes oder als Wandgrab und selbst
in Altarform zum eigentlichen künstlerischen Mal. Es
liegt ihr dabei die monumentale Umgestaltung des
Paradebettes zu Grunde.
Auch die realistischere Darstellung eines Leich-
nams auf der mit Stoff überzogenen Bahre hat sich
in dem Grabmal des Gaugrafen Konrad Kurzbold
im Limburger Dom erhalten. Gewöhnlich jedoch
ruht der Tote auf einer mannigfach gestalteten Platt-
form, die — je höher sie emporwächst und damit das
Werk des Bildhauers vor Beschädigung entrückt -
demselben um so kunstvollere Durchbildung gestattet.
Es ist eine grosse Reihe von Meisterwerken, die uns
da fesselt.
Hierher gehört in erster Linie das noch aus dem
13. Jahrhunderte stammende vorzügliche Grabmal
Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig. Es
zeigt uns denselben neben seiner Gemahlin Mathilde
ruhend, vornehm und schön, die Gesichter voll Aus-
druck und vielleicht schon ein leises Streben nach
Porträtähnlichkeit verratend, doch idealisirt, die Ge-
wänder in freiem, reichem Faltenwurf. Ein verwandtes
Grabmal ist das des Grafen Dedo zu Wechselburg.
Die Platte mit dem Bild des Entseelten liegt
meist auf einem geschlossenen massiven Unterbau.
Doch treten an dessen Stelle gelegentlich auch niedrige
Pfeiler oder Säulen. Der volle Unterbau wird wenig-
stens mit Reliefs geschmückt oder in Arkaden aufge-
löst, die an den reicheren Denkmälern Raum zu
zahlreichen Figuren, Christus mit den Heiligen u. a.,
zu Scenen aus dem Leben des Bestatteten und auch
oft zu ganz genrehaften Darstellungen, gewähren.
Manchmal -- z. B. am Grabmal des heil. Emmeram
zu Regensburg — wird die Reliefplatte auf einen
Sockel gestellt und darüber auf Pfeiler oder Säulchen
eine zweite Platte gelegt.
Das erinnert an die eigentümliche Sitte über
Gräbern Häuser aus Holz oder Eisen zu errichten, die
in manchen Gegenden Deutschlands bestand und auf
die sich vielleicht schon eine Stelle der lex Salica be-
zog. Das Grabmal des Herzogs Barnim VI. von
Pommern-Wolgast (f 1405) in der Kirche zu Kenz
bei Barth hat einen hölzernen Aufsatz in Hausform,
dessen Dachflächen derart gedreht werden können,
Kunstgeverbeblatt. N. F. IX. H. 1.
dass man die darunter liegende geschnitzte Figur des
Verstorbenen sehen kann. Über dem Grabmal des
Markgrafen Albuin zu Möchling im Jaunthal (Kärnten)
befand sich der spätgotische Schrein, der heute • im
Wiener Hofmuseum zu sehen ist. Dieser prachtvolle
Schrein stellt eine ganze Kirche mit Apsis dar und
misst in der Höhe bis zur obersten Kreuzblume
7J/2 Fuss, der Länge nach 6, der Breite nach 23/4 Fuss.
Das aus Lindenholz geschnitzte Kunstwerk soll einen
Benediktinermönch aus dem Stift St. Paul zum Ver-
fertiger haben. Die bis in die kleinste ,Einzelheit
konstruktiv und künstlerisch vorzügliche Arbeit verrät
eine Künstlerhand ersten Ranges, die sich in der zier-
lichen Gliederung der Strebepfeiler mit ihren Fialen
und Kreuzblumen und in dem spielenden Reichtum
der Masswerkmotive, deren man 242 verschiedene
zählt, gar nicht genug thun konnte. Dieses entzückende
Kunstwerk am ursprünglichen Aufbewahrungsort macht
einen um so rätselhafteren Eindruck, als die Tumba
des sagenhaften Albuin, auf der es sich befand, ganz
roh und kunstlos aus rohen Bruchsteinen aufgeführt
und nur mit Mörtel beworfen ist. Es ist daher die
Vermutung nicht abzuweisen, dass das ganz durch-
brochene, wie ein Spitzengewebe durchsichtige Mass-
Farbiges Glasfenster, nach einem Entwurf von Maler H. CHRISTIANSEN,
Paris; ausgeführt von H. Engeltsrecht, Hamburg.