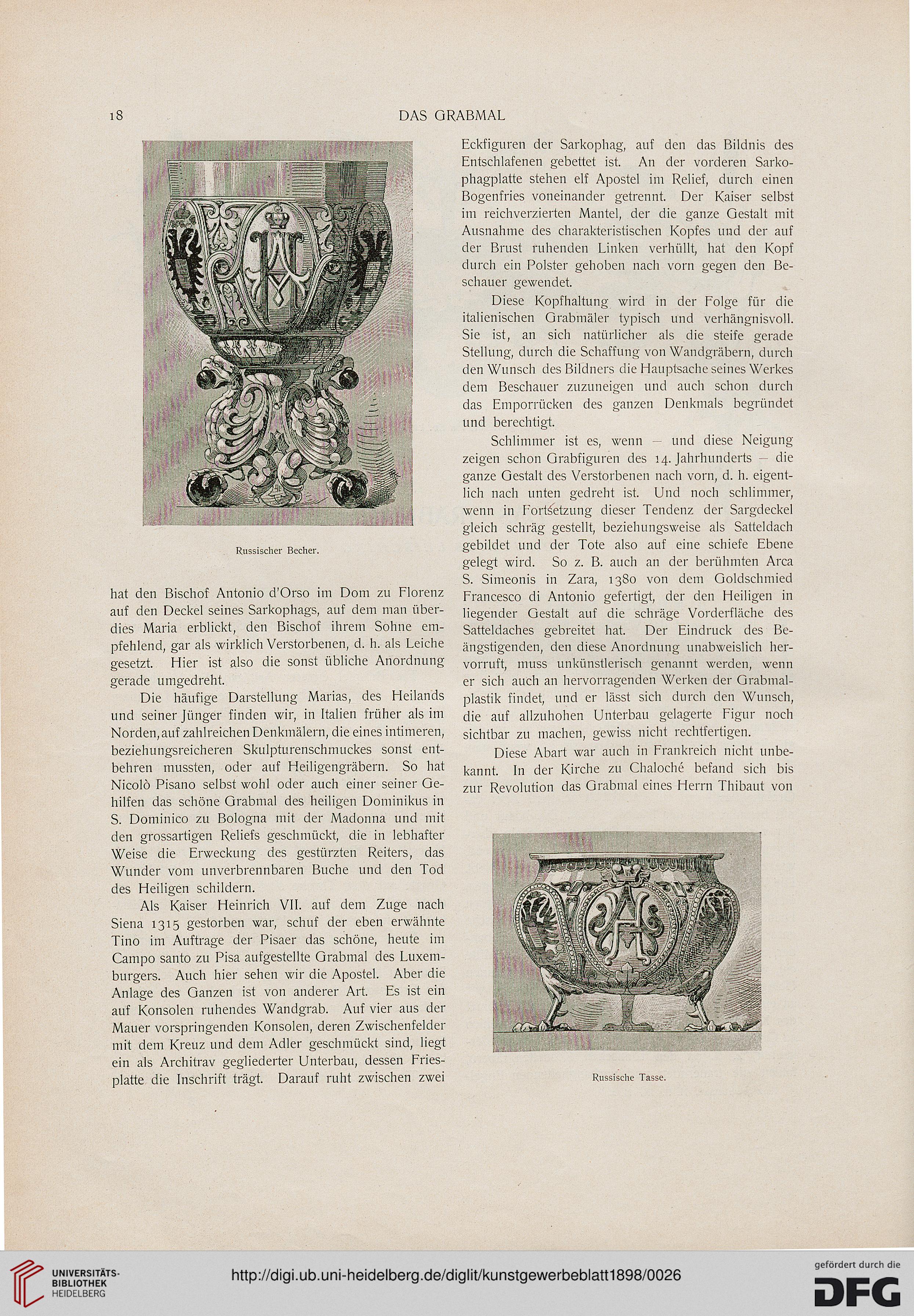DAS GRABMAL
Russischer Becher.
hat den Bischof Antonio d'Orso im Dom zu Florenz
auf den Deckel seines Sarkophags, auf dem man über-
dies Maria erblickt, den Bischof ihrem Sohne em-
pfehlend, gar als wirklich Verstorbenen, d. h. als Leiche
gesetzt. Hier ist also die sonst übliche Anordnung
gerade umgedreht.
Die häufige Darstellung Marias, des Heilands
und seiner Jünger finden wir, in Italien früher als im
Norden, auf zahlreichen Denkmälern, die eines intimeren,
beziehungsreicheren Skulpturenschmuckes sonst ent-
behren mussten, oder auf Heiligengräbern. So hat
Nicolö Pisano selbst wohl oder auch einer seiner Ge-
hilfen das schöne Grabmal des heiligen Dominikus in
S. Dominico zu Bologna mit der Madonna und mit
den grossartigen Reliefs geschmückt, die in lebhafter
Weise die Erweckung des gestürzten Reiters, das
Wunder vom unverbrennbaren Buche und den Tod
des Heiligen schildern.
Als Kaiser Heinrich VII. auf dem Zuge nach
Siena 1315 gestorben war, schuf der eben erwähnte
Tino im Auftrage der Pisaer das schöne, heute im
Campo santo zu Pisa aufgestellte Grabmal des Luxem-
burgers. Auch hier sehen wir die Apostel. Aber die
Anlage des Ganzen ist von anderer Art. Es ist ein
auf Konsolen ruhendes Wandgrab. Auf vier aus der
Mauer vorspringenden Konsolen, deren Zwischenfelder
mit dem Kreuz und dem Adler geschmückt sind, liegt
ein als Architrav gegliederter Unterbau, dessen Fries-
platte die Inschrift trägt. Darauf ruht zwischen zwei
Eckfiguren der Sarkophag, auf den das Bildnis des
Entschlafenen gebettet ist. An der vorderen Sarko-
phagplatte stehen elf Apostel im Relief, durch einen
Bogenfries voneinander getrennt. Der Kaiser selbst
im reichverzierten Mantel, der die ganze Gestalt mit
Ausnahme des charakteristischen Kopfes und der auf
der Brust ruhenden Linken verhüllt, hat den Kopf
durch ein Polster gehoben nach vorn gegen den Be-
schauer gewendet.
Diese Kopfhaltung wird in der Folge für die
italienischen Grabmäler typisch und verhängnisvoll.
Sie ist, an sich natürlicher als die steife gerade
Stellung, durch die Schaffung von Wandgräbern, durch
den Wunsch des Bildners die Hauptsache seines Werkes
dem Beschauer zuzuneigen und auch schon durch
das Emporrücken des ganzen Denkmals begründet
und berechtigt.
Schlimmer ist es, wenn - und diese Neigung
zeigen schon Grabfiguren des 14. Jahrhunderts — die
ganze Gestalt des Verstorbenen nach vorn, d. h. eigent-
lich nach unten gedreht ist. Und noch schlimmer,
wenn in Fortsetzung dieser Tendenz der Sargdeckel
gleich schräg gestellt, beziehungsweise als Satteldach
gebildet und der Tote also auf eine schiefe Ebene
gelegt wird. So z. B. auch an der berühmten Area
S. Simeonis in Zara, 1380 von dem Goldschmied
Francesco di Antonio gefertigt, der den Heiligen in
liegender Gestalt auf die schräge Vorderfläche des
Satteldaches gebreitet hat. Der Eindruck des Be-
ängstigenden, den diese Anordnung unabweislich her-
vorruft, muss unkünstlerisch genannt werden, wenn
er sich auch an hervorragenden Werken der Grabmal-
plastik findet, und er lässt sich durch den Wunsch,
die auf allzuhohen Unterbau gelagerte Figur noch
sichtbar zu machen, gewiss nicht rechtfertigen.
Diese Abart war auch in Frankreich nicht unbe-
kannt. In der Kirche zu Chaloche befand sich bis
zur Revolution das Grabmal eines Herrn Thibaut von
jSUdi
Russische Tasse.
Russischer Becher.
hat den Bischof Antonio d'Orso im Dom zu Florenz
auf den Deckel seines Sarkophags, auf dem man über-
dies Maria erblickt, den Bischof ihrem Sohne em-
pfehlend, gar als wirklich Verstorbenen, d. h. als Leiche
gesetzt. Hier ist also die sonst übliche Anordnung
gerade umgedreht.
Die häufige Darstellung Marias, des Heilands
und seiner Jünger finden wir, in Italien früher als im
Norden, auf zahlreichen Denkmälern, die eines intimeren,
beziehungsreicheren Skulpturenschmuckes sonst ent-
behren mussten, oder auf Heiligengräbern. So hat
Nicolö Pisano selbst wohl oder auch einer seiner Ge-
hilfen das schöne Grabmal des heiligen Dominikus in
S. Dominico zu Bologna mit der Madonna und mit
den grossartigen Reliefs geschmückt, die in lebhafter
Weise die Erweckung des gestürzten Reiters, das
Wunder vom unverbrennbaren Buche und den Tod
des Heiligen schildern.
Als Kaiser Heinrich VII. auf dem Zuge nach
Siena 1315 gestorben war, schuf der eben erwähnte
Tino im Auftrage der Pisaer das schöne, heute im
Campo santo zu Pisa aufgestellte Grabmal des Luxem-
burgers. Auch hier sehen wir die Apostel. Aber die
Anlage des Ganzen ist von anderer Art. Es ist ein
auf Konsolen ruhendes Wandgrab. Auf vier aus der
Mauer vorspringenden Konsolen, deren Zwischenfelder
mit dem Kreuz und dem Adler geschmückt sind, liegt
ein als Architrav gegliederter Unterbau, dessen Fries-
platte die Inschrift trägt. Darauf ruht zwischen zwei
Eckfiguren der Sarkophag, auf den das Bildnis des
Entschlafenen gebettet ist. An der vorderen Sarko-
phagplatte stehen elf Apostel im Relief, durch einen
Bogenfries voneinander getrennt. Der Kaiser selbst
im reichverzierten Mantel, der die ganze Gestalt mit
Ausnahme des charakteristischen Kopfes und der auf
der Brust ruhenden Linken verhüllt, hat den Kopf
durch ein Polster gehoben nach vorn gegen den Be-
schauer gewendet.
Diese Kopfhaltung wird in der Folge für die
italienischen Grabmäler typisch und verhängnisvoll.
Sie ist, an sich natürlicher als die steife gerade
Stellung, durch die Schaffung von Wandgräbern, durch
den Wunsch des Bildners die Hauptsache seines Werkes
dem Beschauer zuzuneigen und auch schon durch
das Emporrücken des ganzen Denkmals begründet
und berechtigt.
Schlimmer ist es, wenn - und diese Neigung
zeigen schon Grabfiguren des 14. Jahrhunderts — die
ganze Gestalt des Verstorbenen nach vorn, d. h. eigent-
lich nach unten gedreht ist. Und noch schlimmer,
wenn in Fortsetzung dieser Tendenz der Sargdeckel
gleich schräg gestellt, beziehungsweise als Satteldach
gebildet und der Tote also auf eine schiefe Ebene
gelegt wird. So z. B. auch an der berühmten Area
S. Simeonis in Zara, 1380 von dem Goldschmied
Francesco di Antonio gefertigt, der den Heiligen in
liegender Gestalt auf die schräge Vorderfläche des
Satteldaches gebreitet hat. Der Eindruck des Be-
ängstigenden, den diese Anordnung unabweislich her-
vorruft, muss unkünstlerisch genannt werden, wenn
er sich auch an hervorragenden Werken der Grabmal-
plastik findet, und er lässt sich durch den Wunsch,
die auf allzuhohen Unterbau gelagerte Figur noch
sichtbar zu machen, gewiss nicht rechtfertigen.
Diese Abart war auch in Frankreich nicht unbe-
kannt. In der Kirche zu Chaloche befand sich bis
zur Revolution das Grabmal eines Herrn Thibaut von
jSUdi
Russische Tasse.