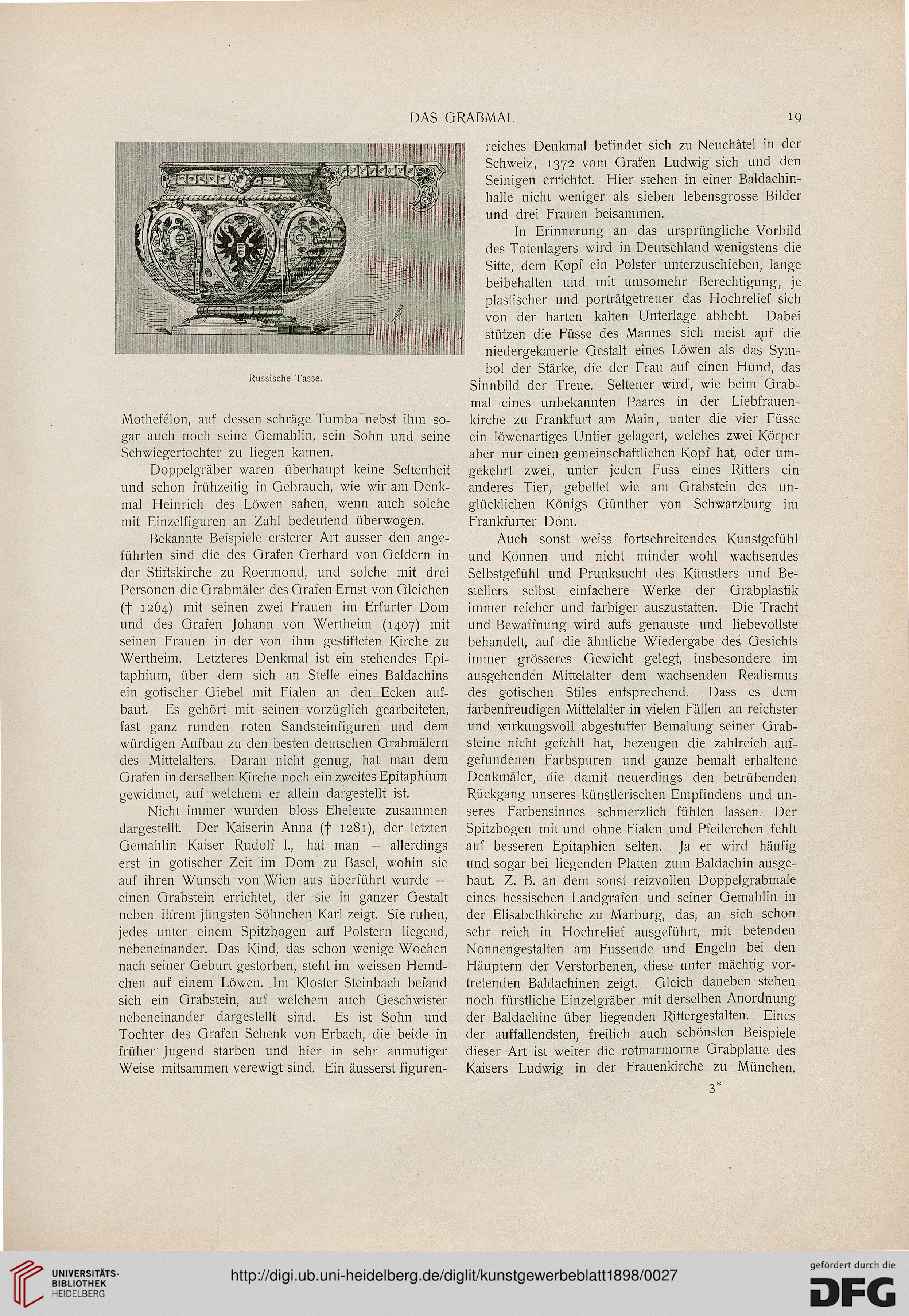DAS GRABMAL
19
'.'•>nv.WllflJtW<n;<
Russische Tasse.
Mothefelon, auf dessen schräge Tumba nebst ihm so-
gar auch noch seine Gemahlin, sein Sohn und seine
Schwiegertochter zu liegen kamen.
Doppelgräber waren überhaupt keine Seltenheit
und schon frühzeitig in Gebrauch, wie wir am Denk-
mal Heinrich des Löwen sahen, wenn auch solche
mit Einzelfiguren an Zahl bedeutend überwogen.
Bekannte Beispiele ersterer Art ausser den ange-
führten sind die des Grafen Gerhard von Geldern in
der Stiftskirche zu Roermond, und solche mit drei
Personen dieGrabmäler des Grafen Ernst von Gleichen
(f 1264) mit seinen zwei Frauen im Erfurter Dom
und des Grafen Johann von Wertheim (1407) mit
seinen Frauen in der von ihm gestifteten Kirche zu
Wertheim. Letzteres Denkmal ist ein stehendes Epi-
taphium, über dem sich an Stelle eines Baldachins
ein gotischer Giebel mit Fialen an den Ecken auf-
baut. Es gehört mit seinen vorzüglich gearbeiteten,
fast ganz runden roten Sandsteinfiguren und dem
würdigen Aufbau zu den besten deutschen Grabmälern
des Mittelalters. Daran nicht genug, hat man dem
Grafen in derselben Kirche noch ein zweites Epitaphium
gewidmet, auf welchem er allein dargestellt ist.
Nicht immer wurden bloss Eheleute zusammen
dargestellt. Der Kaiserin Anna (f 1281), der letzten
Gemahlin Kaiser Rudolf I., hat man — allerdings
erst in gotischer Zeit im Dom zu Basel, wohin sie
auf ihren Wunsch von Wien aus überführt wurde -
einen Grabstein errichtet, der sie in ganzer Gestalt
neben ihrem jüngsten Söhnchen Karl zeigt. Sie ruhen,
jedes unter einem Spitzbogen auf Polstern liegend,
nebeneinander. Das Kind, das schon wenige Wochen
nach seiner Geburt gestorben, steht im weissen Hemd-
chen auf einem Löwen. Im Kloster Steinbach befand
sich ein Grabstein, auf welchem auch Geschwister
nebeneinander dargestellt sind. Es ist Sohn und
Tochter des Grafen Schenk von Erbach, die beide in
früher Jugend starben und hier in sehr anmutiger
Weise mitsammen verewigt sind. Ein äusserst figuren-
j|l reiches Denkmal befindet sich zu Neuchätel in der
Schweiz, 1372 vom Grafen Ludwig sich und den
Seinigen errichtet. Hier stehen in einer Baldachin-
halle nicht weniger als sieben lebensgrosse Bilder
II und drei Frauen beisammen.
In Erinnerung an das ursprüngliche Vorbild
des Totenlagers wird in Deutschland wenigstens die
Sitte, dem Kopf ein Polster unterzuschieben, lange
beibehalten und mit umsomehr Berechtigung, je
plastischer und porträtgetreuer das Hochrelief sich
von der harten kalten Unterlage abhebt. Dabei
stützen die Füsse des Mannes sich meist auf die
niedergekauerte Gestalt eines Löwen als das Sym-
bol der Stärke, die der Frau auf einen Hund, das
Sinnbild der Treue. Seltener wird', wie beim Grab-
mal eines unbekannten Paares in der Liebfrauen-
kirche zu Frankfurt am Main, unter die vier Füsse
ein löwenartiges Untier gelagert, welches zwei Körper
aber nur einen gemeinschaftlichen Kopf hat, oder um-
gekehrt zwei, unter jeden Fuss eines Ritters ein
anderes Tier, gebettet wie am Grabstein des un-
glücklichen Königs Günther von Schwarzburg im
Frankfurter Dom.
Auch sonst weiss fortschreitendes Kunstgefühl
und Können und nicht minder wohl wachsendes
Selbstgefühl und Prunksucht des Künstlers und Be-
stellers selbst einfachere Werke der Grabplastik
immer reicher und farbiger auszustatten. Die Tracht
und Bewaffnung wird aufs genauste und liebevollste
behandelt, auf die ähnliche Wiedergabe des Gesichts
immer grösseres Gewicht gelegt, insbesondere im
ausgehenden Mittelalter dem wachsenden Realismus
des gotischen Stiles entsprechend. Dass es dem
farbenfreudigen Mittelalter in vielen Fällen an reichster
und wirkungsvoll abgestufter Bemalung seiner Grab-
steine nicht gefehlt hat, bezeugen die zahlreich auf-
gefundenen Farbspuren und ganze bemalt erhaltene
Denkmäler, die damit neuerdings den betrübenden
Rückgang unseres künstlerischen Empfindens und un-
seres Farbensinnes schmerzlich fühlen lassen. Der
Spitzbogen mit und ohne Fialen und Pfeilerchen fehlt
auf besseren Epitaphien selten. Ja er wird häufig
und sogar bei liegenden Platten zum Baldachin ausge-
baut. Z. B. an dem sonst reizvollen Doppelgrabmale
eines hessischen Landgrafen und seiner Gemahlin in
der Elisabethkirche zu Marburg, das, an sich schon
sehr reich in Hochrelief ausgeführt, mit betenden
Nonnengestalten am Fussende und Engeln bei den
Häuptern der Verstorbenen, diese unter mächtig vor-
tretenden Baldachinen zeigt. Gleich daneben stehen
noch fürstliche Einzelgräber mit derselben Anordnung
der Baldachine über liegenden Rittergestalten. Eines
der auffallendsten, freilich auch schönsten Beispiele
dieser Art ist weiter die rotmarmorne Grabplatte des
Kaisers Ludwig in der Frauenkirche zu München.
19
'.'•>nv.WllflJtW<n;<
Russische Tasse.
Mothefelon, auf dessen schräge Tumba nebst ihm so-
gar auch noch seine Gemahlin, sein Sohn und seine
Schwiegertochter zu liegen kamen.
Doppelgräber waren überhaupt keine Seltenheit
und schon frühzeitig in Gebrauch, wie wir am Denk-
mal Heinrich des Löwen sahen, wenn auch solche
mit Einzelfiguren an Zahl bedeutend überwogen.
Bekannte Beispiele ersterer Art ausser den ange-
führten sind die des Grafen Gerhard von Geldern in
der Stiftskirche zu Roermond, und solche mit drei
Personen dieGrabmäler des Grafen Ernst von Gleichen
(f 1264) mit seinen zwei Frauen im Erfurter Dom
und des Grafen Johann von Wertheim (1407) mit
seinen Frauen in der von ihm gestifteten Kirche zu
Wertheim. Letzteres Denkmal ist ein stehendes Epi-
taphium, über dem sich an Stelle eines Baldachins
ein gotischer Giebel mit Fialen an den Ecken auf-
baut. Es gehört mit seinen vorzüglich gearbeiteten,
fast ganz runden roten Sandsteinfiguren und dem
würdigen Aufbau zu den besten deutschen Grabmälern
des Mittelalters. Daran nicht genug, hat man dem
Grafen in derselben Kirche noch ein zweites Epitaphium
gewidmet, auf welchem er allein dargestellt ist.
Nicht immer wurden bloss Eheleute zusammen
dargestellt. Der Kaiserin Anna (f 1281), der letzten
Gemahlin Kaiser Rudolf I., hat man — allerdings
erst in gotischer Zeit im Dom zu Basel, wohin sie
auf ihren Wunsch von Wien aus überführt wurde -
einen Grabstein errichtet, der sie in ganzer Gestalt
neben ihrem jüngsten Söhnchen Karl zeigt. Sie ruhen,
jedes unter einem Spitzbogen auf Polstern liegend,
nebeneinander. Das Kind, das schon wenige Wochen
nach seiner Geburt gestorben, steht im weissen Hemd-
chen auf einem Löwen. Im Kloster Steinbach befand
sich ein Grabstein, auf welchem auch Geschwister
nebeneinander dargestellt sind. Es ist Sohn und
Tochter des Grafen Schenk von Erbach, die beide in
früher Jugend starben und hier in sehr anmutiger
Weise mitsammen verewigt sind. Ein äusserst figuren-
j|l reiches Denkmal befindet sich zu Neuchätel in der
Schweiz, 1372 vom Grafen Ludwig sich und den
Seinigen errichtet. Hier stehen in einer Baldachin-
halle nicht weniger als sieben lebensgrosse Bilder
II und drei Frauen beisammen.
In Erinnerung an das ursprüngliche Vorbild
des Totenlagers wird in Deutschland wenigstens die
Sitte, dem Kopf ein Polster unterzuschieben, lange
beibehalten und mit umsomehr Berechtigung, je
plastischer und porträtgetreuer das Hochrelief sich
von der harten kalten Unterlage abhebt. Dabei
stützen die Füsse des Mannes sich meist auf die
niedergekauerte Gestalt eines Löwen als das Sym-
bol der Stärke, die der Frau auf einen Hund, das
Sinnbild der Treue. Seltener wird', wie beim Grab-
mal eines unbekannten Paares in der Liebfrauen-
kirche zu Frankfurt am Main, unter die vier Füsse
ein löwenartiges Untier gelagert, welches zwei Körper
aber nur einen gemeinschaftlichen Kopf hat, oder um-
gekehrt zwei, unter jeden Fuss eines Ritters ein
anderes Tier, gebettet wie am Grabstein des un-
glücklichen Königs Günther von Schwarzburg im
Frankfurter Dom.
Auch sonst weiss fortschreitendes Kunstgefühl
und Können und nicht minder wohl wachsendes
Selbstgefühl und Prunksucht des Künstlers und Be-
stellers selbst einfachere Werke der Grabplastik
immer reicher und farbiger auszustatten. Die Tracht
und Bewaffnung wird aufs genauste und liebevollste
behandelt, auf die ähnliche Wiedergabe des Gesichts
immer grösseres Gewicht gelegt, insbesondere im
ausgehenden Mittelalter dem wachsenden Realismus
des gotischen Stiles entsprechend. Dass es dem
farbenfreudigen Mittelalter in vielen Fällen an reichster
und wirkungsvoll abgestufter Bemalung seiner Grab-
steine nicht gefehlt hat, bezeugen die zahlreich auf-
gefundenen Farbspuren und ganze bemalt erhaltene
Denkmäler, die damit neuerdings den betrübenden
Rückgang unseres künstlerischen Empfindens und un-
seres Farbensinnes schmerzlich fühlen lassen. Der
Spitzbogen mit und ohne Fialen und Pfeilerchen fehlt
auf besseren Epitaphien selten. Ja er wird häufig
und sogar bei liegenden Platten zum Baldachin ausge-
baut. Z. B. an dem sonst reizvollen Doppelgrabmale
eines hessischen Landgrafen und seiner Gemahlin in
der Elisabethkirche zu Marburg, das, an sich schon
sehr reich in Hochrelief ausgeführt, mit betenden
Nonnengestalten am Fussende und Engeln bei den
Häuptern der Verstorbenen, diese unter mächtig vor-
tretenden Baldachinen zeigt. Gleich daneben stehen
noch fürstliche Einzelgräber mit derselben Anordnung
der Baldachine über liegenden Rittergestalten. Eines
der auffallendsten, freilich auch schönsten Beispiele
dieser Art ist weiter die rotmarmorne Grabplatte des
Kaisers Ludwig in der Frauenkirche zu München.