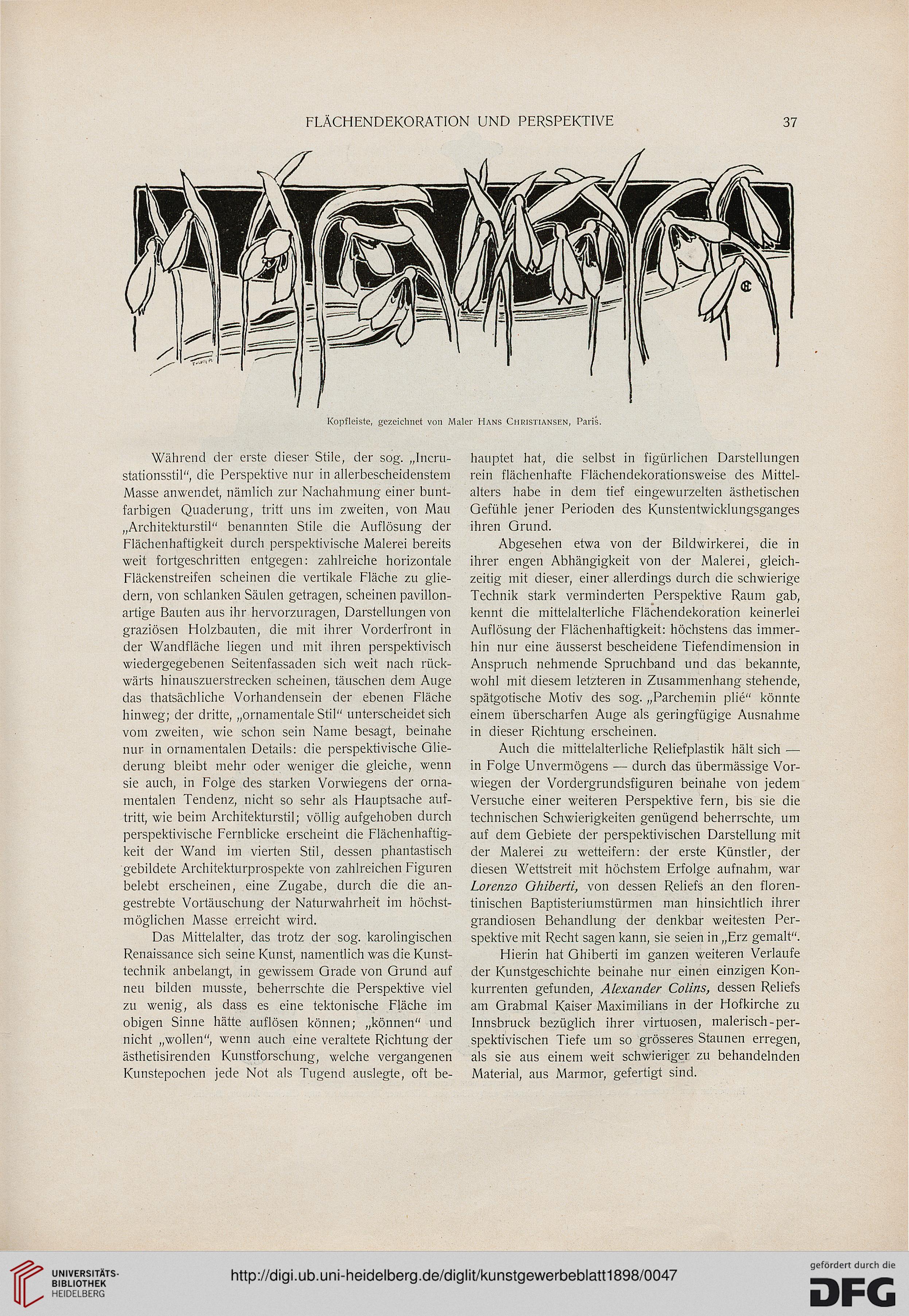FLÄCHENDEKORATION UND PERSPEKTIVE
37
ÜÖ
Kopfleiste, gezeichnet von Maler Hans Christiansen, Paris.
Während der erste dieser Stile, der sog. „Incru-
stationsstil", die Perspektive nur in allerbescheidenstem
Masse anwendet, nämlich zur Nachahmung einer bunt-
farbigen Quaderung, tritt uns im zweiten, von Mau
„Architekturstil" benannten Stile die Auflösung der
Flächenhaftigkeit durch perspektivische Malerei bereits
weit fortgeschritten entgegen: zahlreiche horizontale
Fläckenstreifen scheinen die vertikale Fläche zu glie-
dern, von schlanken Säulen getragen, scheinen pavillon-
artige Bauten aus ihr hervorzuragen, Darstellungen von
graziösen Holzbauten, die mit ihrer Vorderfront in
der Wandfläche liegen und mit ihren perspektivisch
wiedergegebenen Seitenfassaden sich weit nach rück-
wärts hinauszuerstrecken scheinen, täuschen dem Auge
das thatsächliche Vorhandensein der ebenen Fläche
hinweg; der dritte, „ornamentale Stil" unterscheidet sich
vom zweiten, wie schon sein Name besagt, beinahe
nur in ornamentalen Details: die perspektivische Glie-
derung bleibt mehr oder weniger die gleiche, wenn
sie auch, in Folge des starken Vorwiegens der orna-
mentalen Tendenz, nicht so sehr als Hauptsache auf-
tritt, wie beim Architekturstil; völlig aufgehoben durch
perspektivische Fernblicke erscheint die Flächenhaftig-
keit der Wand im vierten Stil, dessen phantastisch
gebildete Architekturprospekte von zahlreichen Figuren
belebt erscheinen, eine Zugabe, durch die die an-
gestrebte Vortäuschung der Naturwahrheit im höchst-
möglichen Masse erreicht wird.
Das Mittelalter, das trotz der sog. karolingischen
Renaissance sich seine Kunst, namentlich was die Kunst-
technik anbelangt, in gewissem Grade von Grund auf
neu bilden musste, beherrschte die Perspektive viel
zu wenig, als dass es eine tektonische Fläche im
obigen Sinne hätte auflösen können; „können" und
nicht „wollen", wenn auch eine veraltete Richtung der
ästhetisirenden Kunstforschung, welche vergangenen
Kunstepochen jede Not als Tugend auslegte, oft be-
hauptet hat, die selbst in figürlichen Darstellungen
rein flächenhafte Flächendekorationsweise des Mittel-
alters habe in dem tief eingewurzelten ästhetischen
Gefühle jener Perioden des Kunstentwicklungsganges
ihren Grund.
Abgesehen etwa von der Bildwirkerei, die in
ihrer engen Abhängigkeit von der Malerei, gleich-
zeitig mit dieser, einer allerdings durch die schwierige
Technik stark verminderten Perspektive Raum gab,
kennt die mittelalterliche Flächendekoration keinerlei
Auflösung der Flächenhaftigkeit: höchstens das immer-
hin nur eine äusserst bescheidene Tiefendimension in
Anspruch nehmende Spruchband und das bekannte,
wohl mit diesem letzteren in Zusammenhang stehende,
spätgotische Motiv des sog. „Parchemin plie" könnte
einem überscharfen Auge als geringfügige Ausnahme
in dieser Richtung erscheinen.
Auch die mittelalterliche Reliefplastik hält sich —
in Folge Unvermögens — durch das übermässige Vor-
wiegen der Vordergrundsfiguren beinahe von jedem
Versuche einer weiteren Perspektive fern, bis sie die
technischen Schwierigkeiten genügend beherrschte, um
auf dem Gebiete der perspektivischen Darstellung mit
der Malerei zu wetteifern: der erste Künstler, der
diesen Wettstreit mit höchstem Erfolge aufnahm, war
Lorenzo Ohiberti, von dessen Reliefs an den floren-
tinischen Baptisteriumstürmen man hinsichtlich ihrer
grandiosen Behandlung der denkbar weitesten Per-
spektive mit Recht sagen kann, sie seien in „Erz gemalt".
Hierin hat Ghiberti im ganzen weiteren Verlaufe
der Kunstgeschichte beinahe nur einen einzigen Kon-
kurrenten gefunden, Alexander Colins, dessen Reliefs
am Grabmal Kaiser Maximilians in der Hofkirche zu
Innsbruck bezüglich ihrer virtuosen, malerisch-per-
spektivischen Tiefe um so grösseres Staunen erregen,
als sie aus einem weit schwieriger zu behandelnden
Material, aus Marmor, gefertigt sind.
37
ÜÖ
Kopfleiste, gezeichnet von Maler Hans Christiansen, Paris.
Während der erste dieser Stile, der sog. „Incru-
stationsstil", die Perspektive nur in allerbescheidenstem
Masse anwendet, nämlich zur Nachahmung einer bunt-
farbigen Quaderung, tritt uns im zweiten, von Mau
„Architekturstil" benannten Stile die Auflösung der
Flächenhaftigkeit durch perspektivische Malerei bereits
weit fortgeschritten entgegen: zahlreiche horizontale
Fläckenstreifen scheinen die vertikale Fläche zu glie-
dern, von schlanken Säulen getragen, scheinen pavillon-
artige Bauten aus ihr hervorzuragen, Darstellungen von
graziösen Holzbauten, die mit ihrer Vorderfront in
der Wandfläche liegen und mit ihren perspektivisch
wiedergegebenen Seitenfassaden sich weit nach rück-
wärts hinauszuerstrecken scheinen, täuschen dem Auge
das thatsächliche Vorhandensein der ebenen Fläche
hinweg; der dritte, „ornamentale Stil" unterscheidet sich
vom zweiten, wie schon sein Name besagt, beinahe
nur in ornamentalen Details: die perspektivische Glie-
derung bleibt mehr oder weniger die gleiche, wenn
sie auch, in Folge des starken Vorwiegens der orna-
mentalen Tendenz, nicht so sehr als Hauptsache auf-
tritt, wie beim Architekturstil; völlig aufgehoben durch
perspektivische Fernblicke erscheint die Flächenhaftig-
keit der Wand im vierten Stil, dessen phantastisch
gebildete Architekturprospekte von zahlreichen Figuren
belebt erscheinen, eine Zugabe, durch die die an-
gestrebte Vortäuschung der Naturwahrheit im höchst-
möglichen Masse erreicht wird.
Das Mittelalter, das trotz der sog. karolingischen
Renaissance sich seine Kunst, namentlich was die Kunst-
technik anbelangt, in gewissem Grade von Grund auf
neu bilden musste, beherrschte die Perspektive viel
zu wenig, als dass es eine tektonische Fläche im
obigen Sinne hätte auflösen können; „können" und
nicht „wollen", wenn auch eine veraltete Richtung der
ästhetisirenden Kunstforschung, welche vergangenen
Kunstepochen jede Not als Tugend auslegte, oft be-
hauptet hat, die selbst in figürlichen Darstellungen
rein flächenhafte Flächendekorationsweise des Mittel-
alters habe in dem tief eingewurzelten ästhetischen
Gefühle jener Perioden des Kunstentwicklungsganges
ihren Grund.
Abgesehen etwa von der Bildwirkerei, die in
ihrer engen Abhängigkeit von der Malerei, gleich-
zeitig mit dieser, einer allerdings durch die schwierige
Technik stark verminderten Perspektive Raum gab,
kennt die mittelalterliche Flächendekoration keinerlei
Auflösung der Flächenhaftigkeit: höchstens das immer-
hin nur eine äusserst bescheidene Tiefendimension in
Anspruch nehmende Spruchband und das bekannte,
wohl mit diesem letzteren in Zusammenhang stehende,
spätgotische Motiv des sog. „Parchemin plie" könnte
einem überscharfen Auge als geringfügige Ausnahme
in dieser Richtung erscheinen.
Auch die mittelalterliche Reliefplastik hält sich —
in Folge Unvermögens — durch das übermässige Vor-
wiegen der Vordergrundsfiguren beinahe von jedem
Versuche einer weiteren Perspektive fern, bis sie die
technischen Schwierigkeiten genügend beherrschte, um
auf dem Gebiete der perspektivischen Darstellung mit
der Malerei zu wetteifern: der erste Künstler, der
diesen Wettstreit mit höchstem Erfolge aufnahm, war
Lorenzo Ohiberti, von dessen Reliefs an den floren-
tinischen Baptisteriumstürmen man hinsichtlich ihrer
grandiosen Behandlung der denkbar weitesten Per-
spektive mit Recht sagen kann, sie seien in „Erz gemalt".
Hierin hat Ghiberti im ganzen weiteren Verlaufe
der Kunstgeschichte beinahe nur einen einzigen Kon-
kurrenten gefunden, Alexander Colins, dessen Reliefs
am Grabmal Kaiser Maximilians in der Hofkirche zu
Innsbruck bezüglich ihrer virtuosen, malerisch-per-
spektivischen Tiefe um so grösseres Staunen erregen,
als sie aus einem weit schwieriger zu behandelnden
Material, aus Marmor, gefertigt sind.