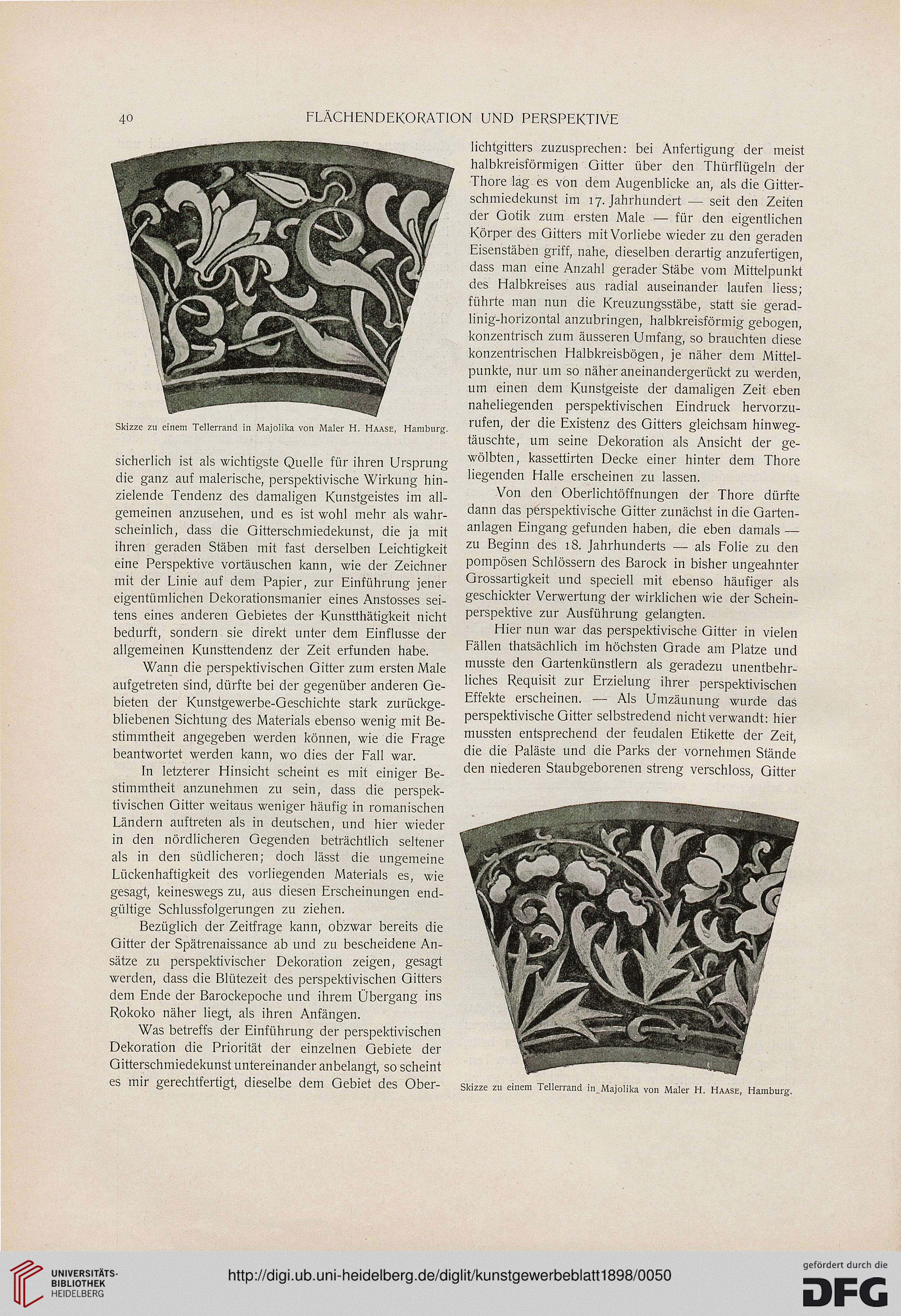40
FLÄCHENDEKORATION UND PERSPEKTIVE
Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.
sicherlich ist als wichtigste Quelle für ihren Ursprung
die ganz auf malerische, perspektivische Wirkung hin-
zielende Tendenz des damaligen Kunstgeistes im all-
gemeinen anzusehen, und es ist wohl mehr als wahr-
scheinlich, dass die Gitterschmiedekunst, die ja mit
ihren geraden Stäben mit fast derselben Leichtigkeit
eine Perspektive vortäuschen kann, wie der Zeichner
mit der Linie auf dem Papier, zur Einführung jener
eigentümlichen Dekorationsmanier eines Anstosses sei-
tens eines anderen Gebietes der Kunstthätigkeit nicht
bedurft, sondern sie direkt unter dem Einflüsse der
allgemeinen Kunsttendenz der Zeit erfunden habe.
Wann die perspektivischen Gitter zum ersten Male
aufgetreten sind, dürfte bei der gegenüber anderen Ge-
bieten der Kunstgewerbe-Geschichte stark zurückge-
bliebenen Sichtung des Materials ebenso wenig mit Be-
stimmtheit angegeben werden können, wie die Frage
beantwortet werden kann, wo dies der Fall war.
In letzterer Hinsicht scheint es mit einiger Be-
stimmtheit anzunehmen zu sein, dass die perspek-
tivischen Gitter weitaus weniger häufig in romanischen
Ländern auftreten als in deutschen, und hier wieder
in den nördlicheren Gegenden beträchtlich seltener
als in den südlicheren; doch lässt die ungemeine
Lückenhaftigkeit des vorliegenden Materials es, wie
gesagt, keineswegs zu, aus diesen Erscheinungen end-
gültige Schlussfolgerungen zu ziehen.
Bezüglich der Zeitfrage kann, obzwar bereits die
Gitter der Spätrenaissance ab und zu bescheidene An-
sätze zu perspektivischer Dekoration zeigen, gesagt
werden, dass die Blütezeit des perspektivischen Gitters
dem Ende der Barockepoche und ihrem Übergang ins
Rokoko näher liegt, als ihren Anfängen.
Was betreffs der Einführung der perspektivischen
Dekoration die Priorität der einzelnen Gebiete der
Gitterschmiedekunst untereinander anbelangt, so scheint
es mir gerechtfertigt, dieselbe dem Gebiet des Ober-
lichtgitters zuzusprechen: bei Anfertigung der meist
halbkreisförmigen Gitter über den Thürflügeln der
Thore lag es von dem Augenblicke an, als die Gitter-
schmiedekunst im 17. Jahrhundert — seit den Zeiten
der Gotik zum ersten Male — für den eigentlichen
Körper des Gitters mit Vorliebe wieder zu den geraden
Eisenstäben griff, nahe, dieselben derartig anzufertigen,
dass man eine Anzahl gerader Stäbe vom Mittelpunkt
des Halbkreises aus radial auseinander laufen Hess;
führte man nun die Kreuzungsstäbe, statt sie gerad-
linig-horizontal anzubringen, halbkreisförmig gebogen,
konzentrisch zum äusseren Umfang, so brauchten diese
konzentrischen Halbkreisbögen, je näher dem Mittel-
punkte, nur um so näher aneinandergerückt zu werden,
um einen dem Kunstgeiste der damaligen Zeit eben
naheliegenden perspektivischen Eindruck hervorzu-
rufen, der die Existenz des Gitters gleichsam hinweg-
täuschte, um seine Dekoration als Ansicht der ge-
wölbten, kassettirten Decke einer hinter dem Thore
liegenden Halle erscheinen zu lassen.
Von den Oberlichtöffnungen der Thore dürfte
dann das perspektivische Gitter zunächst in die Garten-
anlagen Eingang gefunden haben, die eben damals —
zu Beginn des 18. Jahrhunderts — als Folie zu den
pompösen Schlössern des Barock in bisher ungeahnter
Grossartigkeit und speciell mit ebenso häufiger als
geschickter Verwertung der wirklichen wie der Schein-
perspektive zur Ausführung gelangten.
Hier nun war das perspektivische Gitter in vielen
Fällen thatsächlich im höchsten Grade am Platze und
musste den Gartenkünstlern als geradezu unentbehr-
liches Requisit zur Erzielung ihrer perspektivischen
Effekte erscheinen. — Als Umzäunung wurde das
perspektivische Gitter selbstredend nicht verwandt: hier
mussten entsprechend der feudalen Etikette der Zeit,
die die Paläste und die Parks der vornehmen Stände
den niederen Staubgeborenen streng verschluss, Gitter
Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.
FLÄCHENDEKORATION UND PERSPEKTIVE
Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.
sicherlich ist als wichtigste Quelle für ihren Ursprung
die ganz auf malerische, perspektivische Wirkung hin-
zielende Tendenz des damaligen Kunstgeistes im all-
gemeinen anzusehen, und es ist wohl mehr als wahr-
scheinlich, dass die Gitterschmiedekunst, die ja mit
ihren geraden Stäben mit fast derselben Leichtigkeit
eine Perspektive vortäuschen kann, wie der Zeichner
mit der Linie auf dem Papier, zur Einführung jener
eigentümlichen Dekorationsmanier eines Anstosses sei-
tens eines anderen Gebietes der Kunstthätigkeit nicht
bedurft, sondern sie direkt unter dem Einflüsse der
allgemeinen Kunsttendenz der Zeit erfunden habe.
Wann die perspektivischen Gitter zum ersten Male
aufgetreten sind, dürfte bei der gegenüber anderen Ge-
bieten der Kunstgewerbe-Geschichte stark zurückge-
bliebenen Sichtung des Materials ebenso wenig mit Be-
stimmtheit angegeben werden können, wie die Frage
beantwortet werden kann, wo dies der Fall war.
In letzterer Hinsicht scheint es mit einiger Be-
stimmtheit anzunehmen zu sein, dass die perspek-
tivischen Gitter weitaus weniger häufig in romanischen
Ländern auftreten als in deutschen, und hier wieder
in den nördlicheren Gegenden beträchtlich seltener
als in den südlicheren; doch lässt die ungemeine
Lückenhaftigkeit des vorliegenden Materials es, wie
gesagt, keineswegs zu, aus diesen Erscheinungen end-
gültige Schlussfolgerungen zu ziehen.
Bezüglich der Zeitfrage kann, obzwar bereits die
Gitter der Spätrenaissance ab und zu bescheidene An-
sätze zu perspektivischer Dekoration zeigen, gesagt
werden, dass die Blütezeit des perspektivischen Gitters
dem Ende der Barockepoche und ihrem Übergang ins
Rokoko näher liegt, als ihren Anfängen.
Was betreffs der Einführung der perspektivischen
Dekoration die Priorität der einzelnen Gebiete der
Gitterschmiedekunst untereinander anbelangt, so scheint
es mir gerechtfertigt, dieselbe dem Gebiet des Ober-
lichtgitters zuzusprechen: bei Anfertigung der meist
halbkreisförmigen Gitter über den Thürflügeln der
Thore lag es von dem Augenblicke an, als die Gitter-
schmiedekunst im 17. Jahrhundert — seit den Zeiten
der Gotik zum ersten Male — für den eigentlichen
Körper des Gitters mit Vorliebe wieder zu den geraden
Eisenstäben griff, nahe, dieselben derartig anzufertigen,
dass man eine Anzahl gerader Stäbe vom Mittelpunkt
des Halbkreises aus radial auseinander laufen Hess;
führte man nun die Kreuzungsstäbe, statt sie gerad-
linig-horizontal anzubringen, halbkreisförmig gebogen,
konzentrisch zum äusseren Umfang, so brauchten diese
konzentrischen Halbkreisbögen, je näher dem Mittel-
punkte, nur um so näher aneinandergerückt zu werden,
um einen dem Kunstgeiste der damaligen Zeit eben
naheliegenden perspektivischen Eindruck hervorzu-
rufen, der die Existenz des Gitters gleichsam hinweg-
täuschte, um seine Dekoration als Ansicht der ge-
wölbten, kassettirten Decke einer hinter dem Thore
liegenden Halle erscheinen zu lassen.
Von den Oberlichtöffnungen der Thore dürfte
dann das perspektivische Gitter zunächst in die Garten-
anlagen Eingang gefunden haben, die eben damals —
zu Beginn des 18. Jahrhunderts — als Folie zu den
pompösen Schlössern des Barock in bisher ungeahnter
Grossartigkeit und speciell mit ebenso häufiger als
geschickter Verwertung der wirklichen wie der Schein-
perspektive zur Ausführung gelangten.
Hier nun war das perspektivische Gitter in vielen
Fällen thatsächlich im höchsten Grade am Platze und
musste den Gartenkünstlern als geradezu unentbehr-
liches Requisit zur Erzielung ihrer perspektivischen
Effekte erscheinen. — Als Umzäunung wurde das
perspektivische Gitter selbstredend nicht verwandt: hier
mussten entsprechend der feudalen Etikette der Zeit,
die die Paläste und die Parks der vornehmen Stände
den niederen Staubgeborenen streng verschluss, Gitter
Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.