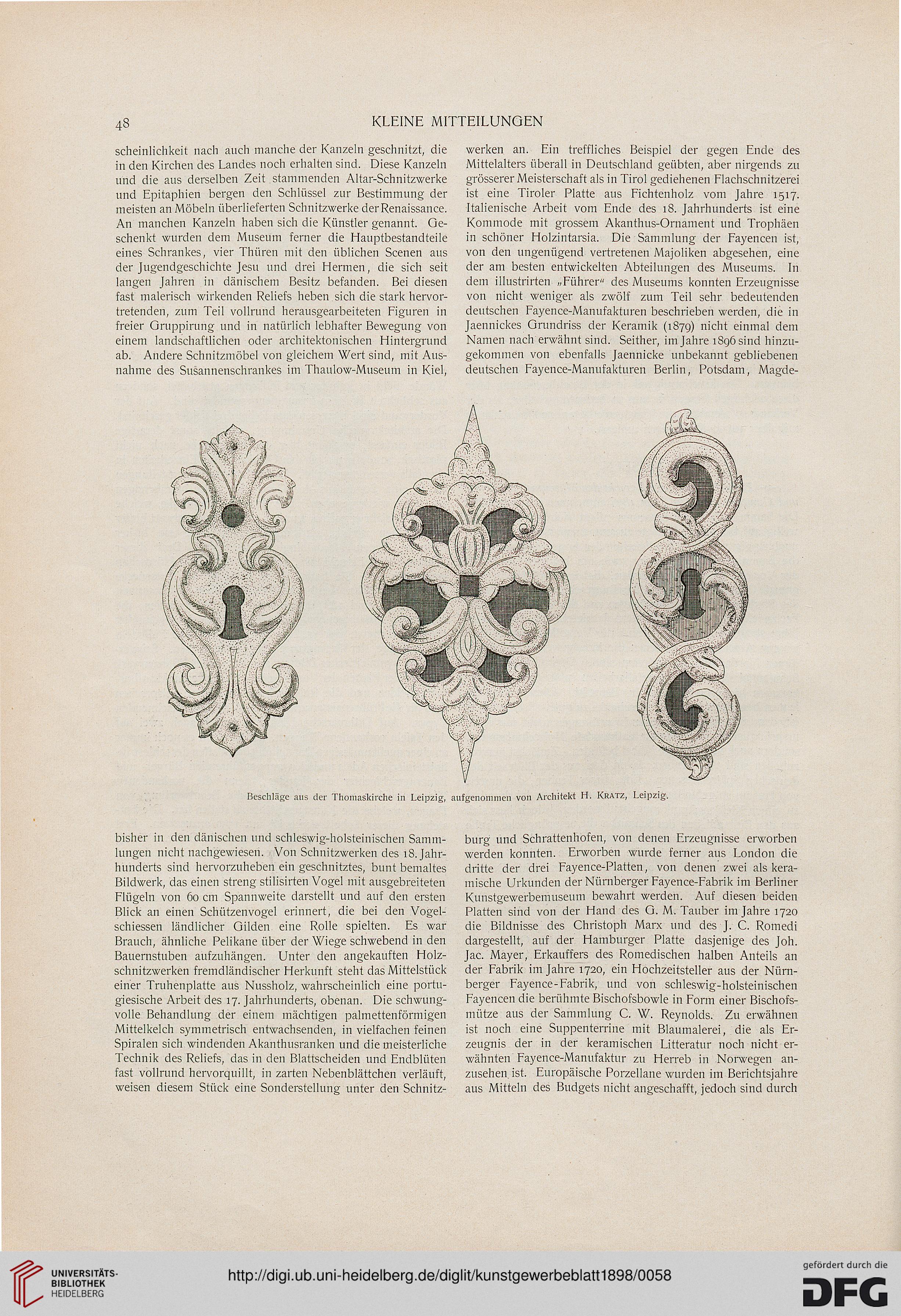48
KLEINE MITTEILUNGEN
scheinlichkeit nach auch manche der Kanzeln geschnitzt, die
in den Kirchen des Landes noch erhalten sind. Diese Kanzeln
und die aus derselben Zeit stammenden Altar-Schnitzwerke
und Epitaphien bergen den Schlüssel zur Bestimmung der
meisten an Möbeln überlieferten Schnitzwerke der Renaissance.
An manchen Kanzeln haben sich die Künstler genannt. Ge-
schenkt wurden dem Museum ferner die Hauptbestandteile
eines Schrankes, vier Thüren mit den üblichen Scenen aus
der Jugendgeschichte Jesu und drei Hermen, die sich seit
langen Jahren in dänischem Besitz befanden. Bei diesen
fast malerisch wirkenden Reliefs heben sich die stark hervor-
tretenden, zum Teil vollrund herausgearbeiteten Figuren in
freier Gruppirung und in natürlich lebhafter Bewegung von
einem landschaftlichen oder architektonischen Hintergrund
ab. Andere Schnitzmöbel von gleichem Wert sind, mit Aus-
nahme des Susannenschrankes im Thaulow-Museum in Kiel,
werken an. Ein treffliches Beispiel der gegen Ende des
Mittelalters überall in Deutschland geübten, aber nirgends zu
grösserer Meisterschaft als in Tirol gediehenen Flachschnitzerei
ist eine Tiroler Platte aus Fichtenholz vom Jahre 1517.
Italienische Arbeit vom Ende des 18. Jahrhunderts ist eine
Kommode mit grossem Akanthus-Ornament und Trophäen
in schöner Holzintarsia. Die Sammlung der Fayencen ist,
von den ungenügend vertretenen Majoliken abgesehen, eine
der am besten entwickelten Abteilungen des Museums. In
dem illustrirten „Führer" des Museums konnten Erzeugnisse
von nicht weniger als zwölf zum Teil sehr bedeutenden
deutschen Fayence-Manufakturen beschrieben werden, die in
Jaennickes Grundriss der Keramik (187g) nicht einmal dem
Namen nach erwähnt sind. Seither, im Jahre 1896 sind hinzu-
gekommen von ebenfalls Jaennicke unbekannt gebliebenen
deutschen Fayence-Manufakturen Berlin, Potsdam, Magde-
Beschläge aus der Thomaskirche in Leipzig, aufgenommen von Architekt H. Kratz, Leipzig.
bisher in den dänischen und schleswig-holsteinischen Samm-
lungen nicht nachgewiesen. Von Schnitzwerken des 18. Jahr-
hunderts sind hervorzuheben ein geschnitztes, bunt bemaltes
Bildwerk, das einen streng stilisirten Vogel mit ausgebreiteten
Flügeln von 60 cm Spannweite darstellt und auf den ersten
Blick an einen Schützenvogel erinnert, die bei den Vogel-
schiessen ländlicher Gilden eine Rolle spielten. Es war
Brauch, ähnliche Pelikane über der Wiege schwebend in den
Bauernstuben aufzuhängen. Unter den angekauften Holz-
schnitzwerken fremdländischer Herkunft steht das Mittelstück
einer Truhenplatte aus Nussholz, wahrscheinlich eine portu-
giesische Arbeit des 17. Jahrhunderts, obenan. Die schwung-
volle Behandlung der einem mächtigen palmettenförmigen
Mittelkelch symmetrisch entwachsenden, in vielfachen feinen
Spiralen sich windenden Akanthusranken und die meisterliche
Technik des Reliefs, das in den Blattscheiden und Endblüten
fast vollrund hervorquillt, in zarten Nebenblättchen verläuft,
weisen diesem Stück eine Sonderstellung unter den Schnitz-
burg und Schrattenhofen, von denen Erzeugnisse erworben
werden konnten. Erworben wurde ferner aus London die
dritte der drei Fayence-Platten, von denen zwei als kera-
mische Urkunden der Nürnberger Fayence-Fabrik im Berliner
Kunstgewerbemuseum bewahrt werden. Auf diesen beiden
Platten sind von der Hand des G. M. Tauber im Jahre 1720
die Bildnisse des Christoph Marx und des J. C. Romedi
dargestellt, auf der Hamburger Platte dasjenige des Joh.
Jac. Mayer, Erkauffers des Romedischen halben Anteils an
der Fabrik im Jahre 1720, ein Hochzeitsteller aus der Nürn-
berger Fayence-Fabrik, und von schleswig-holsteinischen
Fayencen die berühmte Bischofsbowle in Form einer Bischofs-
mütze aus der Sammlung C. W. Reynolds. Zu erwähnen
ist noch eine Suppenterrine mit Blaumalerei, die als Er-
zeugnis der in der keramischen Litteratur noch nicht er-
wähnten Fayence-Manufaktur zu Herreb in Norwegen an-
zusehen, ist. Europäische Porzellane wurden im Berichtsjahre
aus Mitteln des Budgets nicht angeschafft, jedoch sind durch
KLEINE MITTEILUNGEN
scheinlichkeit nach auch manche der Kanzeln geschnitzt, die
in den Kirchen des Landes noch erhalten sind. Diese Kanzeln
und die aus derselben Zeit stammenden Altar-Schnitzwerke
und Epitaphien bergen den Schlüssel zur Bestimmung der
meisten an Möbeln überlieferten Schnitzwerke der Renaissance.
An manchen Kanzeln haben sich die Künstler genannt. Ge-
schenkt wurden dem Museum ferner die Hauptbestandteile
eines Schrankes, vier Thüren mit den üblichen Scenen aus
der Jugendgeschichte Jesu und drei Hermen, die sich seit
langen Jahren in dänischem Besitz befanden. Bei diesen
fast malerisch wirkenden Reliefs heben sich die stark hervor-
tretenden, zum Teil vollrund herausgearbeiteten Figuren in
freier Gruppirung und in natürlich lebhafter Bewegung von
einem landschaftlichen oder architektonischen Hintergrund
ab. Andere Schnitzmöbel von gleichem Wert sind, mit Aus-
nahme des Susannenschrankes im Thaulow-Museum in Kiel,
werken an. Ein treffliches Beispiel der gegen Ende des
Mittelalters überall in Deutschland geübten, aber nirgends zu
grösserer Meisterschaft als in Tirol gediehenen Flachschnitzerei
ist eine Tiroler Platte aus Fichtenholz vom Jahre 1517.
Italienische Arbeit vom Ende des 18. Jahrhunderts ist eine
Kommode mit grossem Akanthus-Ornament und Trophäen
in schöner Holzintarsia. Die Sammlung der Fayencen ist,
von den ungenügend vertretenen Majoliken abgesehen, eine
der am besten entwickelten Abteilungen des Museums. In
dem illustrirten „Führer" des Museums konnten Erzeugnisse
von nicht weniger als zwölf zum Teil sehr bedeutenden
deutschen Fayence-Manufakturen beschrieben werden, die in
Jaennickes Grundriss der Keramik (187g) nicht einmal dem
Namen nach erwähnt sind. Seither, im Jahre 1896 sind hinzu-
gekommen von ebenfalls Jaennicke unbekannt gebliebenen
deutschen Fayence-Manufakturen Berlin, Potsdam, Magde-
Beschläge aus der Thomaskirche in Leipzig, aufgenommen von Architekt H. Kratz, Leipzig.
bisher in den dänischen und schleswig-holsteinischen Samm-
lungen nicht nachgewiesen. Von Schnitzwerken des 18. Jahr-
hunderts sind hervorzuheben ein geschnitztes, bunt bemaltes
Bildwerk, das einen streng stilisirten Vogel mit ausgebreiteten
Flügeln von 60 cm Spannweite darstellt und auf den ersten
Blick an einen Schützenvogel erinnert, die bei den Vogel-
schiessen ländlicher Gilden eine Rolle spielten. Es war
Brauch, ähnliche Pelikane über der Wiege schwebend in den
Bauernstuben aufzuhängen. Unter den angekauften Holz-
schnitzwerken fremdländischer Herkunft steht das Mittelstück
einer Truhenplatte aus Nussholz, wahrscheinlich eine portu-
giesische Arbeit des 17. Jahrhunderts, obenan. Die schwung-
volle Behandlung der einem mächtigen palmettenförmigen
Mittelkelch symmetrisch entwachsenden, in vielfachen feinen
Spiralen sich windenden Akanthusranken und die meisterliche
Technik des Reliefs, das in den Blattscheiden und Endblüten
fast vollrund hervorquillt, in zarten Nebenblättchen verläuft,
weisen diesem Stück eine Sonderstellung unter den Schnitz-
burg und Schrattenhofen, von denen Erzeugnisse erworben
werden konnten. Erworben wurde ferner aus London die
dritte der drei Fayence-Platten, von denen zwei als kera-
mische Urkunden der Nürnberger Fayence-Fabrik im Berliner
Kunstgewerbemuseum bewahrt werden. Auf diesen beiden
Platten sind von der Hand des G. M. Tauber im Jahre 1720
die Bildnisse des Christoph Marx und des J. C. Romedi
dargestellt, auf der Hamburger Platte dasjenige des Joh.
Jac. Mayer, Erkauffers des Romedischen halben Anteils an
der Fabrik im Jahre 1720, ein Hochzeitsteller aus der Nürn-
berger Fayence-Fabrik, und von schleswig-holsteinischen
Fayencen die berühmte Bischofsbowle in Form einer Bischofs-
mütze aus der Sammlung C. W. Reynolds. Zu erwähnen
ist noch eine Suppenterrine mit Blaumalerei, die als Er-
zeugnis der in der keramischen Litteratur noch nicht er-
wähnten Fayence-Manufaktur zu Herreb in Norwegen an-
zusehen, ist. Europäische Porzellane wurden im Berichtsjahre
aus Mitteln des Budgets nicht angeschafft, jedoch sind durch