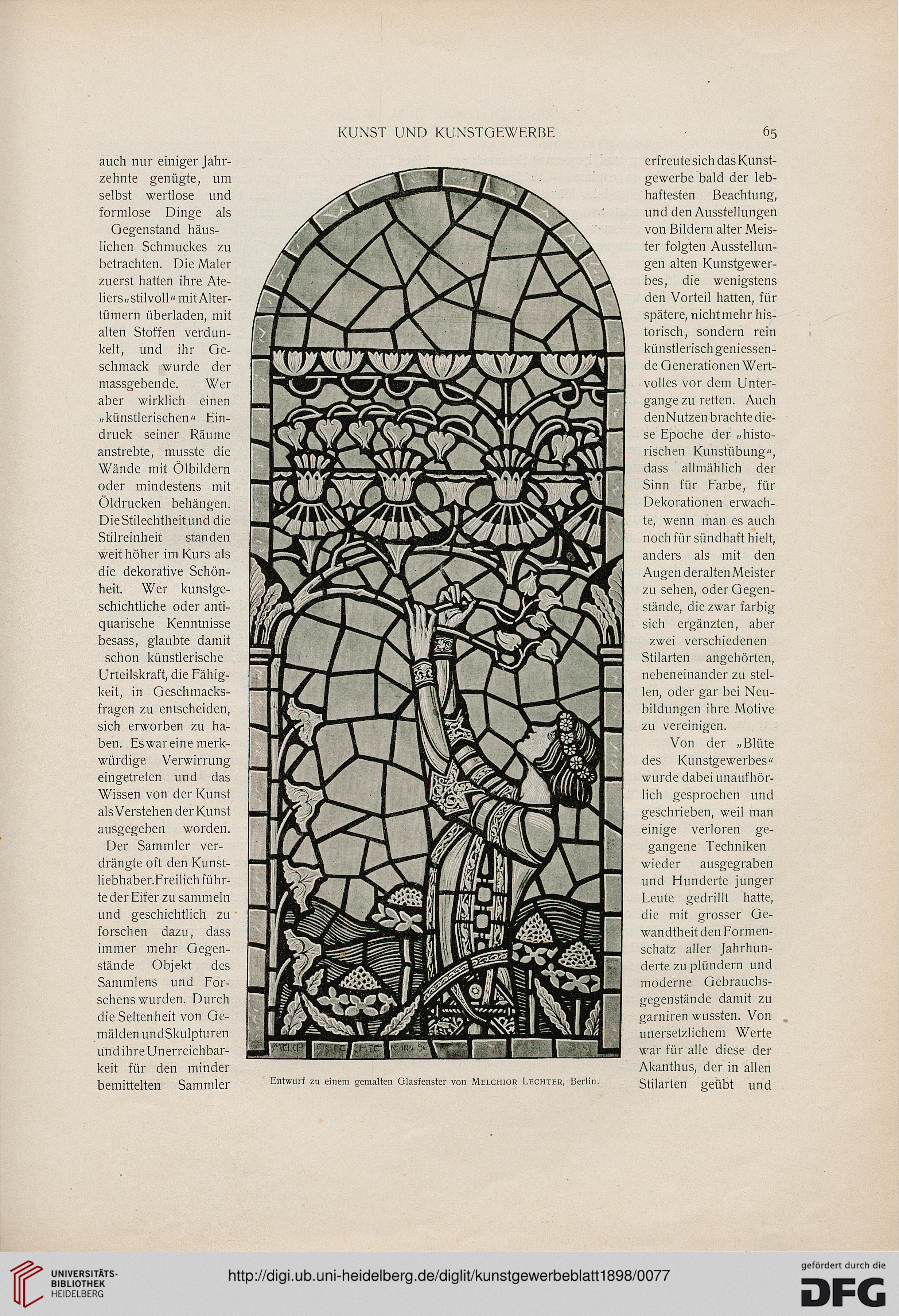KUNST UND KUNSTGEWERBE
65
auch nur einiger Jahr-
zehnte genügte, um
selbst wertlose und
formlose Dinge als
Gegenstand häus-
lichen Schmuckes zu
betrachten. Die Maler
zuerst hatten ihre Ate-
liers;, stilvoll" mit Alter-
tümern überladen, mit
alten Stoffen verdun-
kelt, und ihr Ge-
schmack wurde der
massgebende. Wer
aber wirklich einen
„künstlerischen" Ein-
druck seiner Räume
anstrebte, musste die
Wände mit Ölbildern
oder mindestens mit
Öldrucken behängen.
DieStilechtheitund die
Stilreinheit standen
weit höher im Kurs als
die dekorative Schön-
heit. Wer kunstge-
schichtliche oder anti-
quarische Kenntnisse
besass, glaubte damit
schon künstlerische
Urteilskraft, die Fähig-
keit, in Geschmacks-
fragen zu entscheiden,
sich erworben zu ha-
ben. Es war eine merk-
würdige Verwirrung
eingetreten und das
Wissen von der Kunst
als Verstehen der Kunst
ausgegeben worden.
Der Sammler ver-
drängte oft den Kunst-
liebhaber.Freilich führ-
te der Eifer zu sammeln
und geschichtlich zu
forschen dazu, dass
immer mehr Gegen-
stände Objekt des
Sammlens und For-
schens wurden. Durch
die Seltenheit von Ge-
mälden undSkulpturen
und ihre Unerreichbar-
keit für den minder
bemittelten Sammler
Entwurf zu einem gemalten Glasfenster von Melchior Lechter, Berlin.
erfreute sich das Kunst-
gewerbe bald der leb-
haftesten Beachtung,
und den Ausstellungen
von Bildern alter Meis-
ter folgten Ausstellun-
gen alten Kunstgewer-
bes, die wenigstens
den Vorteil hatten, für
spätere, nicht mehr his-
torisch, sondern rein
künstlerisch geniessen-
de Generationen Wert-
volles vor dem Unter-
gange zu retten. Auch
denNutzen brachte die-
se Epoche der „histo-
rischen Kunstübung",
dass allmählich der
Sinn für Farbe, für
Dekorationen erwach-
te, wenn man es auch
noch für sündhaft hielt,
anders als mit den
Augen deralten Meister
zu sehen, oder Gegen-
stände, die zwar farbig
sich ergänzten, aber
zwei verschiedenen
Stilarten angehörten,
nebeneinander zu stel-
len, oder gar bei Neu-
bildungen ihre Motive
zu vereinigen.
Von der „Blüte
des Kunstgewerbes"
wurde dabei unaufhör-
lich gesprochen und
geschrieben, weil man
einige verloren ge-
gangene Techniken
wieder ausgegraben
und Hunderte junger
Leute gedrillt hatte,
die mit grosser Ge-
wandtheit den Formen-
schatz aller Jahrhun-
derte zu plündern und
moderne Gebrauchs-
gegenstände damit zu
garniren wussten. Von
unersetzlichem Werte
war für alle diese der
Akanthus, der in allen
Stilarten geübt und
65
auch nur einiger Jahr-
zehnte genügte, um
selbst wertlose und
formlose Dinge als
Gegenstand häus-
lichen Schmuckes zu
betrachten. Die Maler
zuerst hatten ihre Ate-
liers;, stilvoll" mit Alter-
tümern überladen, mit
alten Stoffen verdun-
kelt, und ihr Ge-
schmack wurde der
massgebende. Wer
aber wirklich einen
„künstlerischen" Ein-
druck seiner Räume
anstrebte, musste die
Wände mit Ölbildern
oder mindestens mit
Öldrucken behängen.
DieStilechtheitund die
Stilreinheit standen
weit höher im Kurs als
die dekorative Schön-
heit. Wer kunstge-
schichtliche oder anti-
quarische Kenntnisse
besass, glaubte damit
schon künstlerische
Urteilskraft, die Fähig-
keit, in Geschmacks-
fragen zu entscheiden,
sich erworben zu ha-
ben. Es war eine merk-
würdige Verwirrung
eingetreten und das
Wissen von der Kunst
als Verstehen der Kunst
ausgegeben worden.
Der Sammler ver-
drängte oft den Kunst-
liebhaber.Freilich führ-
te der Eifer zu sammeln
und geschichtlich zu
forschen dazu, dass
immer mehr Gegen-
stände Objekt des
Sammlens und For-
schens wurden. Durch
die Seltenheit von Ge-
mälden undSkulpturen
und ihre Unerreichbar-
keit für den minder
bemittelten Sammler
Entwurf zu einem gemalten Glasfenster von Melchior Lechter, Berlin.
erfreute sich das Kunst-
gewerbe bald der leb-
haftesten Beachtung,
und den Ausstellungen
von Bildern alter Meis-
ter folgten Ausstellun-
gen alten Kunstgewer-
bes, die wenigstens
den Vorteil hatten, für
spätere, nicht mehr his-
torisch, sondern rein
künstlerisch geniessen-
de Generationen Wert-
volles vor dem Unter-
gange zu retten. Auch
denNutzen brachte die-
se Epoche der „histo-
rischen Kunstübung",
dass allmählich der
Sinn für Farbe, für
Dekorationen erwach-
te, wenn man es auch
noch für sündhaft hielt,
anders als mit den
Augen deralten Meister
zu sehen, oder Gegen-
stände, die zwar farbig
sich ergänzten, aber
zwei verschiedenen
Stilarten angehörten,
nebeneinander zu stel-
len, oder gar bei Neu-
bildungen ihre Motive
zu vereinigen.
Von der „Blüte
des Kunstgewerbes"
wurde dabei unaufhör-
lich gesprochen und
geschrieben, weil man
einige verloren ge-
gangene Techniken
wieder ausgegraben
und Hunderte junger
Leute gedrillt hatte,
die mit grosser Ge-
wandtheit den Formen-
schatz aller Jahrhun-
derte zu plündern und
moderne Gebrauchs-
gegenstände damit zu
garniren wussten. Von
unersetzlichem Werte
war für alle diese der
Akanthus, der in allen
Stilarten geübt und