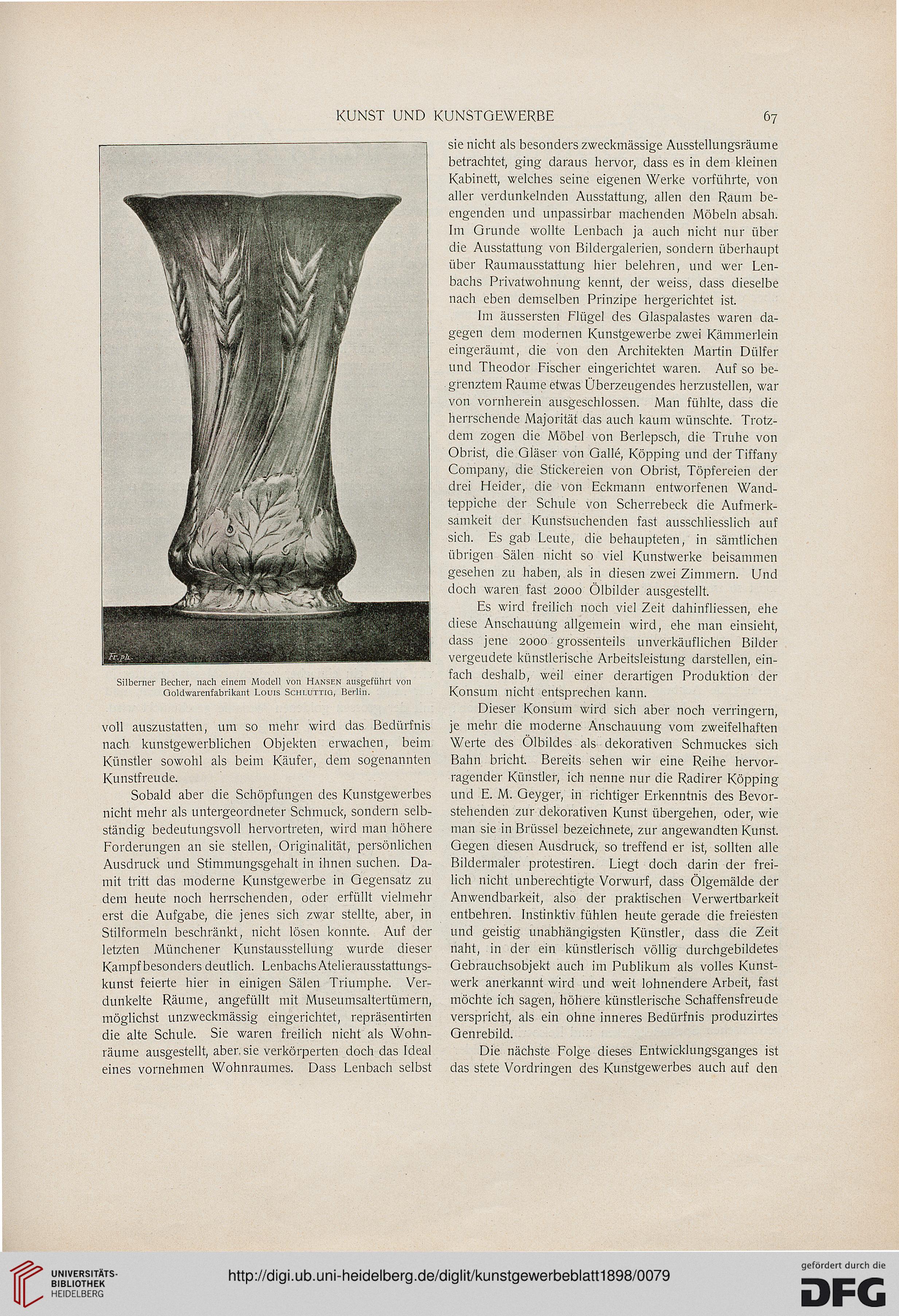KUNST UND KUNSTGEWERBE
67
Silberner Becher, nach einem Modell von Hansen ausgeführt von
Qoldwarenfabrikant Louis Schlüttiq, Berlin.
voll auszustatten, um so mehr wird das Bedürfnis
nach kunstgewerblichen Objekten erwachen, beim
Künstler sowohl als beim Käufer, dem sogenannten
Kunstfreude.
Sobald aber die Schöpfungen des Kunstgewerbes
nicht mehr als untergeordneter Schmuck, sondern selb-
ständig bedeutungsvoll hervortreten, wird man höhere
Forderungen an sie stellen, Originalität, persönlichen
Ausdruck und Stimmungsgehalt in ihnen suchen. Da-
mit tritt das moderne Kunstgewerbe in Gegensatz zu
dem heute noch herrschenden, oder erfüllt vielmehr
erst die Aufgabe, die jenes sich zwar stellte, aber, in
Stilformeln beschränkt, nicht lösen konnte. Auf der
letzten Münchener Kunstausstellung wurde dieser
Kampf besonders deutlich. Lenbachs Atelierausstattungs-
kunst feierte hier in einigen Sälen Triumphe. Ver-
dunkelte Räume, angefüllt mit Museumsaltertümern,
möglichst unzweckmässig eingerichtet, repräsentirten
die alte Schule. Sie waren freilich nicht als Wohn-
räume ausgestellt, aber, sie verkörperten doch das Ideal
eines vornehmen Wohnraumes. Dass Lenbach selbst
sie nicht als besonders zweckmässige Ausstellungsräume
betrachtet, ging daraus hervor, dass es in dem kleinen
Kabinett, welches seine eigenen Werke vorführte, von
aller verdunkelnden Ausstattung, allen den Raum be-
engenden und unpassirbar machenden Möbeln absah.
Im Grunde wollte Lenbach ja auch nicht nur über
die Ausstattung von Bildergalerien, sondern überhaupt
über Raumausstattung hier belehren, und wer Len-
bachs Privatwohnung kennt, der weiss, dass dieselbe
nach eben demselben Prinzipe hergerichtet ist.
Im äussersten Flügel des Glaspalastes waren da-
gegen dem modernen Kunstgewerbe zwei Kämmerlein
eingeräumt, die von den Architekten Martin Dülfer
und Theodor Fischer eingerichtet waren. Auf so be-
grenztem Räume etwas Überzeugendes herzustellen, war
von vornherein ausgeschlossen. Man fühlte, dass die
herrschende Majorität das auch kaum wünschte. Trotz-
dem zogen die Möbel von Berlepsch, die Truhe von
Obrist, die Gläser von Galle, Köpping und derTiffany
Company, die Stickereien von Obrist, Töpfereien der
drei Heider, die von Eckmann entworfenen Wand-
teppiche der Schule von Scherrebeck die Aufmerk-
samkeit der Kunstsuchenden fast ausschliesslich auf
sich. Es gab Leute, die behaupteten, in sämtlichen
übrigen Sälen nicht so viel Kunstwerke beisammen
gesehen zu haben, als in diesen zwei Zimmern. Und
doch waren fast 2000 Ölbilder ausgestellt.
Es wird freilich noch viel Zeit dahinfliessen, ehe
diese Anschauung allgemein wird, ehe man einsieht,
dass jene 2000 grossenteils unverkäuflichen Bilder
vergeudete künstlerische Arbeitsleistung darstellen, ein-
fach deshalb, weil einer derartigen Produktion der
Konsum nicht entsprechen kann.
Dieser Konsum wird sich aber noch verringern,
je mehr die moderne Anschauung vom zweifelhaften
Werte des Ölbildes als dekorativen Schmuckes sich
Bahn bricht. Bereits sehen wir eine Reihe hervor-
ragender Künstler, ich nenne nur die Radirer Köpping
und E. M. Geyger, in richtiger Erkenntnis des Bevor-
stehenden zur dekorativen Kunst übergehen, oder, wie
man sie in Brüssel bezeichnete, zur angewandten Kunst.
Gegen diesen Ausdruck, so treffend er ist, sollten alle
Bildermaler protestiren. Liegt doch darin der frei-
lich nicht unberechtigte Vorwurf, dass Ölgemälde der
Anwendbarkeit, also der praktischen Verwertbarkeit
entbehren. Instinktiv fühlen heute gerade die freiesten
und geistig unabhängigsten Künstler, dass die Zeit
naht, in der ein künstlerisch völlig durchgebildetes
Gebrauchsobjekt auch im Publikum als volles Kunst-
werk anerkannt wird und weit lohnendere Arbeit, fast
möchte ich sagen, höhere künstlerische Schaffensfreude
verspricht, als ein ohne inneres Bedürfnis produzirtes
Genrebild.
Die nächste Folge dieses Entwicklungsganges ist
das stete Vordringen des Kunstgewerbes auch auf den
67
Silberner Becher, nach einem Modell von Hansen ausgeführt von
Qoldwarenfabrikant Louis Schlüttiq, Berlin.
voll auszustatten, um so mehr wird das Bedürfnis
nach kunstgewerblichen Objekten erwachen, beim
Künstler sowohl als beim Käufer, dem sogenannten
Kunstfreude.
Sobald aber die Schöpfungen des Kunstgewerbes
nicht mehr als untergeordneter Schmuck, sondern selb-
ständig bedeutungsvoll hervortreten, wird man höhere
Forderungen an sie stellen, Originalität, persönlichen
Ausdruck und Stimmungsgehalt in ihnen suchen. Da-
mit tritt das moderne Kunstgewerbe in Gegensatz zu
dem heute noch herrschenden, oder erfüllt vielmehr
erst die Aufgabe, die jenes sich zwar stellte, aber, in
Stilformeln beschränkt, nicht lösen konnte. Auf der
letzten Münchener Kunstausstellung wurde dieser
Kampf besonders deutlich. Lenbachs Atelierausstattungs-
kunst feierte hier in einigen Sälen Triumphe. Ver-
dunkelte Räume, angefüllt mit Museumsaltertümern,
möglichst unzweckmässig eingerichtet, repräsentirten
die alte Schule. Sie waren freilich nicht als Wohn-
räume ausgestellt, aber, sie verkörperten doch das Ideal
eines vornehmen Wohnraumes. Dass Lenbach selbst
sie nicht als besonders zweckmässige Ausstellungsräume
betrachtet, ging daraus hervor, dass es in dem kleinen
Kabinett, welches seine eigenen Werke vorführte, von
aller verdunkelnden Ausstattung, allen den Raum be-
engenden und unpassirbar machenden Möbeln absah.
Im Grunde wollte Lenbach ja auch nicht nur über
die Ausstattung von Bildergalerien, sondern überhaupt
über Raumausstattung hier belehren, und wer Len-
bachs Privatwohnung kennt, der weiss, dass dieselbe
nach eben demselben Prinzipe hergerichtet ist.
Im äussersten Flügel des Glaspalastes waren da-
gegen dem modernen Kunstgewerbe zwei Kämmerlein
eingeräumt, die von den Architekten Martin Dülfer
und Theodor Fischer eingerichtet waren. Auf so be-
grenztem Räume etwas Überzeugendes herzustellen, war
von vornherein ausgeschlossen. Man fühlte, dass die
herrschende Majorität das auch kaum wünschte. Trotz-
dem zogen die Möbel von Berlepsch, die Truhe von
Obrist, die Gläser von Galle, Köpping und derTiffany
Company, die Stickereien von Obrist, Töpfereien der
drei Heider, die von Eckmann entworfenen Wand-
teppiche der Schule von Scherrebeck die Aufmerk-
samkeit der Kunstsuchenden fast ausschliesslich auf
sich. Es gab Leute, die behaupteten, in sämtlichen
übrigen Sälen nicht so viel Kunstwerke beisammen
gesehen zu haben, als in diesen zwei Zimmern. Und
doch waren fast 2000 Ölbilder ausgestellt.
Es wird freilich noch viel Zeit dahinfliessen, ehe
diese Anschauung allgemein wird, ehe man einsieht,
dass jene 2000 grossenteils unverkäuflichen Bilder
vergeudete künstlerische Arbeitsleistung darstellen, ein-
fach deshalb, weil einer derartigen Produktion der
Konsum nicht entsprechen kann.
Dieser Konsum wird sich aber noch verringern,
je mehr die moderne Anschauung vom zweifelhaften
Werte des Ölbildes als dekorativen Schmuckes sich
Bahn bricht. Bereits sehen wir eine Reihe hervor-
ragender Künstler, ich nenne nur die Radirer Köpping
und E. M. Geyger, in richtiger Erkenntnis des Bevor-
stehenden zur dekorativen Kunst übergehen, oder, wie
man sie in Brüssel bezeichnete, zur angewandten Kunst.
Gegen diesen Ausdruck, so treffend er ist, sollten alle
Bildermaler protestiren. Liegt doch darin der frei-
lich nicht unberechtigte Vorwurf, dass Ölgemälde der
Anwendbarkeit, also der praktischen Verwertbarkeit
entbehren. Instinktiv fühlen heute gerade die freiesten
und geistig unabhängigsten Künstler, dass die Zeit
naht, in der ein künstlerisch völlig durchgebildetes
Gebrauchsobjekt auch im Publikum als volles Kunst-
werk anerkannt wird und weit lohnendere Arbeit, fast
möchte ich sagen, höhere künstlerische Schaffensfreude
verspricht, als ein ohne inneres Bedürfnis produzirtes
Genrebild.
Die nächste Folge dieses Entwicklungsganges ist
das stete Vordringen des Kunstgewerbes auch auf den