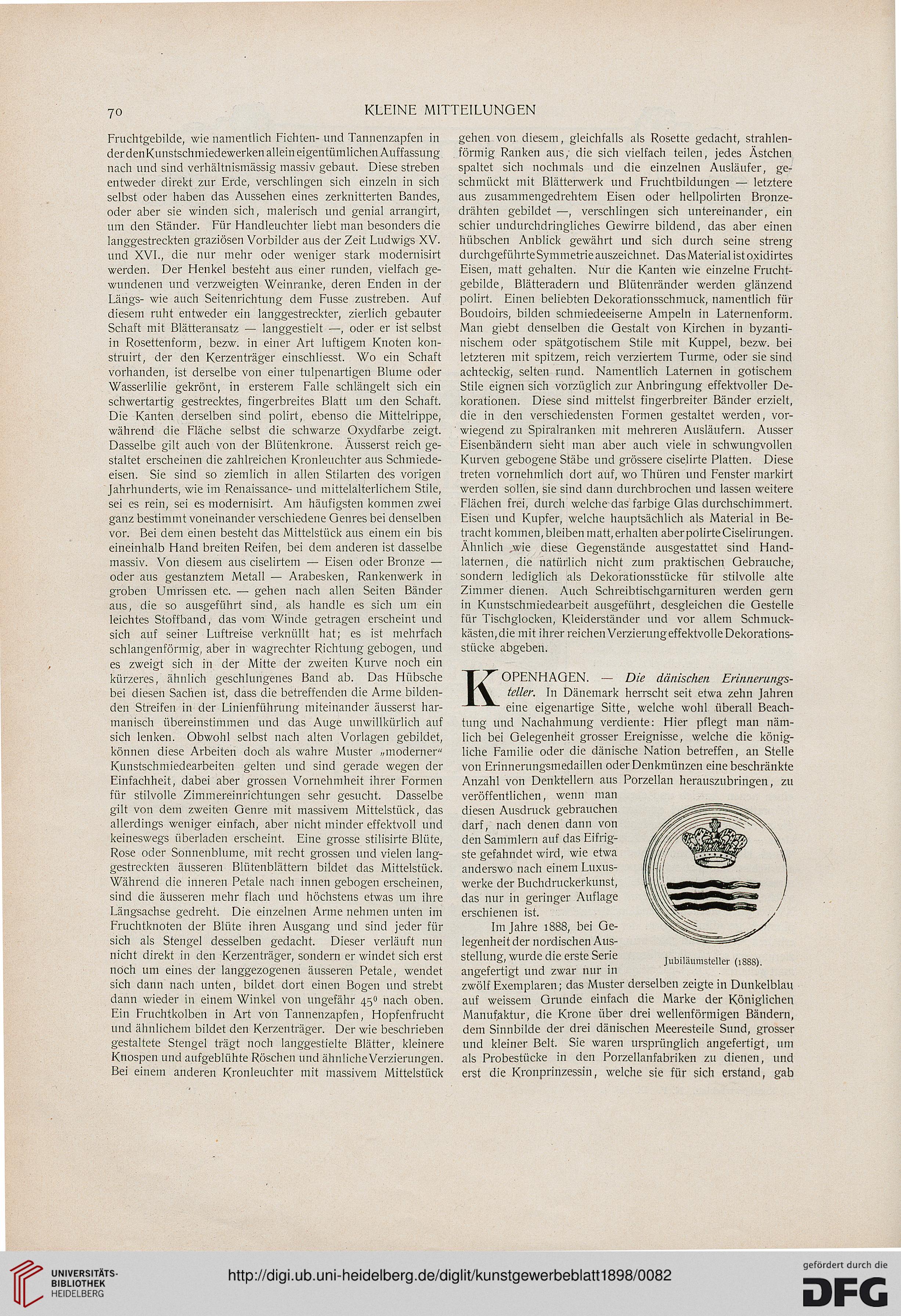70
KLEINE MITTEILUNGEN
Fruchtgebilde, wie namentlich Fichten- und Tannenzapfen in
derdenKunstschmiedewerken allein eigentümlichen Auffassung
nach und sind verhältnismässig massiv gebaut. Diese streben
entweder direkt zur Erde, verschlingen sich einzeln in sich
selbst oder haben das Aussehen eines zerknitterten Bandes,
oder aber sie winden sich, malerisch und genial arrangirt,
um den Ständer. Für Handleuchter liebt man besonders die
langgestreckten graziösen Vorbilder aus der Zeit Ludwigs XV.
und XVI., die nur mehr oder weniger stark modernisirt
werden. Der Henkel besteht aus einer runden, vielfach ge-
wundenen und verzweigten Weinranke, deren Enden in der
Längs- wie auch Seitenrichtung dem Fusse zustreben. Auf
diesem ruht entweder ein langgestreckter, zierlich gebauter
Schaft mit Blätteransatz — langgestielt —, oder er ist selbst
in Rosettenform, bezw. in einer Art luftigem Knoten kon-
struirt, der den Kerzenträger einschliesst. Wo ein Schaft
vorhanden, ist derselbe von einer tulpenartigen Blume oder
Wasserlilie gekrönt, in ersterem Falle schlängelt sich ein
schwertartig gestrecktes, fingerbreites Blatt um den Schaft.
Die Kanten derselben sind polirt, ebenso die Mittelrippe,
während die Fläche selbst die schwarze Oxydfarbe zeigt.
Dasselbe gilt auch von der Blütenkrone. Äusserst reich ge-
staltet erscheinen die zahlreichen Kronleuchter aus Schmiede-
eisen. Sie sind so ziemlich in allen Stilarten des vorigen
Jahrhunderts, wie im Renaissance- und mittelalterlichem Stile,
sei es rein, sei es modernisirt. Am häufigsten kommen zwei
ganz bestimmt voneinander verschiedene Genres bei denselben
vor. Bei dem einen besteht das Mittelstück aus einem ein bis
eineinhalb Hand breiten Reifen, bei dem anderen ist dasselbe
massiv. Von diesem aus ciselirtem — Eisen oder Bronze —
oder aus gestanztem Metall — Arabesken, Rankenwerk in
groben Umrissen etc. — gehen nach allen Seiten Bänder
aus, die so ausgeführt sind, als handle es sich um ein
leichtes Stoffband, das vom Winde getragen erscheint und
sich auf seiner Luftreise verknüllt hat; es ist mehrfach
schlangenförmig, aber in wagrechter Richtung gebogen, und
es zweigt sich in der Mitte der zweiten Kurve noch ein
kürzeres, ähnlich geschlungenes Band ab. Das Hübsche
bei diesen Sachen ist, dass die betreffenden die Arme bilden-
den Streifen in der Linienführung miteinander äusserst har-
manisch übereinstimmen und das Auge unwillkürlich auf
sich lenken. Obwohl selbst nach alten Vorlagen gebildet,
können diese Arbeiten doch als wahre Muster »moderner"
Kunstschmiedearbeiten gelten und sind gerade wegen der
Einfachheit, dabei aber grossen Vornehmheit ihrer Formen
für stilvolle Zimmereinrichtungen sehr gesucht. Dasselbe
gilt von dem zweiten Genre mit massivem Mittelstück, das
allerdings weniger einfach, aber nicht minder effektvoll und
keineswegs überladen erscheint. Eine grosse stilisirte Blüte,
Rose oder Sonnenblume, mit recht grossen und vielen lang-
gestreckten äusseren Blütenblättern bildet das Mittelstück.
Während die inneren Petale nach innen gebogen erscheinen,
sind die äusseren mehr flach und höchstens etwas um ihre
Längsachse gedreht. Die einzelnen Arme nehmen unten im
Fruchtknoten der Blüte ihren Ausgang und sind jeder für
sich als Stengel desselben gedacht. Dieser verläuft nun
nicht direkt in den Kerzenträger, sondern er windet sich erst
noch um eines der langgezogenen äusseren Petale, wendet
sich dann nach unten, bildet dort einen Bogen und strebt
dann wieder in einem Winkel von ungefähr 45° nach oben.
Ein Fruchtkolben in Art von Tannenzapfen, Hopfenfrucht
und ähnlichem bildet den Kerzenträger. Der wie beschrieben
gestaltete Stengel trägt noch langgestielte Blätter, kleinere
Knospen und aufgeblühte Röschen und ähnliche Verzierungen.
Bei einem anderen Kronleuchter mit massivem Mittelstück
gehen von diesem, gleichfalls als Rosette gedacht, strahlen-
förmig Ranken aus, die sich vielfach teilen, jedes Ästchen
spaltet sich nochmals und die einzelnen Ausläufer, ge-
schmückt mit Blätterwerk und Fruchtbildungen — letztere
aus zusammengedrehtem Eisen oder hellpolirten Bronze-
drähten gebildet —, verschlingen sich untereinander, ein
schier undurchdringliches Gewirre bildend, das aber einen
hübschen Anblick gewährt und sich durch seine streng
durchgeführte Symmetrie auszeichnet. Das Material ist oxidirtes
Eisen, matt gehalten. Nur die Kanten wie einzelne Frucht-
gebilde, Blätteradern und Blütenränder werden glänzend
polirt. Einen beliebten Dekorationsschmuck, namentlich für
Boudoirs, bilden schmiedeeiserne Ampeln in Laternenform.
Man giebt denselben die Gestalt von Kirchen in byzanti-
nischem oder spätgotischem Stile mit Kuppel, bezw. bei
letzteren mit spitzem, reich verziertem Turme, oder sie sind
achteckig, selten rund. Namentlich Laternen in gotischem
Stile eignen sich vorzüglich zur Anbringung effektvoller De-
korationen. Diese sind mittelst fingerbreiter Bänder erzielt,
die in den verschiedensten Formen gestaltet werden, vor-
wiegend zu Spiralranken mit mehreren Ausläufern. Ausser
Eisenbändern sieht man aber auch viele in schwungvollen
Kurven gebogene Stäbe und grössere ciselirte Platten. Diese
treten vornehmlich dort auf, wo Thüren und Fenster markirt
werden sollen, sie sind dann durchbrochen und lassen weitere
Flächen frei, durch welche das farbige Glas durchschimmert.
Eisen und Kupfer, welche hauptsächlich als Material in Be-
tracht kommen, bleiben matt, erhalten aberpolirteCiselirungen.
Ähnlich ,wie diese Gegenstände ausgestattet sind Hand-
laternen, die natürlich nicht zum praktischen Gebrauche,
sondern lediglich als Dekorationsstücke für stilvolle alte
Zimmer dienen. Auch Schreibtischgarnituren werden gern
in Kunstschmiedearbeit ausgeführt, desgleichen die Gestelle
für Tischglocken, Kleiderständer und vor allem Schmuck-
kästen, die mit ihrer reichen Verzierungeffektvolle Dekorations-
stücke abgeben.
KOPENHAGEN. — Die dänischen Erinnerungs-
teller. In Dänemark herrscht seit etwa zehn Jahren
eine eigenartige Sitte, welche wohl überall Beach-
tung und Nachahmung verdiente: Hier pflegt man näm-
lich bei Gelegenheit grosser Ereignisse, welche die könig-
liche Familie oder die dänische Nation betreffen, an Stelle
von Erinnerungsmedaillen oder Denkmünzen eine beschränkte
Anzahl von Denktellern aus Porzellan herauszubringen, zu
veröffentlichen, wenn man
diesen Ausdruck gebrauchen
darf, nach denen dann von
den Sammlern auf das Eifrig-
ste gefahndet wird, wie etwa
anderswo nach einem Luxus-
werke der Buchdruckerkunst,
das nur in geringer Auflage
erschienen ist.
Im Jahre 1888, bei Ge-
legenheit der nordischen Aus-
stellung, wurde die erste Serie
angefertigt und zwar nur in
zwölf Exemplaren; das Muster derselben zeigte in Dunkelblau
auf weissem Grunde einfach die Marke der Königlichen
Manufaktur, die Krone über drei wellenförmigen Bändern,
dem Sinnbilde der drei dänischen Meeresteile Sund, grosser
und kleiner Belt. Sie waren ursprünglich angefertigt, um
als Probestücke in den Porzellanfabriken zu dienen, und
erst die Kronprinzessin, welche sie für sich erstand, gab
Jubiläumsteller (1888).
KLEINE MITTEILUNGEN
Fruchtgebilde, wie namentlich Fichten- und Tannenzapfen in
derdenKunstschmiedewerken allein eigentümlichen Auffassung
nach und sind verhältnismässig massiv gebaut. Diese streben
entweder direkt zur Erde, verschlingen sich einzeln in sich
selbst oder haben das Aussehen eines zerknitterten Bandes,
oder aber sie winden sich, malerisch und genial arrangirt,
um den Ständer. Für Handleuchter liebt man besonders die
langgestreckten graziösen Vorbilder aus der Zeit Ludwigs XV.
und XVI., die nur mehr oder weniger stark modernisirt
werden. Der Henkel besteht aus einer runden, vielfach ge-
wundenen und verzweigten Weinranke, deren Enden in der
Längs- wie auch Seitenrichtung dem Fusse zustreben. Auf
diesem ruht entweder ein langgestreckter, zierlich gebauter
Schaft mit Blätteransatz — langgestielt —, oder er ist selbst
in Rosettenform, bezw. in einer Art luftigem Knoten kon-
struirt, der den Kerzenträger einschliesst. Wo ein Schaft
vorhanden, ist derselbe von einer tulpenartigen Blume oder
Wasserlilie gekrönt, in ersterem Falle schlängelt sich ein
schwertartig gestrecktes, fingerbreites Blatt um den Schaft.
Die Kanten derselben sind polirt, ebenso die Mittelrippe,
während die Fläche selbst die schwarze Oxydfarbe zeigt.
Dasselbe gilt auch von der Blütenkrone. Äusserst reich ge-
staltet erscheinen die zahlreichen Kronleuchter aus Schmiede-
eisen. Sie sind so ziemlich in allen Stilarten des vorigen
Jahrhunderts, wie im Renaissance- und mittelalterlichem Stile,
sei es rein, sei es modernisirt. Am häufigsten kommen zwei
ganz bestimmt voneinander verschiedene Genres bei denselben
vor. Bei dem einen besteht das Mittelstück aus einem ein bis
eineinhalb Hand breiten Reifen, bei dem anderen ist dasselbe
massiv. Von diesem aus ciselirtem — Eisen oder Bronze —
oder aus gestanztem Metall — Arabesken, Rankenwerk in
groben Umrissen etc. — gehen nach allen Seiten Bänder
aus, die so ausgeführt sind, als handle es sich um ein
leichtes Stoffband, das vom Winde getragen erscheint und
sich auf seiner Luftreise verknüllt hat; es ist mehrfach
schlangenförmig, aber in wagrechter Richtung gebogen, und
es zweigt sich in der Mitte der zweiten Kurve noch ein
kürzeres, ähnlich geschlungenes Band ab. Das Hübsche
bei diesen Sachen ist, dass die betreffenden die Arme bilden-
den Streifen in der Linienführung miteinander äusserst har-
manisch übereinstimmen und das Auge unwillkürlich auf
sich lenken. Obwohl selbst nach alten Vorlagen gebildet,
können diese Arbeiten doch als wahre Muster »moderner"
Kunstschmiedearbeiten gelten und sind gerade wegen der
Einfachheit, dabei aber grossen Vornehmheit ihrer Formen
für stilvolle Zimmereinrichtungen sehr gesucht. Dasselbe
gilt von dem zweiten Genre mit massivem Mittelstück, das
allerdings weniger einfach, aber nicht minder effektvoll und
keineswegs überladen erscheint. Eine grosse stilisirte Blüte,
Rose oder Sonnenblume, mit recht grossen und vielen lang-
gestreckten äusseren Blütenblättern bildet das Mittelstück.
Während die inneren Petale nach innen gebogen erscheinen,
sind die äusseren mehr flach und höchstens etwas um ihre
Längsachse gedreht. Die einzelnen Arme nehmen unten im
Fruchtknoten der Blüte ihren Ausgang und sind jeder für
sich als Stengel desselben gedacht. Dieser verläuft nun
nicht direkt in den Kerzenträger, sondern er windet sich erst
noch um eines der langgezogenen äusseren Petale, wendet
sich dann nach unten, bildet dort einen Bogen und strebt
dann wieder in einem Winkel von ungefähr 45° nach oben.
Ein Fruchtkolben in Art von Tannenzapfen, Hopfenfrucht
und ähnlichem bildet den Kerzenträger. Der wie beschrieben
gestaltete Stengel trägt noch langgestielte Blätter, kleinere
Knospen und aufgeblühte Röschen und ähnliche Verzierungen.
Bei einem anderen Kronleuchter mit massivem Mittelstück
gehen von diesem, gleichfalls als Rosette gedacht, strahlen-
förmig Ranken aus, die sich vielfach teilen, jedes Ästchen
spaltet sich nochmals und die einzelnen Ausläufer, ge-
schmückt mit Blätterwerk und Fruchtbildungen — letztere
aus zusammengedrehtem Eisen oder hellpolirten Bronze-
drähten gebildet —, verschlingen sich untereinander, ein
schier undurchdringliches Gewirre bildend, das aber einen
hübschen Anblick gewährt und sich durch seine streng
durchgeführte Symmetrie auszeichnet. Das Material ist oxidirtes
Eisen, matt gehalten. Nur die Kanten wie einzelne Frucht-
gebilde, Blätteradern und Blütenränder werden glänzend
polirt. Einen beliebten Dekorationsschmuck, namentlich für
Boudoirs, bilden schmiedeeiserne Ampeln in Laternenform.
Man giebt denselben die Gestalt von Kirchen in byzanti-
nischem oder spätgotischem Stile mit Kuppel, bezw. bei
letzteren mit spitzem, reich verziertem Turme, oder sie sind
achteckig, selten rund. Namentlich Laternen in gotischem
Stile eignen sich vorzüglich zur Anbringung effektvoller De-
korationen. Diese sind mittelst fingerbreiter Bänder erzielt,
die in den verschiedensten Formen gestaltet werden, vor-
wiegend zu Spiralranken mit mehreren Ausläufern. Ausser
Eisenbändern sieht man aber auch viele in schwungvollen
Kurven gebogene Stäbe und grössere ciselirte Platten. Diese
treten vornehmlich dort auf, wo Thüren und Fenster markirt
werden sollen, sie sind dann durchbrochen und lassen weitere
Flächen frei, durch welche das farbige Glas durchschimmert.
Eisen und Kupfer, welche hauptsächlich als Material in Be-
tracht kommen, bleiben matt, erhalten aberpolirteCiselirungen.
Ähnlich ,wie diese Gegenstände ausgestattet sind Hand-
laternen, die natürlich nicht zum praktischen Gebrauche,
sondern lediglich als Dekorationsstücke für stilvolle alte
Zimmer dienen. Auch Schreibtischgarnituren werden gern
in Kunstschmiedearbeit ausgeführt, desgleichen die Gestelle
für Tischglocken, Kleiderständer und vor allem Schmuck-
kästen, die mit ihrer reichen Verzierungeffektvolle Dekorations-
stücke abgeben.
KOPENHAGEN. — Die dänischen Erinnerungs-
teller. In Dänemark herrscht seit etwa zehn Jahren
eine eigenartige Sitte, welche wohl überall Beach-
tung und Nachahmung verdiente: Hier pflegt man näm-
lich bei Gelegenheit grosser Ereignisse, welche die könig-
liche Familie oder die dänische Nation betreffen, an Stelle
von Erinnerungsmedaillen oder Denkmünzen eine beschränkte
Anzahl von Denktellern aus Porzellan herauszubringen, zu
veröffentlichen, wenn man
diesen Ausdruck gebrauchen
darf, nach denen dann von
den Sammlern auf das Eifrig-
ste gefahndet wird, wie etwa
anderswo nach einem Luxus-
werke der Buchdruckerkunst,
das nur in geringer Auflage
erschienen ist.
Im Jahre 1888, bei Ge-
legenheit der nordischen Aus-
stellung, wurde die erste Serie
angefertigt und zwar nur in
zwölf Exemplaren; das Muster derselben zeigte in Dunkelblau
auf weissem Grunde einfach die Marke der Königlichen
Manufaktur, die Krone über drei wellenförmigen Bändern,
dem Sinnbilde der drei dänischen Meeresteile Sund, grosser
und kleiner Belt. Sie waren ursprünglich angefertigt, um
als Probestücke in den Porzellanfabriken zu dienen, und
erst die Kronprinzessin, welche sie für sich erstand, gab
Jubiläumsteller (1888).