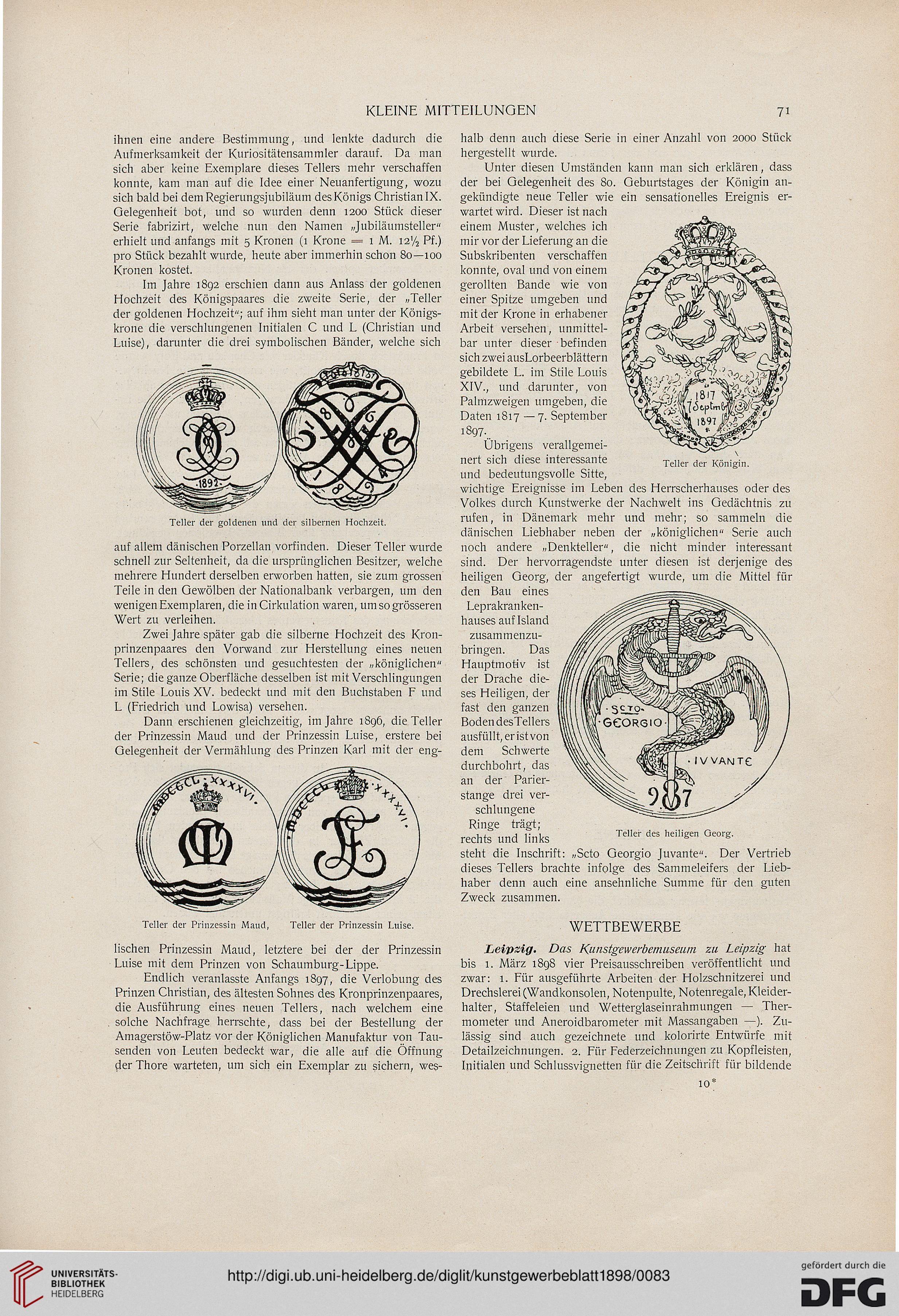KLEINE MITTEILUNGEN
7i
ihnen eine andere Bestimmung, und lenkte dadurch die
Aufmerksamkeit der Kuriositätensammler darauf. Da man
sich aber keine Exemplare dieses Tellers mehr verschaffen
konnte, kam man auf die Idee einer Neuanfertigung, wozu
sich bald bei dem Regierungsjubiläum des Königs Christian IX.
Gelegenheit bot, und so wurden denn 1200 Stück dieser
Serie fabrizirt, welche nun den Namen „Jubiläumsteller"
erhielt und anfangs mit 5 Kronen (1 Krone = 1 M. i2'/2 Pf.)
pro Stück bezahlt wurde, heute aber immerhin schon 80—100
Kronen kostet.
Im Jahre 1892 erschien dann aus Anlass der goldenen
Hochzeit des Königspaares die zweite Serie, der „Teller
der goldenen Hochzeit"; auf ihm sieht man unter der Königs-
krone die verschlungenen Initialen C und L (Christian und
Luise), darunter die drei symbolischen Bänder, welche sich
Teller der goldenen und der silbernen Hochzeit.
auf allem dänischen Porzellan vorfinden. Dieser Teller wurde
schnell zur Seltenheit, da die ursprünglichen Besitzer, welche
mehrere Hundert derselben erworben hatten, sie zum grossen
Teile in den Gewölben der Nationalbank verbargen, um den
wenigen Exemplaren, die inCirkulation waren, um so grösseren
Wert zu verleihen.
Zwei Jahre später gab die silberne Hochzeit des Kron-
prinzenpaares den Vorwand zur Herstellung eines neuen
Tellers, des schönsten und gesuchtesten der „königlichen"
Serie; die ganze Oberfläche desselben ist mit Verschlingungen
im Stile Louis XV. bedeckt und mit den Buchstaben F und
L (Friedrich und Lowisa) versehen.
Dann erschienen gleichzeitig, im Jahre 1896, die Teller
der Prinzessin Maud und der Prinzessin Luise, erstere bei
Gelegenheit der Vermählung des Prinzen Karl mit der eng-
Teller der Prinzessin Maud,
Teller der Prinzessin Luise.
lischen Prinzessin Maud, letztere bei der der Prinzessin
Luise mit dem Prinzen von Schaumburg-Lippe.
Endlich veranlasste Anfangs 1897, die Verlobung des
Prinzen Christian, des ältesten Sohnes des Kronprinzenpaares,
die Ausführung eines neuen Tellers, nach welchem eine
solche Nachfrage herrschte, dass bei der Bestellung der
Amagerstöw-Platz vor der Königlichen Manufaktur von Tau-
senden von Leuten bedeckt war, die alle auf die Öffnung
der Thore warteten, um sich ein Exemplar zu sichern, wes-
Teller der Königin.
halb denn auch diese Serie in einer Anzahl von 2000 Stück
hergestellt wurde.
Unter diesen Umständen kann man sich erklären, dass
der bei Gelegenheit des 80. Geburtstages der Königin au-
gekündigte neue Teller wie ein sensationelles Ereignis er-
wartet wird. Dieser ist nach
einem Muster, welches ich
mir vor der Lieferung an die
Subskribenten verschaffen
konnte, oval und von einem
gerollten Bande wie von
einer Spitze umgeben und
mit der Krone in erhabener
Arbeit versehen, unmittel-
bar unter dieser befinden
sich zwei ausLorbeerblättern
gebildete L. im Stile Louis
XIV., und darunter, von
Palmzweigen umgeben, die
Daten 1817—7. September
l897-..
Übrigens verallgemei-
nert sich diese interessante
und bedeutungsvolle Sitte,
wichtige Ereignisse im Leben des Herrscherhauses oder des
Volkes durch Kunstwerke der Nachwelt ins Gedächtnis zu
rufen, in Dänemark mehr und mehr; so sammeln die
dänischen Liebhaber neben der „königlichen" Serie auch
noch andere „Denkteller", die nicht minder interessant
sind. Der hervorragendste unter diesen ist derjenige des
heiligen Georg, der angefertigt wurde, um die Mittel für
den Bau eines
Leprakranken-
hauses auf Island
zusammenzu-
bringen. Das
Hauptmotiv ist
der Drache die-
ses Heiligen, der
fast den ganzen
Boden des Tellers
ausfüllt, er ist von
dem Schwerte
durchbohrt, das
an der Parier-
stange drei ver-
schlungene
Ringe trägt;
rechts und links
steht die Inschrift: „Scto Georgio Juvante". Der Vertrieb
dieses Tellers brachte infolge des Sammeleifers der Lieb-
haber denn auch eine ansehnliche Summe für den guten
Zweck zusammen.
WETTBEWERBE
Leipzig. Das Kunstgewerbemuseum zu Leipzig hat
bis 1. März 1898 vier Preisausschreiben veröffentlicht und
zwar: 1. Für ausgeführte Arbeiten der Holzschnitzerei und
Drechslerei (Wandkonsolen, Notenpulte, Notenregale, Kleider-
halter, Staffeleien und Wetterglaseinrahmungen — Ther-
mometer und Aneroidbarometer mit Massangaben —). Zu-
lässig sind auch gezeichnete und kolorirte Entwürfe mit
Detailzeichnungen. 2. Für Federzeichnungen zu Kopfleisten,
Initialen und Schlussvignetten für die Zeitschrift für bildende
10*
Teller des heiligen Georg.
7i
ihnen eine andere Bestimmung, und lenkte dadurch die
Aufmerksamkeit der Kuriositätensammler darauf. Da man
sich aber keine Exemplare dieses Tellers mehr verschaffen
konnte, kam man auf die Idee einer Neuanfertigung, wozu
sich bald bei dem Regierungsjubiläum des Königs Christian IX.
Gelegenheit bot, und so wurden denn 1200 Stück dieser
Serie fabrizirt, welche nun den Namen „Jubiläumsteller"
erhielt und anfangs mit 5 Kronen (1 Krone = 1 M. i2'/2 Pf.)
pro Stück bezahlt wurde, heute aber immerhin schon 80—100
Kronen kostet.
Im Jahre 1892 erschien dann aus Anlass der goldenen
Hochzeit des Königspaares die zweite Serie, der „Teller
der goldenen Hochzeit"; auf ihm sieht man unter der Königs-
krone die verschlungenen Initialen C und L (Christian und
Luise), darunter die drei symbolischen Bänder, welche sich
Teller der goldenen und der silbernen Hochzeit.
auf allem dänischen Porzellan vorfinden. Dieser Teller wurde
schnell zur Seltenheit, da die ursprünglichen Besitzer, welche
mehrere Hundert derselben erworben hatten, sie zum grossen
Teile in den Gewölben der Nationalbank verbargen, um den
wenigen Exemplaren, die inCirkulation waren, um so grösseren
Wert zu verleihen.
Zwei Jahre später gab die silberne Hochzeit des Kron-
prinzenpaares den Vorwand zur Herstellung eines neuen
Tellers, des schönsten und gesuchtesten der „königlichen"
Serie; die ganze Oberfläche desselben ist mit Verschlingungen
im Stile Louis XV. bedeckt und mit den Buchstaben F und
L (Friedrich und Lowisa) versehen.
Dann erschienen gleichzeitig, im Jahre 1896, die Teller
der Prinzessin Maud und der Prinzessin Luise, erstere bei
Gelegenheit der Vermählung des Prinzen Karl mit der eng-
Teller der Prinzessin Maud,
Teller der Prinzessin Luise.
lischen Prinzessin Maud, letztere bei der der Prinzessin
Luise mit dem Prinzen von Schaumburg-Lippe.
Endlich veranlasste Anfangs 1897, die Verlobung des
Prinzen Christian, des ältesten Sohnes des Kronprinzenpaares,
die Ausführung eines neuen Tellers, nach welchem eine
solche Nachfrage herrschte, dass bei der Bestellung der
Amagerstöw-Platz vor der Königlichen Manufaktur von Tau-
senden von Leuten bedeckt war, die alle auf die Öffnung
der Thore warteten, um sich ein Exemplar zu sichern, wes-
Teller der Königin.
halb denn auch diese Serie in einer Anzahl von 2000 Stück
hergestellt wurde.
Unter diesen Umständen kann man sich erklären, dass
der bei Gelegenheit des 80. Geburtstages der Königin au-
gekündigte neue Teller wie ein sensationelles Ereignis er-
wartet wird. Dieser ist nach
einem Muster, welches ich
mir vor der Lieferung an die
Subskribenten verschaffen
konnte, oval und von einem
gerollten Bande wie von
einer Spitze umgeben und
mit der Krone in erhabener
Arbeit versehen, unmittel-
bar unter dieser befinden
sich zwei ausLorbeerblättern
gebildete L. im Stile Louis
XIV., und darunter, von
Palmzweigen umgeben, die
Daten 1817—7. September
l897-..
Übrigens verallgemei-
nert sich diese interessante
und bedeutungsvolle Sitte,
wichtige Ereignisse im Leben des Herrscherhauses oder des
Volkes durch Kunstwerke der Nachwelt ins Gedächtnis zu
rufen, in Dänemark mehr und mehr; so sammeln die
dänischen Liebhaber neben der „königlichen" Serie auch
noch andere „Denkteller", die nicht minder interessant
sind. Der hervorragendste unter diesen ist derjenige des
heiligen Georg, der angefertigt wurde, um die Mittel für
den Bau eines
Leprakranken-
hauses auf Island
zusammenzu-
bringen. Das
Hauptmotiv ist
der Drache die-
ses Heiligen, der
fast den ganzen
Boden des Tellers
ausfüllt, er ist von
dem Schwerte
durchbohrt, das
an der Parier-
stange drei ver-
schlungene
Ringe trägt;
rechts und links
steht die Inschrift: „Scto Georgio Juvante". Der Vertrieb
dieses Tellers brachte infolge des Sammeleifers der Lieb-
haber denn auch eine ansehnliche Summe für den guten
Zweck zusammen.
WETTBEWERBE
Leipzig. Das Kunstgewerbemuseum zu Leipzig hat
bis 1. März 1898 vier Preisausschreiben veröffentlicht und
zwar: 1. Für ausgeführte Arbeiten der Holzschnitzerei und
Drechslerei (Wandkonsolen, Notenpulte, Notenregale, Kleider-
halter, Staffeleien und Wetterglaseinrahmungen — Ther-
mometer und Aneroidbarometer mit Massangaben —). Zu-
lässig sind auch gezeichnete und kolorirte Entwürfe mit
Detailzeichnungen. 2. Für Federzeichnungen zu Kopfleisten,
Initialen und Schlussvignetten für die Zeitschrift für bildende
10*
Teller des heiligen Georg.