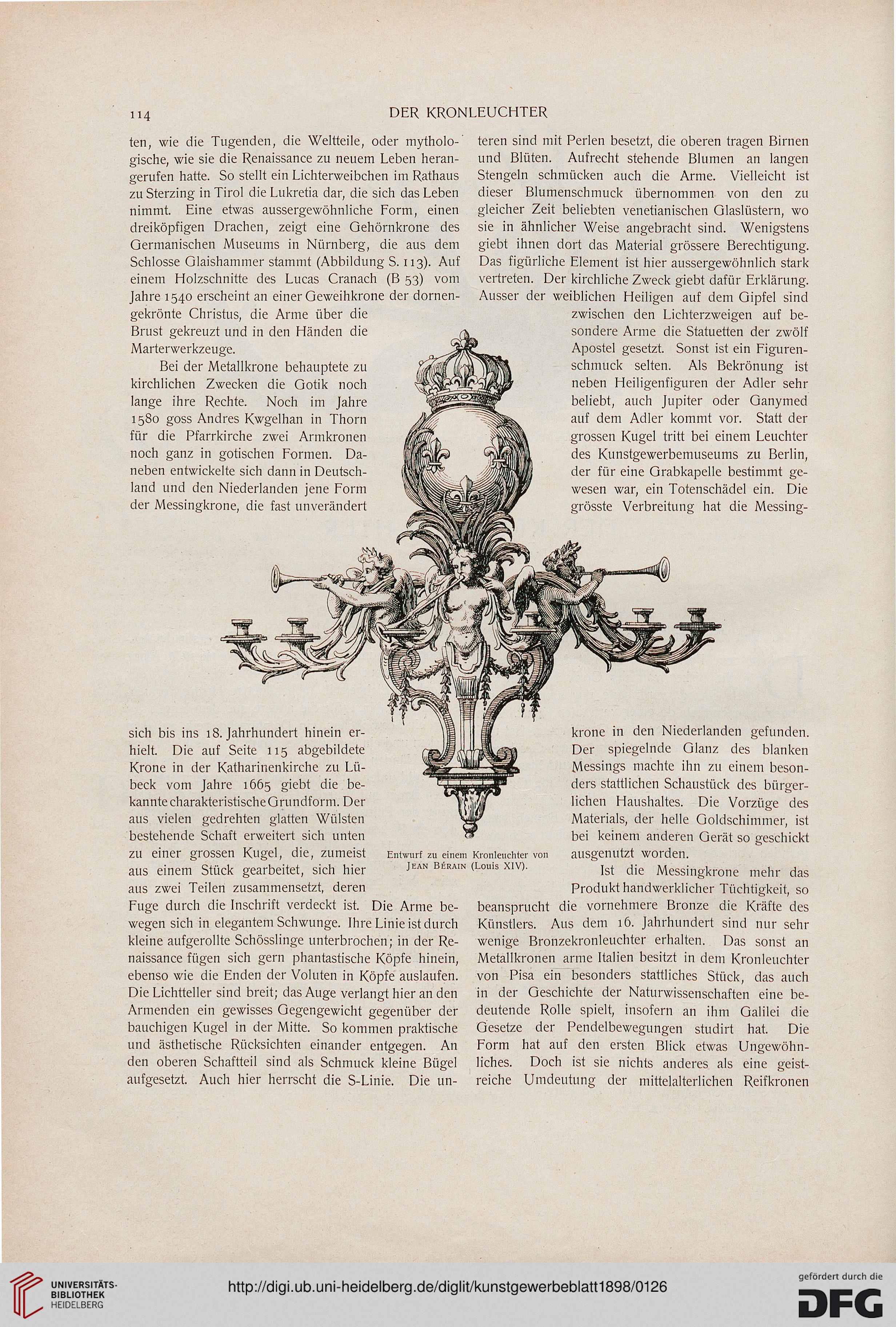U4
DER KRONLEUCHTER
ten, wie die Tugenden, die Weltteile, oder mytholo-
gische, wie sie die Renaissance zu neuem Leben heran-
gerufen hatte. So stellt ein Lichterweibchen im Rathaus
zu Sterzing in Tirol die Lukretia dar, die sich das Leben
nimmt. Eine etwas aussergewöhnliche Form, einen
dreiköpfigen Drachen, zeigt eine Gehörnkrone des
Germanischen Museums in Nürnberg, die aus dem
Schlosse Glaishammer stammt (Abbildung S. 113). Auf
einem Holzschnitte des Lucas Cranach (B 53) vom
Jahre 1540 erscheint an einer Geweihkrone der dornen-
gekrönte Christus, die Arme über die
Brust gekreuzt und in den Händen die
Marterwerkzeuge.
Bei der Metallkrone behauptete zu
kirchlichen Zwecken die Gotik noch
lange ihre Rechte. Noch im Jahre
1580 goss Andres Kwgelhan in Thorn
für die Pfarrkirche zwei Armkronen
noch ganz in gotischen Formen. Da-
neben entwickelte sich dann in Deutsch-
land und den Niederlanden jene Form
der Messingkrone, die fast unverändert
teren sind mit Perlen besetzt, die oberen tragen Birnen
und Blüten. Aufrecht stehende Blumen an langen
Stengeln schmücken auch die Arme. Vielleicht ist
dieser Blumenschmuck übernommen von den zu
gleicher Zeit beliebten venetianischen Glaslüstern, wo
sie in ähnlicher Weise angebracht sind. Wenigstens
giebt ihnen dort das Material grössere Berechtigung.
Das figürliche Element ist hier aussergewöhnlich stark
vertreten. Der kirchliche Zweck giebt dafür Erklärung.
Ausser der weiblichen Heiligen auf dem Gipfel sind
zwischen den Lichterzweigen auf be-
sondere Arme die Statuetten der zwölf
Apostel gesetzt. Sonst ist ein Figuren-
schmuck selten. Als Bekrönung ist
neben Heiligenfiguren der Adler sehr
beliebt, auch Jupiter oder Ganymed
auf dem Adler kommt vor. Statt der
grossen Kugel tritt bei einem Leuchter
des Kunstgewerbemuseums zu Berlin,
der für eine Grabkapelle bestimmt ge-
wesen war, ein Totenschädel ein. Die
grösste Verbreitung hat die Messing-
Jean Berain (Louis XIV)
sich bis ins 18. Jahrhundert hinein er-
hielt. Die auf Seite 115 abgebildete
Krone in der Katharinenkirche zu Lü-
beck vom Jahre 1665 giebt die be-
kannte charakteristische Grundform. Der
aus vielen gedrehten glatten Wülsten
bestehende Schaft erweitert sich unten
zu einer grossen Kugel, die, zumeist Entwurf zu einem
aus einem Stück gearbeitet, sich hier
aus zwei Teilen zusammensetzt, deren
Fuge durch die Inschrift verdeckt ist. Die Arme be-
wegen sich in elegantem Schwünge. Ihre Linie ist durch
kleine aufgerollte Schösslinge unterbrochen; in der Re-
naissance fügen sich gern phantastische Köpfe hinein,
ebenso wie die Enden der Voluten in Köpfe auslaufen.
Die Lichtteller sind breit; das Auge verlangt hier an den
Armenden ein gewisses Gegengewicht gegenüber der
bauchigen Kugel in der Mitte. So kommen praktische
und ästhetische Rücksichten einander entgegen. An
den oberen Schaftteil sind als Schmuck kleine Bügel
aufgesetzt. Auch hier herrscht die S-Linie. Die un-
krone in den Niederlanden gefunden.
Der spiegelnde Glanz des blanken
Messings machte ihn zu einem beson-
ders stattlichen Schaustück des bürger-
lichen Haushaltes. Die Vorzüge des
Materials, der helle Goldschimmer, ist
bei keinem anderen Gerät so geschickt
Kronleuchter von ausgenutzt worden.
Ist die Messingkrone mehr das
Produkt handwerklicher Tüchtigkeit, so
beansprucht die vornehmere Bronze die Kräfte des
Künstlers. Aus dem 16. Jahrhundert sind nur sehr
wenige Bronzekronleuchter erhalten. Das sonst an
Metallkronen arme Italien besitzt in dem Kronleuchter
von Pisa ein besonders stattliches Stück, das auch
in der Geschichte der Naturwissenschaften eine be-
deutende Rolle spielt, insofern an ihm Galilei die
Gesetze der Pendelbewegungen studirt hat. Die
Form hat auf den ersten Blick etwas Ungewöhn-
liches. Doch ist sie nichts anderes als eine geist-
reiche Umdeutung der mittelalterlichen Reifkronen
DER KRONLEUCHTER
ten, wie die Tugenden, die Weltteile, oder mytholo-
gische, wie sie die Renaissance zu neuem Leben heran-
gerufen hatte. So stellt ein Lichterweibchen im Rathaus
zu Sterzing in Tirol die Lukretia dar, die sich das Leben
nimmt. Eine etwas aussergewöhnliche Form, einen
dreiköpfigen Drachen, zeigt eine Gehörnkrone des
Germanischen Museums in Nürnberg, die aus dem
Schlosse Glaishammer stammt (Abbildung S. 113). Auf
einem Holzschnitte des Lucas Cranach (B 53) vom
Jahre 1540 erscheint an einer Geweihkrone der dornen-
gekrönte Christus, die Arme über die
Brust gekreuzt und in den Händen die
Marterwerkzeuge.
Bei der Metallkrone behauptete zu
kirchlichen Zwecken die Gotik noch
lange ihre Rechte. Noch im Jahre
1580 goss Andres Kwgelhan in Thorn
für die Pfarrkirche zwei Armkronen
noch ganz in gotischen Formen. Da-
neben entwickelte sich dann in Deutsch-
land und den Niederlanden jene Form
der Messingkrone, die fast unverändert
teren sind mit Perlen besetzt, die oberen tragen Birnen
und Blüten. Aufrecht stehende Blumen an langen
Stengeln schmücken auch die Arme. Vielleicht ist
dieser Blumenschmuck übernommen von den zu
gleicher Zeit beliebten venetianischen Glaslüstern, wo
sie in ähnlicher Weise angebracht sind. Wenigstens
giebt ihnen dort das Material grössere Berechtigung.
Das figürliche Element ist hier aussergewöhnlich stark
vertreten. Der kirchliche Zweck giebt dafür Erklärung.
Ausser der weiblichen Heiligen auf dem Gipfel sind
zwischen den Lichterzweigen auf be-
sondere Arme die Statuetten der zwölf
Apostel gesetzt. Sonst ist ein Figuren-
schmuck selten. Als Bekrönung ist
neben Heiligenfiguren der Adler sehr
beliebt, auch Jupiter oder Ganymed
auf dem Adler kommt vor. Statt der
grossen Kugel tritt bei einem Leuchter
des Kunstgewerbemuseums zu Berlin,
der für eine Grabkapelle bestimmt ge-
wesen war, ein Totenschädel ein. Die
grösste Verbreitung hat die Messing-
Jean Berain (Louis XIV)
sich bis ins 18. Jahrhundert hinein er-
hielt. Die auf Seite 115 abgebildete
Krone in der Katharinenkirche zu Lü-
beck vom Jahre 1665 giebt die be-
kannte charakteristische Grundform. Der
aus vielen gedrehten glatten Wülsten
bestehende Schaft erweitert sich unten
zu einer grossen Kugel, die, zumeist Entwurf zu einem
aus einem Stück gearbeitet, sich hier
aus zwei Teilen zusammensetzt, deren
Fuge durch die Inschrift verdeckt ist. Die Arme be-
wegen sich in elegantem Schwünge. Ihre Linie ist durch
kleine aufgerollte Schösslinge unterbrochen; in der Re-
naissance fügen sich gern phantastische Köpfe hinein,
ebenso wie die Enden der Voluten in Köpfe auslaufen.
Die Lichtteller sind breit; das Auge verlangt hier an den
Armenden ein gewisses Gegengewicht gegenüber der
bauchigen Kugel in der Mitte. So kommen praktische
und ästhetische Rücksichten einander entgegen. An
den oberen Schaftteil sind als Schmuck kleine Bügel
aufgesetzt. Auch hier herrscht die S-Linie. Die un-
krone in den Niederlanden gefunden.
Der spiegelnde Glanz des blanken
Messings machte ihn zu einem beson-
ders stattlichen Schaustück des bürger-
lichen Haushaltes. Die Vorzüge des
Materials, der helle Goldschimmer, ist
bei keinem anderen Gerät so geschickt
Kronleuchter von ausgenutzt worden.
Ist die Messingkrone mehr das
Produkt handwerklicher Tüchtigkeit, so
beansprucht die vornehmere Bronze die Kräfte des
Künstlers. Aus dem 16. Jahrhundert sind nur sehr
wenige Bronzekronleuchter erhalten. Das sonst an
Metallkronen arme Italien besitzt in dem Kronleuchter
von Pisa ein besonders stattliches Stück, das auch
in der Geschichte der Naturwissenschaften eine be-
deutende Rolle spielt, insofern an ihm Galilei die
Gesetze der Pendelbewegungen studirt hat. Die
Form hat auf den ersten Blick etwas Ungewöhn-
liches. Doch ist sie nichts anderes als eine geist-
reiche Umdeutung der mittelalterlichen Reifkronen