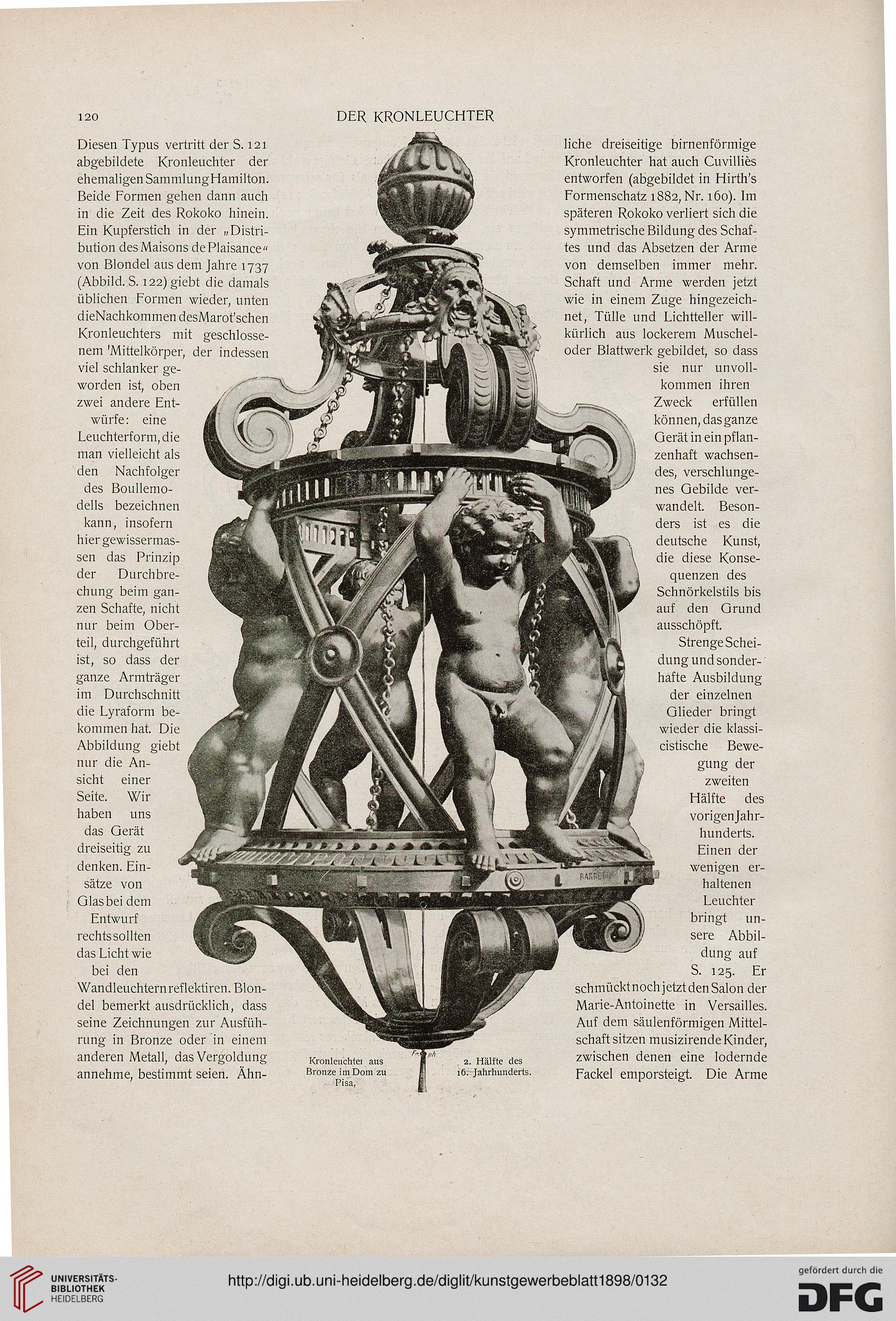120
DER KRONLEUCHTER
Diesen Typus vertritt der S. 121
abgebildete Kronleuchter der
ehemaligen SammlungHamilton.
Beide Formen gehen dann auch
in die Zeit des Rokoko hinein.
Ein Kupferstich in der „Distri-
bution desMaisons dePlaisance«
von Blondel aus dem Jahre 1737
(Abbild. S. 122) giebt die damals
üblichen Formen wieder, unten
dieNachkommen desMarot'schen
Kronleuchters mit geschlosse-
nem 'Mittelkörper, der indessen
viel schlanker ge-
worden ist, oben
zwei andere Ent-
würfe: eine
Leuchterform, die
man vielleicht als
den Nachfolger
des Boullemo-
dells bezeichnen
kann, insofern
hiergewissermas-
sen das Prinzip
der Durchbre-
chung beim gan-
zen Schafte, nicht
nur beim Ober-
teil, durchgeführt
ist, so dass der
ganze Armträger
im Durchschnitt
die Lyraform be-
kommen hat. Die
Abbildung giebt
nur die An-
sicht einer
Seite. Wir
haben uns
das Gerät
dreiseitig zu
denken. Ein-
sätze von
Glas bei dem
Entwurf
rechts sollten
das Licht wie
bei den
Wandleuchtern reflektiren. Blon-
del bemerkt ausdrücklich, dass
seine Zeichnungen zur Ausfüh-
rung in Bronze oder in einem
anderen Metall, das Vergoldung
annehme, bestimmt seien. Ahn-
1 wm**
Kronleuchtei aus
Bronze im Dom zu
Pisa,
2. Hälfte des
16. Jahrhunderts.
liehe dreiseitige birnenförmige
Kronleuchter hat auch Cuvillies
entworfen (abgebildet in Hirth's
Formenschatz 1882, Nr. 160). Im
späteren Rokoko verliert sich die
symmetrische Bildung des Schaf-
tes und das Absetzen der Arme
von demselben immer mehr.
Schaft und Arme werden jetzt
wie in einem Zuge hingezeich-
net, Tülle und Lichtteller will-
kürlich aus lockerem Muschel-
oder Blattwerk gebildet, so dass
sie nur unvoll-
kommen ihren
Zweck erfüllen
können, das ganze
Gerät in ein pflan-
zenhaft wachsen-
des, verschlunge-
nes Gebilde ver-
wandelt. Beson-
ders ist es die
deutsche Kunst,
die diese Konse-
quenzen des
Schnörkelstils bis
auf den Grund
ausschöpft.
Strenge Schei-
dung und sonder-
hafte Ausbildung
der einzelnen
Glieder bringt
wieder die klassi-
cistische Bewe-
gung der
zweiten
Hälfte des
vorigen Jahr-
hunderts.
Einen der
wenigen er-
haltenen
Leuchter
bringt un-
sere Abbil-
dung auf
S. 125. Er
schmücktnoch jetzt den Salon der
Marie-Antoinette in Versailles.
Auf dem säulenförmigen Mittel-
schaft sitzen musizirende Kinder,
zwischen denen eine lodernde
Fackel emporsteigt. Die Arme
DER KRONLEUCHTER
Diesen Typus vertritt der S. 121
abgebildete Kronleuchter der
ehemaligen SammlungHamilton.
Beide Formen gehen dann auch
in die Zeit des Rokoko hinein.
Ein Kupferstich in der „Distri-
bution desMaisons dePlaisance«
von Blondel aus dem Jahre 1737
(Abbild. S. 122) giebt die damals
üblichen Formen wieder, unten
dieNachkommen desMarot'schen
Kronleuchters mit geschlosse-
nem 'Mittelkörper, der indessen
viel schlanker ge-
worden ist, oben
zwei andere Ent-
würfe: eine
Leuchterform, die
man vielleicht als
den Nachfolger
des Boullemo-
dells bezeichnen
kann, insofern
hiergewissermas-
sen das Prinzip
der Durchbre-
chung beim gan-
zen Schafte, nicht
nur beim Ober-
teil, durchgeführt
ist, so dass der
ganze Armträger
im Durchschnitt
die Lyraform be-
kommen hat. Die
Abbildung giebt
nur die An-
sicht einer
Seite. Wir
haben uns
das Gerät
dreiseitig zu
denken. Ein-
sätze von
Glas bei dem
Entwurf
rechts sollten
das Licht wie
bei den
Wandleuchtern reflektiren. Blon-
del bemerkt ausdrücklich, dass
seine Zeichnungen zur Ausfüh-
rung in Bronze oder in einem
anderen Metall, das Vergoldung
annehme, bestimmt seien. Ahn-
1 wm**
Kronleuchtei aus
Bronze im Dom zu
Pisa,
2. Hälfte des
16. Jahrhunderts.
liehe dreiseitige birnenförmige
Kronleuchter hat auch Cuvillies
entworfen (abgebildet in Hirth's
Formenschatz 1882, Nr. 160). Im
späteren Rokoko verliert sich die
symmetrische Bildung des Schaf-
tes und das Absetzen der Arme
von demselben immer mehr.
Schaft und Arme werden jetzt
wie in einem Zuge hingezeich-
net, Tülle und Lichtteller will-
kürlich aus lockerem Muschel-
oder Blattwerk gebildet, so dass
sie nur unvoll-
kommen ihren
Zweck erfüllen
können, das ganze
Gerät in ein pflan-
zenhaft wachsen-
des, verschlunge-
nes Gebilde ver-
wandelt. Beson-
ders ist es die
deutsche Kunst,
die diese Konse-
quenzen des
Schnörkelstils bis
auf den Grund
ausschöpft.
Strenge Schei-
dung und sonder-
hafte Ausbildung
der einzelnen
Glieder bringt
wieder die klassi-
cistische Bewe-
gung der
zweiten
Hälfte des
vorigen Jahr-
hunderts.
Einen der
wenigen er-
haltenen
Leuchter
bringt un-
sere Abbil-
dung auf
S. 125. Er
schmücktnoch jetzt den Salon der
Marie-Antoinette in Versailles.
Auf dem säulenförmigen Mittel-
schaft sitzen musizirende Kinder,
zwischen denen eine lodernde
Fackel emporsteigt. Die Arme