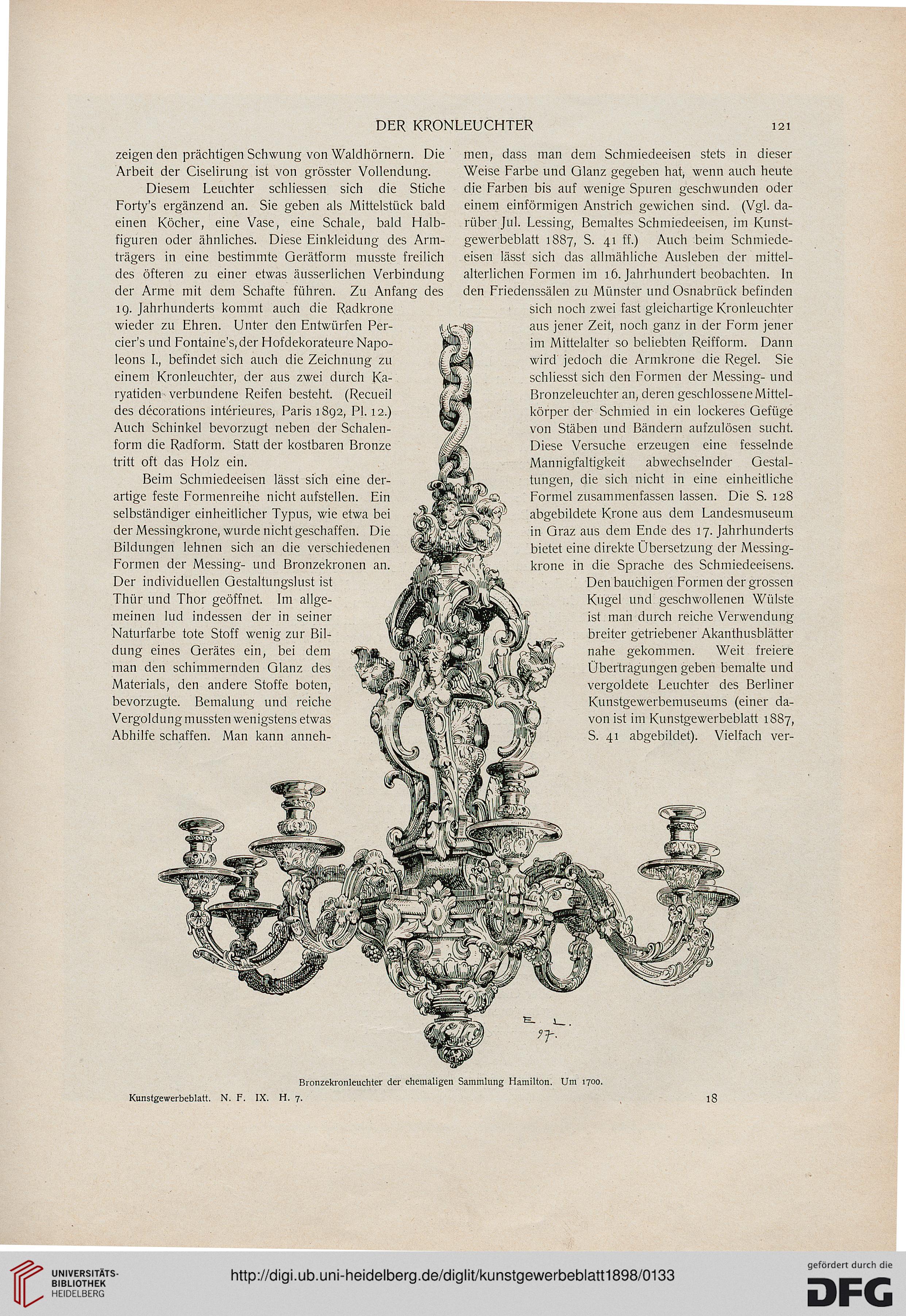DER KRONLEUCHTER
121
zeigen den prächtigen Schwung von Waldhörnern. Die
Arbeit der Ciselirung ist von grösster Vollendung.
Diesem Leuchter schliessen sich die Stiche
Forty's ergänzend an. Sie geben als Mittelstück bald
einen Köcher, eine Vase, eine Schale, bald Halb-
figuren oder ähnliches. Diese Einkleidung des Arm-
trägers in eine bestimmte Gerätform musste freilich
des öfteren zu einer etwas äusserlichen Verbindung
der Arme mit dem Schafte führen. Zu Anfang des
19. Jahrhunderts kommt auch die Radkrone
wieder zu Ehren. Unter den Entwürfen Per-
cier'sund Fontaine's,der Hofdekorateure Napo-
leons I., befindet sich auch die Zeichnung zu
einem Kronleuchter, der aus zwei durch Ka-
ryatiden verbundene Reifen besteht. (Recueil
des decorations interieures, Paris 1892, PL 12.)
Auch Schinkel bevorzugt neben der Schalen-
form die Radform. Statt der kostbaren Bronze
tritt oft das Holz ein.
Beim Schmiedeeisen lässt sich eine der-
artige feste Formenreihe nicht aufstellen. Ein
selbständiger einheitlicher Typus, wie etwa bei
der Messingkrone, wurde nicht geschaffen. Die
Bildungen lehnen sich an die verschiedenen
Formen der Messing- und Bronzekronen an.
Der individuellen Gestaltungslust ist
Thür und Thor geöffnet. Im allge-
meinen lud indessen der in seiner
Naturfarbe tote Stoff wenig zur Bil-
dung eines Gerätes ein, bei dem
man den schimmernden Glanz des
Materials, den andere Stoffe boten,
bevorzugte. Bemalung und reiche
Vergoldung mussten wenigstens etwas
Abhilfe schaffen. Man kann anneh-
men, dass man dem Schmiedeeisen stets in dieser
Weise Farbe und Glanz gegeben hat, wenn auch heute
die Farben bis auf wenige Spuren geschwunden oder
einem einförmigen Anstrich gewichen sind. (Vgl. da-
rüber Jul. Lessing, Bemaltes Schmiedeeisen, im Kunst-
gewerbeblatt 1887, S. 41 ff.) Auch beim Schmiede-
eisen lässt sich das allmähliche Ausleben der mittel-
alterlichen Formen im 16. Jahrhundert beobachten. In
den Friedenssälen zu Münster und Osnabrück befinden
sich noch zwei fast gleichartige Kronleuchter
aus jener Zeit, noch ganz in der Form jener
im Mittelalter so beliebten Reifform. Dann
wird jedoch die Armkrone die Regel. Sie
schliesst sich den Formen der Messing- und
Bronzeleuchter an, deren geschlossene Mittel-
körper der Schmied in ein lockeres Gefüge
von Stäben und Bändern aufzulösen sucht.
Diese Versuche erzeugen eine fesselnde
Mannigfaltigkeit abwechselnder Gestal-
tungen, die sich nicht in eine einheitliche
Formel zusammenfassen lassen. Die S. 128
abgebildete Krone aus dem Landesmuseum
in Graz aus dem Ende des 17. Jahrhunderts
bietet eine direkte Übersetzung der Messing-
krone in die Sprache des Schmiedeeisens.
Den bauchigen Formen der grossen
Kugel und geschwollenen Wülste
ist man durch reiche Verwendung
breiter getriebener Akanthusblätter
nahe gekommen. Weit freiere
Übertragungen geben bemalte und
vergoldete Leuchter des Berliner
Kunstgewerbemuseums (einer da-
von ist im Kunstgewerbeblatt 1887,
S. 41 abgebildet). Vielfach ver-
>?-■
Bronzekronleuchter der ehemaligen Sammlung Hamilton. Um 1700.
Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 7.
121
zeigen den prächtigen Schwung von Waldhörnern. Die
Arbeit der Ciselirung ist von grösster Vollendung.
Diesem Leuchter schliessen sich die Stiche
Forty's ergänzend an. Sie geben als Mittelstück bald
einen Köcher, eine Vase, eine Schale, bald Halb-
figuren oder ähnliches. Diese Einkleidung des Arm-
trägers in eine bestimmte Gerätform musste freilich
des öfteren zu einer etwas äusserlichen Verbindung
der Arme mit dem Schafte führen. Zu Anfang des
19. Jahrhunderts kommt auch die Radkrone
wieder zu Ehren. Unter den Entwürfen Per-
cier'sund Fontaine's,der Hofdekorateure Napo-
leons I., befindet sich auch die Zeichnung zu
einem Kronleuchter, der aus zwei durch Ka-
ryatiden verbundene Reifen besteht. (Recueil
des decorations interieures, Paris 1892, PL 12.)
Auch Schinkel bevorzugt neben der Schalen-
form die Radform. Statt der kostbaren Bronze
tritt oft das Holz ein.
Beim Schmiedeeisen lässt sich eine der-
artige feste Formenreihe nicht aufstellen. Ein
selbständiger einheitlicher Typus, wie etwa bei
der Messingkrone, wurde nicht geschaffen. Die
Bildungen lehnen sich an die verschiedenen
Formen der Messing- und Bronzekronen an.
Der individuellen Gestaltungslust ist
Thür und Thor geöffnet. Im allge-
meinen lud indessen der in seiner
Naturfarbe tote Stoff wenig zur Bil-
dung eines Gerätes ein, bei dem
man den schimmernden Glanz des
Materials, den andere Stoffe boten,
bevorzugte. Bemalung und reiche
Vergoldung mussten wenigstens etwas
Abhilfe schaffen. Man kann anneh-
men, dass man dem Schmiedeeisen stets in dieser
Weise Farbe und Glanz gegeben hat, wenn auch heute
die Farben bis auf wenige Spuren geschwunden oder
einem einförmigen Anstrich gewichen sind. (Vgl. da-
rüber Jul. Lessing, Bemaltes Schmiedeeisen, im Kunst-
gewerbeblatt 1887, S. 41 ff.) Auch beim Schmiede-
eisen lässt sich das allmähliche Ausleben der mittel-
alterlichen Formen im 16. Jahrhundert beobachten. In
den Friedenssälen zu Münster und Osnabrück befinden
sich noch zwei fast gleichartige Kronleuchter
aus jener Zeit, noch ganz in der Form jener
im Mittelalter so beliebten Reifform. Dann
wird jedoch die Armkrone die Regel. Sie
schliesst sich den Formen der Messing- und
Bronzeleuchter an, deren geschlossene Mittel-
körper der Schmied in ein lockeres Gefüge
von Stäben und Bändern aufzulösen sucht.
Diese Versuche erzeugen eine fesselnde
Mannigfaltigkeit abwechselnder Gestal-
tungen, die sich nicht in eine einheitliche
Formel zusammenfassen lassen. Die S. 128
abgebildete Krone aus dem Landesmuseum
in Graz aus dem Ende des 17. Jahrhunderts
bietet eine direkte Übersetzung der Messing-
krone in die Sprache des Schmiedeeisens.
Den bauchigen Formen der grossen
Kugel und geschwollenen Wülste
ist man durch reiche Verwendung
breiter getriebener Akanthusblätter
nahe gekommen. Weit freiere
Übertragungen geben bemalte und
vergoldete Leuchter des Berliner
Kunstgewerbemuseums (einer da-
von ist im Kunstgewerbeblatt 1887,
S. 41 abgebildet). Vielfach ver-
>?-■
Bronzekronleuchter der ehemaligen Sammlung Hamilton. Um 1700.
Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 7.