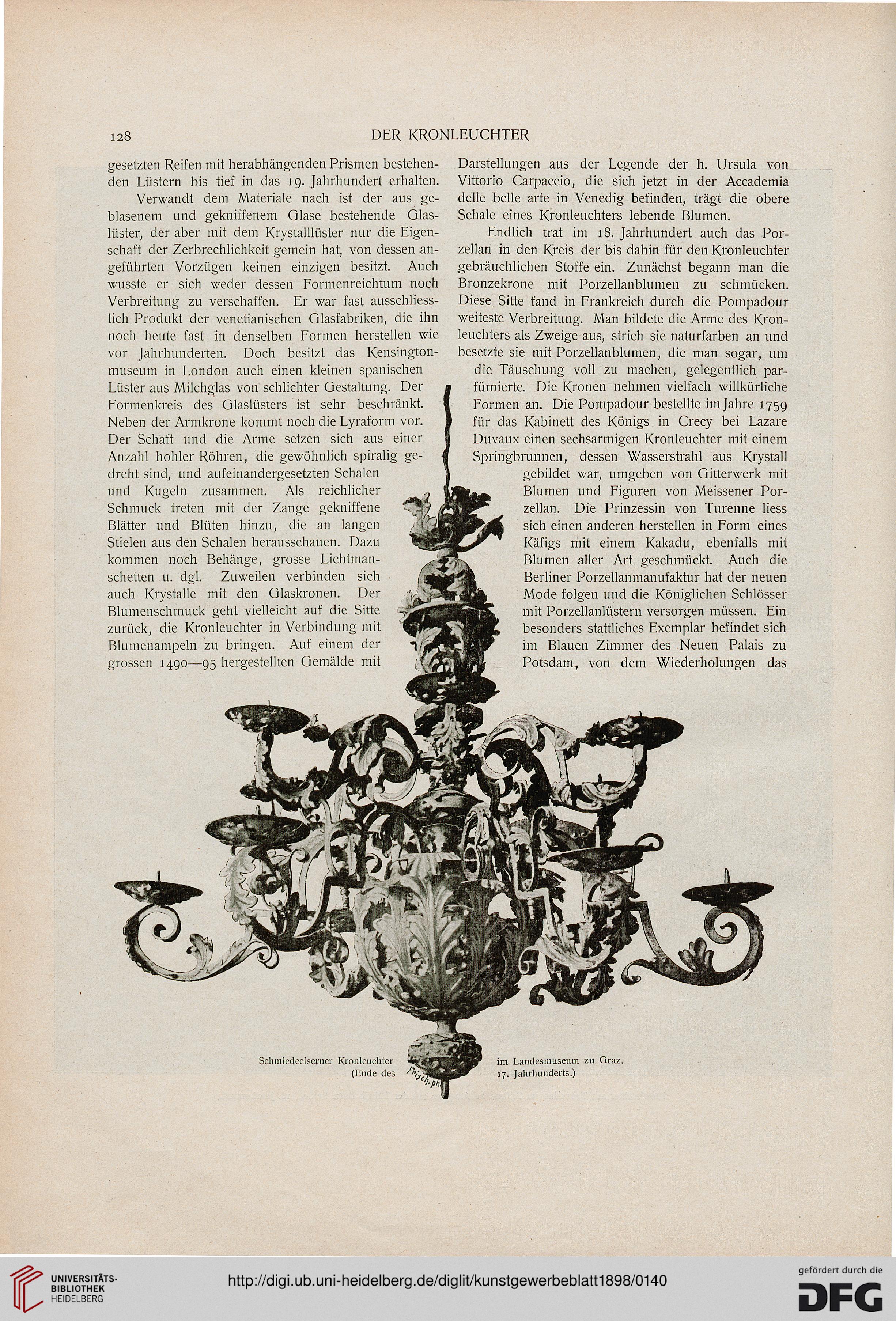128
DER KRONLEUCHTER
gesetzten Reifen mit herabhängenden Prismen bestehen-
den Lüstern bis tief in das 19. Jahrhundert erhalten.
Verwandt dem Materiale nach ist der aus ge-
blasenem und gekniffenem Glase bestehende Glas-
lüster, der aber mit dem Krystalllüster nur die Eigen-
schaft der Zerbrechlichkeit gemein hat, von dessen an-
geführten Vorzügen keinen einzigen besitzt. Auch
wusste er sich weder dessen Formenreichtum noch
Verbreitung zu verschaffen. Er war fast ausschliess-
lich Produkt der venetianischen Glasfabriken, die ihn
noch heute fast in denselben Formen herstellen wie
vor Jahrhunderten. Doch besitzt das Kensington-
museum in London auch einen kleinen spanischen
Lüster aus Milchglas von schlichter Gestaltung. Der
Formenkreis des Glaslüsters ist sehr beschränkt.
Neben der Armkrone kommt noch die Lyraform vor.
Der Schaft und die Arme setzen sich aus einer
Anzahl hohler Röhren, die gewöhnlich spiralig ge-
dreht sind, und aufeinandergesetzten Schalen
und Kugeln zusammen. Als reichlicher
Schmuck treten mit der Zange gekniffene
Blätter und Blüten hinzu, die an langen
Stielen aus den Schalen herausschauen. Dazu
kommen noch Behänge, grosse Lichtman-
schetten u. dgl. Zuweilen verbinden sich
auch Krystalle mit den Glaskronen. Der
Blumenschmuck geht vielleicht auf die Sitte
zurück, die Kronleuchter in Verbindung mit
Blumenampeln zu bringen. Auf einem der
grossen 1490—95 hergestellten Gemälde mit
Darstellungen aus der Legende der h. Ursula von
Vittorio Carpaccio, die sich jetzt in der Accademia
delle belle arte in Venedig befinden, trägt die obere
Schale eines Kronleuchters lebende Blumen.
Endlich trat im 18. Jahrhundert auch das Por-
zellan in den Kreis der bis dahin für den Kronleuchter
gebräuchlichen Stoffe ein. Zunächst begann man die
Bronzekrone mit Porzellanblumen zu schmücken.
Diese Sitte fand in Frankreich durch die Pompadour
weiteste Verbreitung. Man bildete die Arme des Kron-
leuchters als Zweige aus, strich sie naturfarben an und
besetzte sie mit Porzellanblumen, die man sogar, um
die Täuschung voll zu machen, gelegentlich par-
fümierte. Die Kronen nehmen vielfach willkürliche
Formen an. Die Pompadour bestellte im Jahre 1759
für das Kabinett des Königs in Crecy bei Lazare
Duvaux einen sechsarmigen Kronleuchter mit einem
Springbrunnen, dessen Wasserstrahl aus Krystall
gebildet war, umgeben von Gitterwerk mit
Blumen und Figuren von Meissener Por-
zellan. Die Prinzessin von Turenne Hess
sich einen anderen herstellen in Form eines
Käfigs mit einem Kakadu, ebenfalls mit
Blumen aller Art geschmückt. Auch die
Berliner Porzellanmanufaktur hat der neuen
Mode folgen und die Königlichen Schlösser
mit Porzellanlüstern versorgen müssen. Ein
besonders stattliches Exemplar befindet sich
im Blauen Zimmer des Neuen Palais zu
Potsdam, von dem Wiederholungen das
Schmiedeeiserner Kronleuchter
(Ende des A
im Landesmuseum zu Graz.
17. Jahrhunderts.)
DER KRONLEUCHTER
gesetzten Reifen mit herabhängenden Prismen bestehen-
den Lüstern bis tief in das 19. Jahrhundert erhalten.
Verwandt dem Materiale nach ist der aus ge-
blasenem und gekniffenem Glase bestehende Glas-
lüster, der aber mit dem Krystalllüster nur die Eigen-
schaft der Zerbrechlichkeit gemein hat, von dessen an-
geführten Vorzügen keinen einzigen besitzt. Auch
wusste er sich weder dessen Formenreichtum noch
Verbreitung zu verschaffen. Er war fast ausschliess-
lich Produkt der venetianischen Glasfabriken, die ihn
noch heute fast in denselben Formen herstellen wie
vor Jahrhunderten. Doch besitzt das Kensington-
museum in London auch einen kleinen spanischen
Lüster aus Milchglas von schlichter Gestaltung. Der
Formenkreis des Glaslüsters ist sehr beschränkt.
Neben der Armkrone kommt noch die Lyraform vor.
Der Schaft und die Arme setzen sich aus einer
Anzahl hohler Röhren, die gewöhnlich spiralig ge-
dreht sind, und aufeinandergesetzten Schalen
und Kugeln zusammen. Als reichlicher
Schmuck treten mit der Zange gekniffene
Blätter und Blüten hinzu, die an langen
Stielen aus den Schalen herausschauen. Dazu
kommen noch Behänge, grosse Lichtman-
schetten u. dgl. Zuweilen verbinden sich
auch Krystalle mit den Glaskronen. Der
Blumenschmuck geht vielleicht auf die Sitte
zurück, die Kronleuchter in Verbindung mit
Blumenampeln zu bringen. Auf einem der
grossen 1490—95 hergestellten Gemälde mit
Darstellungen aus der Legende der h. Ursula von
Vittorio Carpaccio, die sich jetzt in der Accademia
delle belle arte in Venedig befinden, trägt die obere
Schale eines Kronleuchters lebende Blumen.
Endlich trat im 18. Jahrhundert auch das Por-
zellan in den Kreis der bis dahin für den Kronleuchter
gebräuchlichen Stoffe ein. Zunächst begann man die
Bronzekrone mit Porzellanblumen zu schmücken.
Diese Sitte fand in Frankreich durch die Pompadour
weiteste Verbreitung. Man bildete die Arme des Kron-
leuchters als Zweige aus, strich sie naturfarben an und
besetzte sie mit Porzellanblumen, die man sogar, um
die Täuschung voll zu machen, gelegentlich par-
fümierte. Die Kronen nehmen vielfach willkürliche
Formen an. Die Pompadour bestellte im Jahre 1759
für das Kabinett des Königs in Crecy bei Lazare
Duvaux einen sechsarmigen Kronleuchter mit einem
Springbrunnen, dessen Wasserstrahl aus Krystall
gebildet war, umgeben von Gitterwerk mit
Blumen und Figuren von Meissener Por-
zellan. Die Prinzessin von Turenne Hess
sich einen anderen herstellen in Form eines
Käfigs mit einem Kakadu, ebenfalls mit
Blumen aller Art geschmückt. Auch die
Berliner Porzellanmanufaktur hat der neuen
Mode folgen und die Königlichen Schlösser
mit Porzellanlüstern versorgen müssen. Ein
besonders stattliches Exemplar befindet sich
im Blauen Zimmer des Neuen Palais zu
Potsdam, von dem Wiederholungen das
Schmiedeeiserner Kronleuchter
(Ende des A
im Landesmuseum zu Graz.
17. Jahrhunderts.)