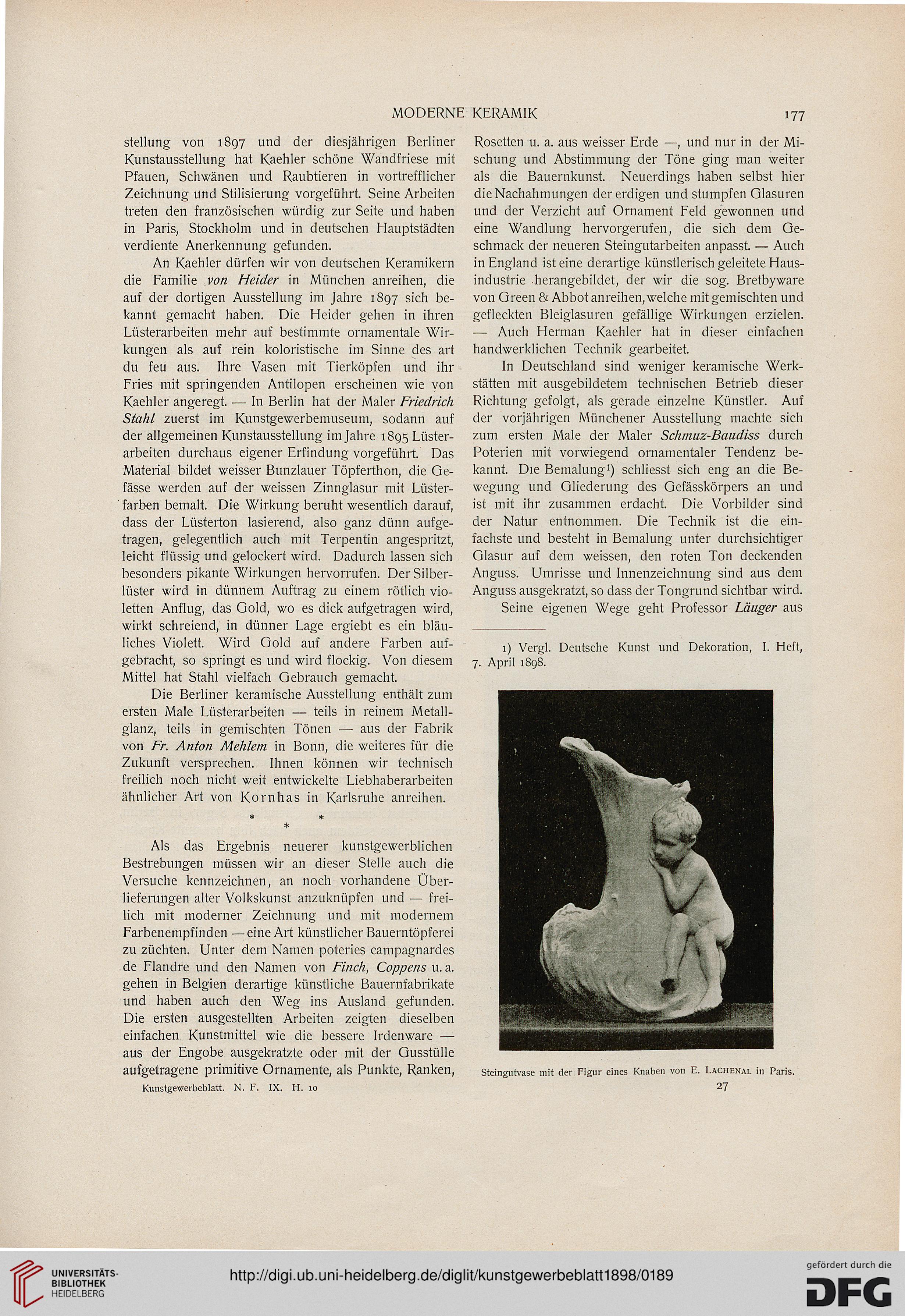MODERNE KERAMIK
177
Stellung von 1897 und der diesjährigen Berliner
Kunstausstellung hat Kaehler schöne Wandfriese mit
Pfauen, Schwänen und Raubtieren in vortrefflicher
Zeichnung und Stilisierung vorgeführt. Seine Arbeiten
treten den französischen würdig zur Seite und haben
in Paris, Stockholm und in deutschen Hauptstädten
verdiente Anerkennung gefunden.
An Kaehler dürfen wir von deutschen Keramikern
die Familie von Heider in München anreihen, die
auf der dortigen Ausstellung im Jahre 1897 sich be-
kannt gemacht haben. Die Heider gehen in ihren
Lüsterarbeiten mehr auf bestimmte ornamentale Wir-
kungen als auf rein koloristische im Sinne des art
du feu aus. Ihre Vasen mit Tierköpfen und ihr
Fries mit springenden Antilopen erscheinen wie von
Kaehler angeregt. — In Berlin hat der Maler Friedrich
Stahl zuerst im Kunstgewerbemuseum, sodann auf
der allgemeinen Kunstausstellung im Jahre 1895 Lüster-
arbeiten durchaus eigener Erfindung vorgeführt. Das
Material bildet weisser Bunzlauer Töpferthon, die Ge-
fässe werden auf der weissen Zinnglasur mit Lüster-
farben bemalt. Die Wirkung beruht wesentlich darauf,
dass der Lüsterton lasierend, also ganz dünn aufge-
tragen, gelegentlich auch mit Terpentin angespritzt,
leicht flüssig und gelockert wird. Dadurch lassen sich
besonders pikante Wirkungen hervorrufen. Der Silber-
lüster wird in dünnem Auftrag zu einem rötlich vio-
letten Anflug, das Gold, wo es dick aufgetragen wird,
wirkt schreiend, in dünner Lage ergiebt es ein bläu-
liches Violett. Wird Gold auf andere Farben auf-
gebracht, so springt es und wird flockig. Von diesem
Mittel hat Stahl vielfach Gebrauch gemacht.
Die Berliner keramische Ausstellung enthält zum
ersten Male Lüsterarbeiten — teils in reinem Metall-
glanz, teils in gemischten Tönen — aus der Fabrik
von Fr. Anton Mehle/n in Bonn, die weiteres für die
Zukunft versprechen. Ihnen können wir technisch
freilich noch nicht weit entwickelte Liebhaberarbeiten
ähnlicher Art von Kornhas in Karlsruhe anreihen.
Als das Ergebnis neuerer kunstgewerblichen
Bestrebungen müssen wir an dieser Stelle auch die
Versuche kennzeichnen, an noch vorhandene Über-
lieferungen alter Volkskunst anzuknüpfen und — frei-
lich mit moderner Zeichnung und mit modernem
Farbenempfinden —eine Art künstlicher Bauerntöpferei
zu züchten. Unter dem Namen poteries campagnardes
de Flandre und den Namen von Finch, Coppens u. a.
gehen in Belgien derartige künstliche Bauernfabrikate
und haben auch den Weg ins Ausland gefunden.
Die ersten ausgestellten Arbeiten zeigten dieselben
einfachen Kunstmittel wie die bessere Irdenware —
aus der Engobe ausgekratzte oder mit der Gusstülle
aufgetragene primitive Ornamente, als Punkte, Ranken,
Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 10
Rosetten u. a. aus weisser Erde —, und nur in der Mi-
schung und Abstimmung der Töne ging man weiter
als die Bauernkunst. Neuerdings haben selbst hier
die Nachahmungen der erdigen und stumpfen Glasuren
und der Verzicht auf Ornament Feld gewonnen und
eine Wandlung hervorgerufen, die sich dem Ge-
schmack der neueren Steingutarbeiten anpasst. — Auch
in England ist eine derartige künstlerisch geleitete Haus-
industrie herangebildet, der wir die sog. Bretbyware
von Green & Abbot anreihen, welche mit gemischten und
gefleckten Bleiglasuren gefällige Wirkungen erzielen.
— Auch Herman Kaehler hat in dieser einfachen
handwerklichen Technik gearbeitet.
In Deutschland sind weniger keramische Werk-
stätten mit ausgebildetem technischen Betneb dieser
Richtung gefolgt, als gerade einzelne Künstler. Auf
der vorjährigen Münchener Ausstellung machte sich
zum ersten Male der Maler Schmuz-Baudiss durch
Poterien mit vorwiegend ornamentaler Tendenz be-
kannt. Die Bemalung1) schliesst sich eng an die Be-
wegung und Gliederung des Gefässkörpers an und
ist mit ihr zusammen erdacht. Die Vorbilder sind
der Natur entnommen. Die Technik ist die ein-
fachste und besteht in Bemalung unter durchsichtiger
Glasur auf dem weissen, den roten Ton deckenden
Anguss. Umrisse und Innenzeichnung sind aus dem
Anguss ausgekratzt, so dass der Tongrund sichtbar wird.
Seine eigenen Wege geht Professor Läuger aus
1) Vergl. Deutsche Kunst und Dekoration, I. Heft,
7. April 1898.
Steingutvase mit der Figur eines Knaben von E. Lachenal in Paris.
27
177
Stellung von 1897 und der diesjährigen Berliner
Kunstausstellung hat Kaehler schöne Wandfriese mit
Pfauen, Schwänen und Raubtieren in vortrefflicher
Zeichnung und Stilisierung vorgeführt. Seine Arbeiten
treten den französischen würdig zur Seite und haben
in Paris, Stockholm und in deutschen Hauptstädten
verdiente Anerkennung gefunden.
An Kaehler dürfen wir von deutschen Keramikern
die Familie von Heider in München anreihen, die
auf der dortigen Ausstellung im Jahre 1897 sich be-
kannt gemacht haben. Die Heider gehen in ihren
Lüsterarbeiten mehr auf bestimmte ornamentale Wir-
kungen als auf rein koloristische im Sinne des art
du feu aus. Ihre Vasen mit Tierköpfen und ihr
Fries mit springenden Antilopen erscheinen wie von
Kaehler angeregt. — In Berlin hat der Maler Friedrich
Stahl zuerst im Kunstgewerbemuseum, sodann auf
der allgemeinen Kunstausstellung im Jahre 1895 Lüster-
arbeiten durchaus eigener Erfindung vorgeführt. Das
Material bildet weisser Bunzlauer Töpferthon, die Ge-
fässe werden auf der weissen Zinnglasur mit Lüster-
farben bemalt. Die Wirkung beruht wesentlich darauf,
dass der Lüsterton lasierend, also ganz dünn aufge-
tragen, gelegentlich auch mit Terpentin angespritzt,
leicht flüssig und gelockert wird. Dadurch lassen sich
besonders pikante Wirkungen hervorrufen. Der Silber-
lüster wird in dünnem Auftrag zu einem rötlich vio-
letten Anflug, das Gold, wo es dick aufgetragen wird,
wirkt schreiend, in dünner Lage ergiebt es ein bläu-
liches Violett. Wird Gold auf andere Farben auf-
gebracht, so springt es und wird flockig. Von diesem
Mittel hat Stahl vielfach Gebrauch gemacht.
Die Berliner keramische Ausstellung enthält zum
ersten Male Lüsterarbeiten — teils in reinem Metall-
glanz, teils in gemischten Tönen — aus der Fabrik
von Fr. Anton Mehle/n in Bonn, die weiteres für die
Zukunft versprechen. Ihnen können wir technisch
freilich noch nicht weit entwickelte Liebhaberarbeiten
ähnlicher Art von Kornhas in Karlsruhe anreihen.
Als das Ergebnis neuerer kunstgewerblichen
Bestrebungen müssen wir an dieser Stelle auch die
Versuche kennzeichnen, an noch vorhandene Über-
lieferungen alter Volkskunst anzuknüpfen und — frei-
lich mit moderner Zeichnung und mit modernem
Farbenempfinden —eine Art künstlicher Bauerntöpferei
zu züchten. Unter dem Namen poteries campagnardes
de Flandre und den Namen von Finch, Coppens u. a.
gehen in Belgien derartige künstliche Bauernfabrikate
und haben auch den Weg ins Ausland gefunden.
Die ersten ausgestellten Arbeiten zeigten dieselben
einfachen Kunstmittel wie die bessere Irdenware —
aus der Engobe ausgekratzte oder mit der Gusstülle
aufgetragene primitive Ornamente, als Punkte, Ranken,
Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 10
Rosetten u. a. aus weisser Erde —, und nur in der Mi-
schung und Abstimmung der Töne ging man weiter
als die Bauernkunst. Neuerdings haben selbst hier
die Nachahmungen der erdigen und stumpfen Glasuren
und der Verzicht auf Ornament Feld gewonnen und
eine Wandlung hervorgerufen, die sich dem Ge-
schmack der neueren Steingutarbeiten anpasst. — Auch
in England ist eine derartige künstlerisch geleitete Haus-
industrie herangebildet, der wir die sog. Bretbyware
von Green & Abbot anreihen, welche mit gemischten und
gefleckten Bleiglasuren gefällige Wirkungen erzielen.
— Auch Herman Kaehler hat in dieser einfachen
handwerklichen Technik gearbeitet.
In Deutschland sind weniger keramische Werk-
stätten mit ausgebildetem technischen Betneb dieser
Richtung gefolgt, als gerade einzelne Künstler. Auf
der vorjährigen Münchener Ausstellung machte sich
zum ersten Male der Maler Schmuz-Baudiss durch
Poterien mit vorwiegend ornamentaler Tendenz be-
kannt. Die Bemalung1) schliesst sich eng an die Be-
wegung und Gliederung des Gefässkörpers an und
ist mit ihr zusammen erdacht. Die Vorbilder sind
der Natur entnommen. Die Technik ist die ein-
fachste und besteht in Bemalung unter durchsichtiger
Glasur auf dem weissen, den roten Ton deckenden
Anguss. Umrisse und Innenzeichnung sind aus dem
Anguss ausgekratzt, so dass der Tongrund sichtbar wird.
Seine eigenen Wege geht Professor Läuger aus
1) Vergl. Deutsche Kunst und Dekoration, I. Heft,
7. April 1898.
Steingutvase mit der Figur eines Knaben von E. Lachenal in Paris.
27