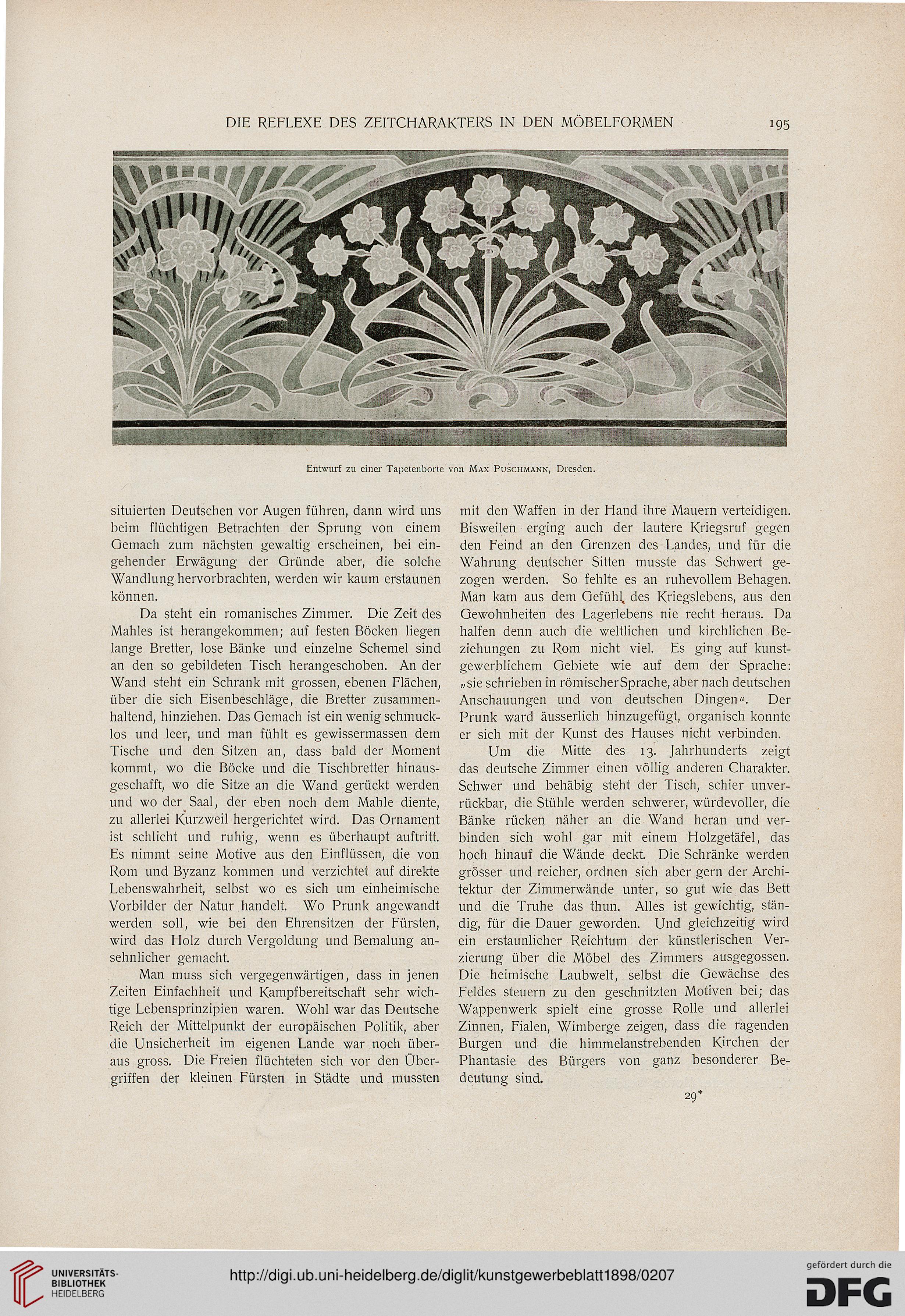DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN
195
Entwurf zu einer Tapetenborte von Max Pusciimann, Dresden.
situierten Deutschen vor Augen führen, dann wird uns
beim flüchtigen Betrachten der Sprung von einem
Gemach zum nächsten gewaltig erscheinen, bei ein-
gehender Erwägung der Gründe aber, die solche
Wandlung hervorbrachten, werden wir kaum erstaunen
können.
Da steht ein romanisches Zimmer. Die Zeit des
Mahles ist herangekommen; auf festen Böcken liegen
lange Bretter, lose Bänke und einzelne Schemel sind
an den so gebildeten Tisch herangeschoben. An der
Wand steht ein Schrank mit grossen, ebenen Flächen,
über die sich Eisenbeschläge, die Bretter zusammen-
haltend, hinziehen. Das Gemach ist ein wenig schmuck-
los und leer, und man fühlt es gewissermassen dem
Tische und den Sitzen an, dass bald der Moment
kommt, wo die Böcke und die Tischbretter hinaus-
geschafft, wo die Sitze an die Wand gerückt werden
und wo der Saal, der eben noch dem Mahle diente,
zu allerlei Kurzweil hergerichtet wird. Das Ornament
ist schlicht und ruhig, wenn es überhaupt auftritt.
Es nimmt seine Motive aus den Einflüssen, die von
Rom und Byzanz kommen und verzichtet auf direkte
Lebenswahrheit, selbst wo es sich um einheimische
Vorbilder der Natur handelt. Wo Prunk angewandt
werden soll, wie bei den Ehrensitzen der Fürsten,
wird das Holz durch Vergoldung und Bemalung an-
sehnlicher gemacht.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass in jenen
Zeiten Einfachheit und Kampfbereitschaft sehr wich-
tige Lebensprinzipien waren. Wohl war das Deutsche
Reich der Mittelpunkt der europäischen Politik, aber
die Unsicherheit im eigenen Lande war noch über-
aus gross. Die Freien flüchteten sich vor den Über-
griffen der kleinen Fürsten in Städte und mussten
mit den Waffen in der Hand ihre Mauern verteidigen.
Bisweilen erging auch der lautere Kriegsruf gegen
den Feind an den Grenzen des Landes, und für die
Wahrung deutscher Sitten musste das Schwert ge-
zogen werden. So fehlte es an ruhevollem Behagen.
Man kam aus dem Gefühl, des Kriegslebens, aus den
Gewohnheiten des Lagerlebens nie recht heraus. Da
halfen denn auch die weltlichen und kirchlichen Be-
ziehungen zu Rom nicht viel. Es ging auf kunst-
gewerblichem Gebiete wie auf dem der Sprache:
«sie schrieben in römischerSprache, aber nach deutschen
Anschauungen und von deutschen Dingen". Der
Prunk ward äusserlich hinzugefügt, organisch konnte
er sich mit der Kunst des Hauses nicht verbinden.
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts zeigt
das deutsche Zimmer einen völlig anderen Charakter.
Schwer und behäbig steht der Tisch, schier unver-
rückbar, die Stühle werden schwerer, würdevoller, die
Bänke rücken näher an die Wand heran und ver-
binden sich wohl gar mit einem Holzgetäfel, das
hoch hinauf die Wände deckt. Die Schränke werden
grösser und reicher, ordnen sich aber gern der Archi-
tektur der Zimmerwände unter, so gut wie das Bett
und die Truhe das thun. Alles ist gewichtig, stän-
dig, für die Dauer geworden. Und gleichzeitig wird
ein erstaunlicher Reichtum der künstlerischen Ver-
zierung über die Möbel des Zimmers ausgegossen.
Die heimische Laubwelt, selbst die Gewächse des
Feldes steuern zu den geschnitzten Motiven bei; das
Wappenwerk spielt eine grosse Rolle und allerlei
Zinnen, Fialen, Wimberge zeigen, dass die ragenden
Burgen und die himmelanstrebenden Kirchen der
Phantasie des Bürgers von ganz besonderer Be-
deutung sind.
29*
195
Entwurf zu einer Tapetenborte von Max Pusciimann, Dresden.
situierten Deutschen vor Augen führen, dann wird uns
beim flüchtigen Betrachten der Sprung von einem
Gemach zum nächsten gewaltig erscheinen, bei ein-
gehender Erwägung der Gründe aber, die solche
Wandlung hervorbrachten, werden wir kaum erstaunen
können.
Da steht ein romanisches Zimmer. Die Zeit des
Mahles ist herangekommen; auf festen Böcken liegen
lange Bretter, lose Bänke und einzelne Schemel sind
an den so gebildeten Tisch herangeschoben. An der
Wand steht ein Schrank mit grossen, ebenen Flächen,
über die sich Eisenbeschläge, die Bretter zusammen-
haltend, hinziehen. Das Gemach ist ein wenig schmuck-
los und leer, und man fühlt es gewissermassen dem
Tische und den Sitzen an, dass bald der Moment
kommt, wo die Böcke und die Tischbretter hinaus-
geschafft, wo die Sitze an die Wand gerückt werden
und wo der Saal, der eben noch dem Mahle diente,
zu allerlei Kurzweil hergerichtet wird. Das Ornament
ist schlicht und ruhig, wenn es überhaupt auftritt.
Es nimmt seine Motive aus den Einflüssen, die von
Rom und Byzanz kommen und verzichtet auf direkte
Lebenswahrheit, selbst wo es sich um einheimische
Vorbilder der Natur handelt. Wo Prunk angewandt
werden soll, wie bei den Ehrensitzen der Fürsten,
wird das Holz durch Vergoldung und Bemalung an-
sehnlicher gemacht.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass in jenen
Zeiten Einfachheit und Kampfbereitschaft sehr wich-
tige Lebensprinzipien waren. Wohl war das Deutsche
Reich der Mittelpunkt der europäischen Politik, aber
die Unsicherheit im eigenen Lande war noch über-
aus gross. Die Freien flüchteten sich vor den Über-
griffen der kleinen Fürsten in Städte und mussten
mit den Waffen in der Hand ihre Mauern verteidigen.
Bisweilen erging auch der lautere Kriegsruf gegen
den Feind an den Grenzen des Landes, und für die
Wahrung deutscher Sitten musste das Schwert ge-
zogen werden. So fehlte es an ruhevollem Behagen.
Man kam aus dem Gefühl, des Kriegslebens, aus den
Gewohnheiten des Lagerlebens nie recht heraus. Da
halfen denn auch die weltlichen und kirchlichen Be-
ziehungen zu Rom nicht viel. Es ging auf kunst-
gewerblichem Gebiete wie auf dem der Sprache:
«sie schrieben in römischerSprache, aber nach deutschen
Anschauungen und von deutschen Dingen". Der
Prunk ward äusserlich hinzugefügt, organisch konnte
er sich mit der Kunst des Hauses nicht verbinden.
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts zeigt
das deutsche Zimmer einen völlig anderen Charakter.
Schwer und behäbig steht der Tisch, schier unver-
rückbar, die Stühle werden schwerer, würdevoller, die
Bänke rücken näher an die Wand heran und ver-
binden sich wohl gar mit einem Holzgetäfel, das
hoch hinauf die Wände deckt. Die Schränke werden
grösser und reicher, ordnen sich aber gern der Archi-
tektur der Zimmerwände unter, so gut wie das Bett
und die Truhe das thun. Alles ist gewichtig, stän-
dig, für die Dauer geworden. Und gleichzeitig wird
ein erstaunlicher Reichtum der künstlerischen Ver-
zierung über die Möbel des Zimmers ausgegossen.
Die heimische Laubwelt, selbst die Gewächse des
Feldes steuern zu den geschnitzten Motiven bei; das
Wappenwerk spielt eine grosse Rolle und allerlei
Zinnen, Fialen, Wimberge zeigen, dass die ragenden
Burgen und die himmelanstrebenden Kirchen der
Phantasie des Bürgers von ganz besonderer Be-
deutung sind.
29*