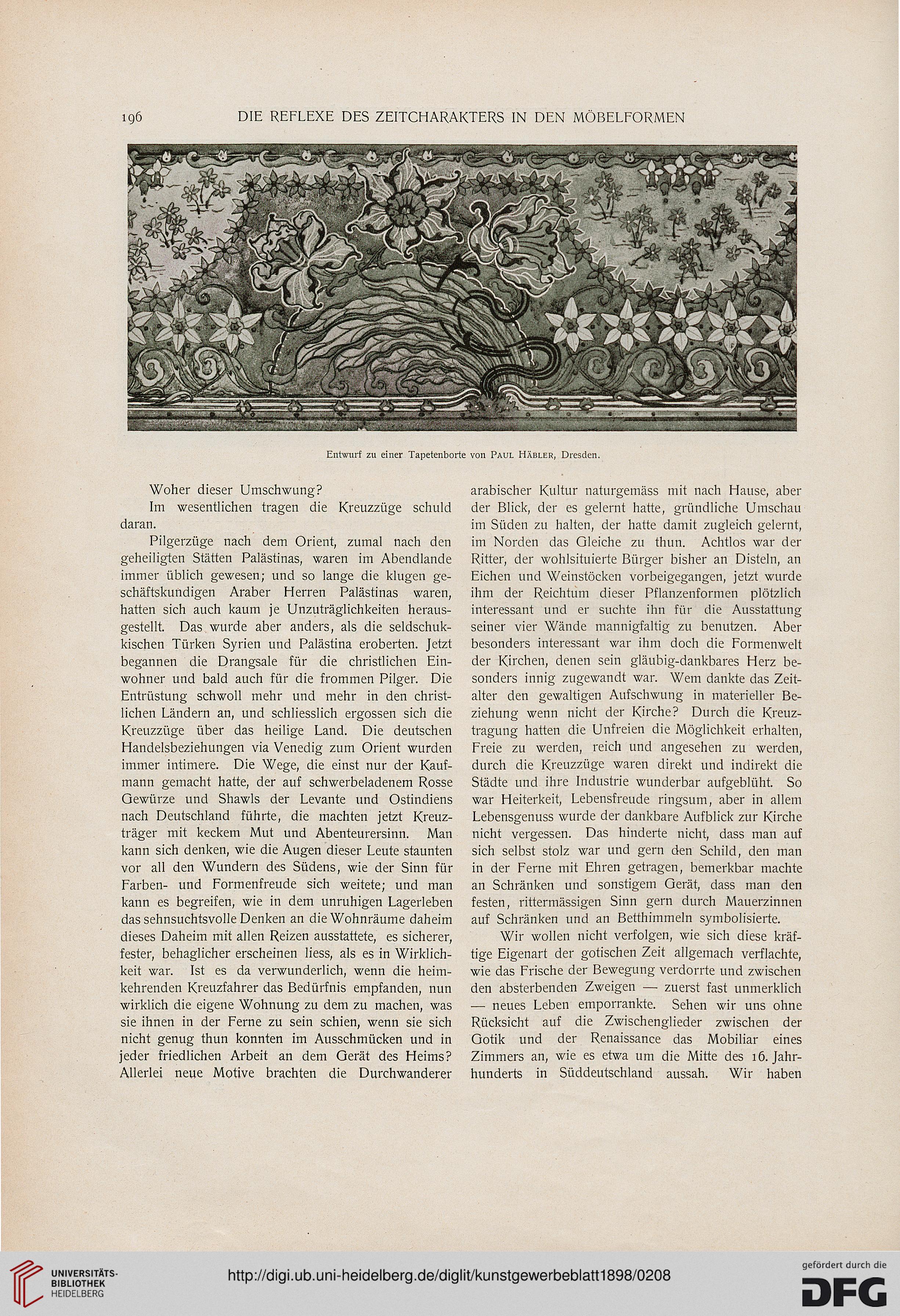196
DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN
Entwurf zu einer Tapetenborte von Paul Häbler, Dresden.
Woher dieser Umschwung?
Im wesentlichen tragen die Kreuzzüge schuld
daran.
Pilgerzüge nach dem Orient, zumal nach den
geheiligten Stätten Palästinas, waren im Abendlande
immer üblich gewesen; und so lange die klugen ge-
schäftskundigen Araber Herren Palästinas waren,
hatten sich auch kaum je Unzuträglichkeiten heraus-
gestellt. Das wurde aber anders, als die seldschuk-
kischen Türken Syrien und Palästina eroberten. Jetzt
begannen die Drangsale für die christlichen Ein-
wohner und bald auch für die frommen Pilger. Die
Entrüstung schwoll mehr und mehr in den christ-
lichen Ländern an, und schliesslich ergossen sich die
Kreuzzüge über das heilige Land. Die deutschen
Handelsbeziehungen via Venedig zum Orient wurden
immer intimere. Die Wege, die einst nur der Kauf-
mann gemacht hatte, der auf schwerbeladenem Rosse
Gewürze und Shawls der Levante und Ostindiens
nach Deutschland führte, die machten jetzt Kreuz-
träger mit keckem Mut und Abenteurersinn. Man
kann sich denken, wie die Augen dieser Leute staunten
vor all den Wundern des Südens, wie der Sinn für
Farben- und Formenfreude sich weitete; und man
kann es begreifen, wie in dem unruhigen Lagerleben
das sehnsuchtsvolle Denken an die Wohnräume daheim
dieses Daheim mit allen Reizen ausstattete, es sicherer,
fester, behaglicher erscheinen liess, als es in Wirklich-
keit war. Ist es da verwunderlich, wenn die heim-
kehrenden Kreuzfahrer das Bedürfnis empfanden, nun
wirklich die eigene Wohnung zu dem zu machen, was
sie ihnen in der Ferne zu sein schien, wenn sie sich
nicht genug thun konnten im Ausschmücken und in
jeder friedlichen Arbeit an dem Gerät des Heims?
Allerlei neue Motive brachten die Durchwanderer
arabischer Kultur naturgemäss mit nach Hause, aber
der Blick, der es gelernt hatte, gründliche Umschau
im Süden zu halten, der hatte damit zugleich gelernt,
im Norden das Gleiche zu thun. Achtlos war der
Ritter, der wohlsituierte Bürger bisher an Disteln, an
Eichen und Weinstöcken vorbeigegangen, jetzt wurde
ihm der Reichtum dieser Pflanzenformen plötzlich
interessant und er suchte ihn für die Ausstattung
seiner vier Wände mannigfaltig zu benutzen. Aber
besonders interessant war ihm doch die Formenwelt
der Kirchen, denen sein gläubig-dankbares Herz be-
sonders innig zugewandt war. Wem dankte das Zeit-
alter den gewaltigen Aufschwung in materieller Be-
ziehung wenn nicht der Kirche? Durch die Kreuz-
tragung hatten die Unfreien die Möglichkeit erhalten,
Freie zu werden, reich und angesehen zu werden,
durch die Kreuzzüge waren direkt und indirekt die
Städte und ihre Industrie wunderbar aufgeblüht. So
war Heiterkeit, Lebensfreude ringsum, aber in allem
Lebensgenuss wurde der dankbare Aufblick zur Kirche
nicht vergessen. Das hinderte nicht, dass man auf
sich selbst stolz war und gern den Schild, den man
in der Ferne mit Ehren getragen, bemerkbar machte
an Schränken und sonstigem Gerät, dass man den
festen, rittermässigen Sinn gern durch Mauerzinnen
auf Schränken und an Betthimmeln symbolisierte.
Wir wollen nicht verfolgen, wie sich diese kräf-
tige Eigenart der gotischen Zeit allgemach verflachte,
wie das Frische der Bewegung verdorrte und zwischen
den absterbenden Zweigen — zuerst fast unmerklich
— neues Leben emporrankte. Sehen wir uns ohne
Rücksicht auf die Zwischenglieder zwischen der
Gotik und der Renaissance das Mobiliar eines
Zimmers an, wie es etwa um die Mitte des 16. Jahr-
hunderts in Süddeutschland aussah. Wir haben
DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN
Entwurf zu einer Tapetenborte von Paul Häbler, Dresden.
Woher dieser Umschwung?
Im wesentlichen tragen die Kreuzzüge schuld
daran.
Pilgerzüge nach dem Orient, zumal nach den
geheiligten Stätten Palästinas, waren im Abendlande
immer üblich gewesen; und so lange die klugen ge-
schäftskundigen Araber Herren Palästinas waren,
hatten sich auch kaum je Unzuträglichkeiten heraus-
gestellt. Das wurde aber anders, als die seldschuk-
kischen Türken Syrien und Palästina eroberten. Jetzt
begannen die Drangsale für die christlichen Ein-
wohner und bald auch für die frommen Pilger. Die
Entrüstung schwoll mehr und mehr in den christ-
lichen Ländern an, und schliesslich ergossen sich die
Kreuzzüge über das heilige Land. Die deutschen
Handelsbeziehungen via Venedig zum Orient wurden
immer intimere. Die Wege, die einst nur der Kauf-
mann gemacht hatte, der auf schwerbeladenem Rosse
Gewürze und Shawls der Levante und Ostindiens
nach Deutschland führte, die machten jetzt Kreuz-
träger mit keckem Mut und Abenteurersinn. Man
kann sich denken, wie die Augen dieser Leute staunten
vor all den Wundern des Südens, wie der Sinn für
Farben- und Formenfreude sich weitete; und man
kann es begreifen, wie in dem unruhigen Lagerleben
das sehnsuchtsvolle Denken an die Wohnräume daheim
dieses Daheim mit allen Reizen ausstattete, es sicherer,
fester, behaglicher erscheinen liess, als es in Wirklich-
keit war. Ist es da verwunderlich, wenn die heim-
kehrenden Kreuzfahrer das Bedürfnis empfanden, nun
wirklich die eigene Wohnung zu dem zu machen, was
sie ihnen in der Ferne zu sein schien, wenn sie sich
nicht genug thun konnten im Ausschmücken und in
jeder friedlichen Arbeit an dem Gerät des Heims?
Allerlei neue Motive brachten die Durchwanderer
arabischer Kultur naturgemäss mit nach Hause, aber
der Blick, der es gelernt hatte, gründliche Umschau
im Süden zu halten, der hatte damit zugleich gelernt,
im Norden das Gleiche zu thun. Achtlos war der
Ritter, der wohlsituierte Bürger bisher an Disteln, an
Eichen und Weinstöcken vorbeigegangen, jetzt wurde
ihm der Reichtum dieser Pflanzenformen plötzlich
interessant und er suchte ihn für die Ausstattung
seiner vier Wände mannigfaltig zu benutzen. Aber
besonders interessant war ihm doch die Formenwelt
der Kirchen, denen sein gläubig-dankbares Herz be-
sonders innig zugewandt war. Wem dankte das Zeit-
alter den gewaltigen Aufschwung in materieller Be-
ziehung wenn nicht der Kirche? Durch die Kreuz-
tragung hatten die Unfreien die Möglichkeit erhalten,
Freie zu werden, reich und angesehen zu werden,
durch die Kreuzzüge waren direkt und indirekt die
Städte und ihre Industrie wunderbar aufgeblüht. So
war Heiterkeit, Lebensfreude ringsum, aber in allem
Lebensgenuss wurde der dankbare Aufblick zur Kirche
nicht vergessen. Das hinderte nicht, dass man auf
sich selbst stolz war und gern den Schild, den man
in der Ferne mit Ehren getragen, bemerkbar machte
an Schränken und sonstigem Gerät, dass man den
festen, rittermässigen Sinn gern durch Mauerzinnen
auf Schränken und an Betthimmeln symbolisierte.
Wir wollen nicht verfolgen, wie sich diese kräf-
tige Eigenart der gotischen Zeit allgemach verflachte,
wie das Frische der Bewegung verdorrte und zwischen
den absterbenden Zweigen — zuerst fast unmerklich
— neues Leben emporrankte. Sehen wir uns ohne
Rücksicht auf die Zwischenglieder zwischen der
Gotik und der Renaissance das Mobiliar eines
Zimmers an, wie es etwa um die Mitte des 16. Jahr-
hunderts in Süddeutschland aussah. Wir haben