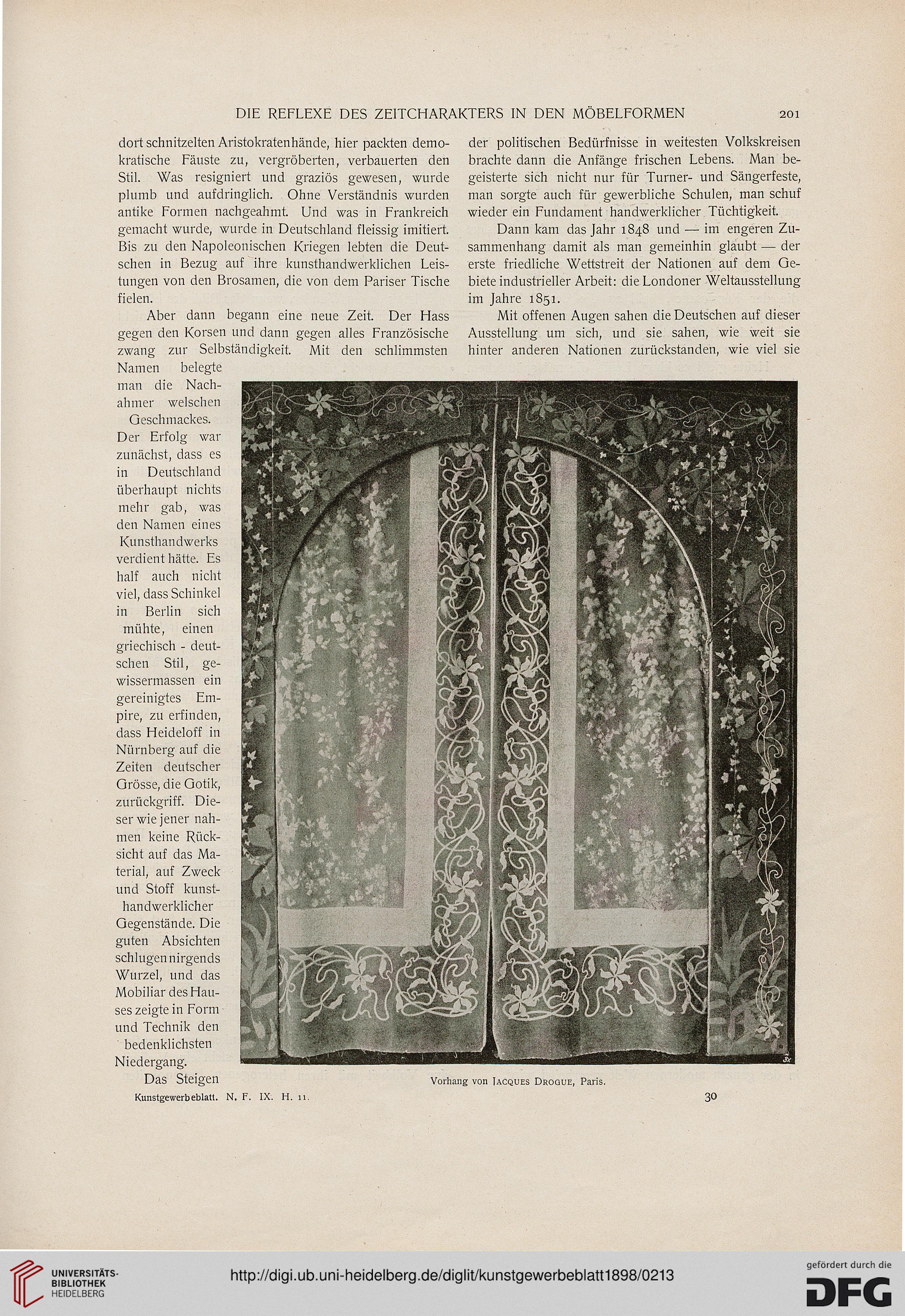DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN
201
dort schnitzelten Aristokratenhände, hier packten demo-
kratische Fäuste zu, vergröberten, verbauerten den
Stil. Was resigniert und graziös gewesen, wurde
plumb und aufdringlich. Ohne Verständnis wurden
antike Formen nachgeahmt. Und was in Frankreich
gemacht wurde, wurde in Deutschland fleissig imitiert.
Bis zu den Napoleonischen Kriegen lebten die Deut-
schen in Bezug auf ihre kunsthandwerklichen Leis-
tungen von den Brosamen, die von dem Pariser Tische
fielen.
Aber dann begann eine neue Zeit. Der Hass
gegen den Korsen und dann gegen alles Französische
zwang zur Selbständigkeit. Mit den schlimmsten
Namen belegte
man die Nach-
ahmer welschen
Geschmackes.
Der Erfolg war
zunächst, dass es
in Deutschland
überhaupt nichts
mehr gab, was
den Namen eines
Kunsthandwerks
verdient hätte. Es
half auch nicht
viel, dass Schinkel
in Berlin sich
mühte, einen
griechisch - deut-
schen Stil, ge-
wissermassen ein
gereinigtes Em-
pire, zu erfinden,
dass Heideloff in
Nürnberg auf die
Zeiten deutscher
Grösse, die Gotik,
zurückgriff. Die-
ser wie jener nah-
men keine Rück-
sicht auf das Ma-
terial, auf Zweck
und Stoff kunst-
handwerklicher
Gegenstände. Die
guten Absichten
schlugen nirgends
Wurzel, und das
Mobiliar des Hau-
ses zeigte in Form
und Technik den
bedenklichsten
Niedergang.
Das Steigen
Kunstgewerbeblau. N. F. IX. H. n.
der politischen Bedürfnisse in weitesten Volkskreisen
brachte dann die Anfänge frischen Lebens. Man be-
geisterte sich nicht nur für Turner- und Sängerfeste,
man sorgte auch für gewerbliche Schulen, man schuf
wieder ein Fundament handwerklicher Tüchtigkeit.
Dann kam das Jahr 1848 und — im engeren Zu-
sammenhang damit als man gemeinhin glaubt — der
erste friedliche Wettstreit der Nationen auf dem Ge-
biete industrieller Arbeit: die Londoner Weltausstellung
im Jahre 1851.
Mit offenen Augen sahen die Deutschen auf dieser
Ausstellung um sich, und sie sahen, wie weit sie
hinter anderen Nationen zurückstanden, wie viel sie
Vorhang von Iacques Droque, Paris.
30
201
dort schnitzelten Aristokratenhände, hier packten demo-
kratische Fäuste zu, vergröberten, verbauerten den
Stil. Was resigniert und graziös gewesen, wurde
plumb und aufdringlich. Ohne Verständnis wurden
antike Formen nachgeahmt. Und was in Frankreich
gemacht wurde, wurde in Deutschland fleissig imitiert.
Bis zu den Napoleonischen Kriegen lebten die Deut-
schen in Bezug auf ihre kunsthandwerklichen Leis-
tungen von den Brosamen, die von dem Pariser Tische
fielen.
Aber dann begann eine neue Zeit. Der Hass
gegen den Korsen und dann gegen alles Französische
zwang zur Selbständigkeit. Mit den schlimmsten
Namen belegte
man die Nach-
ahmer welschen
Geschmackes.
Der Erfolg war
zunächst, dass es
in Deutschland
überhaupt nichts
mehr gab, was
den Namen eines
Kunsthandwerks
verdient hätte. Es
half auch nicht
viel, dass Schinkel
in Berlin sich
mühte, einen
griechisch - deut-
schen Stil, ge-
wissermassen ein
gereinigtes Em-
pire, zu erfinden,
dass Heideloff in
Nürnberg auf die
Zeiten deutscher
Grösse, die Gotik,
zurückgriff. Die-
ser wie jener nah-
men keine Rück-
sicht auf das Ma-
terial, auf Zweck
und Stoff kunst-
handwerklicher
Gegenstände. Die
guten Absichten
schlugen nirgends
Wurzel, und das
Mobiliar des Hau-
ses zeigte in Form
und Technik den
bedenklichsten
Niedergang.
Das Steigen
Kunstgewerbeblau. N. F. IX. H. n.
der politischen Bedürfnisse in weitesten Volkskreisen
brachte dann die Anfänge frischen Lebens. Man be-
geisterte sich nicht nur für Turner- und Sängerfeste,
man sorgte auch für gewerbliche Schulen, man schuf
wieder ein Fundament handwerklicher Tüchtigkeit.
Dann kam das Jahr 1848 und — im engeren Zu-
sammenhang damit als man gemeinhin glaubt — der
erste friedliche Wettstreit der Nationen auf dem Ge-
biete industrieller Arbeit: die Londoner Weltausstellung
im Jahre 1851.
Mit offenen Augen sahen die Deutschen auf dieser
Ausstellung um sich, und sie sahen, wie weit sie
hinter anderen Nationen zurückstanden, wie viel sie
Vorhang von Iacques Droque, Paris.
30