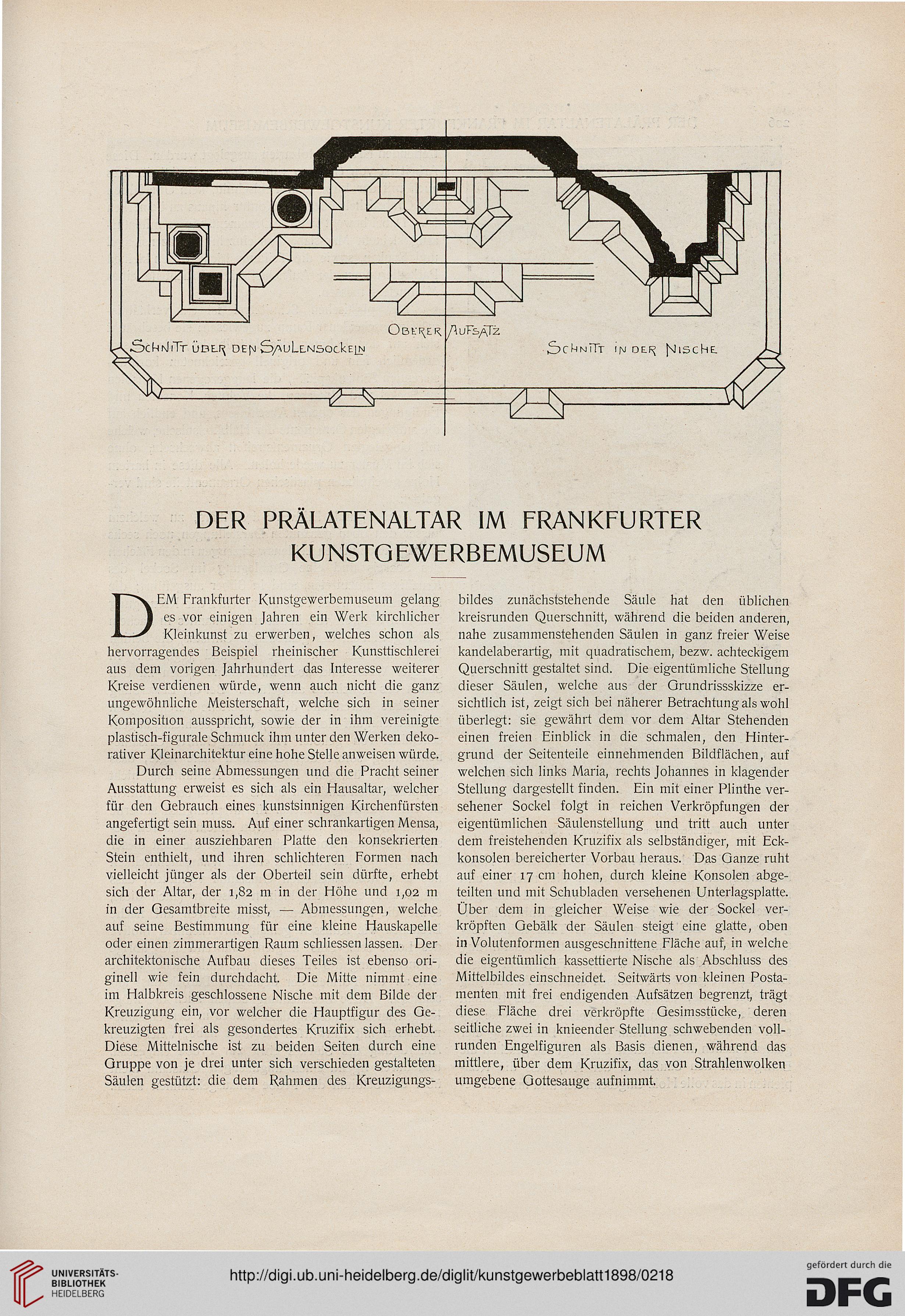ixhfJiTr ÜDt^ de|m S/\uLe:nsoc1<eijn
=^
.Sc^nTTt in def^ pJischE.
ö
DER PRÄLATENALTAR IM FRANKFURTER
KUNSTGEWERBEMUSEUM
DEM Frankfurter Kunstgewerbemuseum gelang
es vor einigen Jahren ein Werk kirchlicher
Kleinkunst zu erwerben, welches schon als
hervorragendes Beispiel rheinischer Kunsttischlerei
aus dem vorigen Jahrhundert das Interesse weiterer
Kreise verdienen würde, wenn auch nicht die ganz
ungewöhnliche Meisterschaft, welche sich in seiner
Komposition ausspricht, sowie der in ihm vereinigte
plastisch-figurale Schmuck ihm unter den Werken deko-
rativer Kleinarchitektur eine hohe Stelle anweisen würde.
Durch seine Abmessungen und die Pracht seiner
Ausstattung erweist es sich als ein Hausaltar, welcher
für den Gebrauch eines kunstsinnigen Kirchenfürsten
angefertigt sein muss. Auf einer schrankartigen Mensa,
die in einer ausziehbaren Platte den konsekrierten
Stein enthielt, und ihren schlichteren Formen nach
vielleicht jünger als der Oberteil sein dürfte, erhebt
sich der Altar, der 1,82 m in der Höhe und 1,02 m
in der Gesamtbreite misst, — Abmessungen, welche
auf seine Bestimmung für eine kleine Hauskapelle
oder einen zimmerartigen Raum schliessen lassen. Der
architektonische Aufbau dieses Teiles ist ebenso ori-
ginell wie fein durchdacht. Die Mitte nimmt eine
im Halbkreis geschlossene Nische mit dem Bilde der
Kreuzigung ein, vor welcher die Hauptfigur des Ge-
kreuzigten frei als gesondertes Kruzifix sich erhebt.
Diese Mittelnische ist zu beiden Seiten durch eine
Gruppe von je drei unter sich verschieden gestalteten
Säulen gestützt: die dem Rahmen des Kreuzigungs-
bildes zunächststehende Säule hat den üblichen
kreisrunden Querschnitt, während die beiden anderen,
nahe zusammenstehenden Säulen in ganz freier Weise
kandelaberartig, mit quadratischem, bezw. achteckigem
Querschnitt gestaltet sind. Die eigentümliche Stellung
dieser Säulen, welche aus der Grundrissskizze er-
sichtlich ist, zeigt sich bei näherer Betrachtung als wohl
überlegt: sie gewährt dem vor dem Altar Stehenden
einen freien Einblick in die schmalen, den Hinter-
grund der Seitenteile einnehmenden Bildflächen, auf
welchen sich links Maria, rechts Johannes in klagender
Stellung dargestellt finden. Ein mit einer Plinthe ver-
sehener Sockel folgt in reichen Verkröpfungen der
eigentümlichen Säulenstellung und tritt auch unter
dem freistehenden Kruzifix als selbständiger, mit Eck-
konsolen bereicherter Vorbau heraus. Das Ganze ruht
auf einer 17 cm hohen, durch kleine Konsolen abge-
teilten und mit Schubladen versehenen Unterlagsplatte.
Über dem in gleicher Weise wie der Sockel ver-
kröpften Gebälk der Säulen steigt eine glatte, oben
in Volutenformen ausgeschnittene Fläche auf, in welche
die eigentümlich kassettierte Nische als Abschluss des
Mittelbildes einschneidet. Seitwärts von kleinen Posta-
menten mit frei endigenden Aufsätzen begrenzt, trägt
diese Fläche drei verkröpfte Gesimsstücke, deren
seitliche zwei in knieender Stellung schwebenden voll-
runden Engelfiguren als Basis dienen, während das
mittlere, über dem Kruzifix, das von Strahlenwolken
umgebene Gottesauge aufnimmt.
=^
.Sc^nTTt in def^ pJischE.
ö
DER PRÄLATENALTAR IM FRANKFURTER
KUNSTGEWERBEMUSEUM
DEM Frankfurter Kunstgewerbemuseum gelang
es vor einigen Jahren ein Werk kirchlicher
Kleinkunst zu erwerben, welches schon als
hervorragendes Beispiel rheinischer Kunsttischlerei
aus dem vorigen Jahrhundert das Interesse weiterer
Kreise verdienen würde, wenn auch nicht die ganz
ungewöhnliche Meisterschaft, welche sich in seiner
Komposition ausspricht, sowie der in ihm vereinigte
plastisch-figurale Schmuck ihm unter den Werken deko-
rativer Kleinarchitektur eine hohe Stelle anweisen würde.
Durch seine Abmessungen und die Pracht seiner
Ausstattung erweist es sich als ein Hausaltar, welcher
für den Gebrauch eines kunstsinnigen Kirchenfürsten
angefertigt sein muss. Auf einer schrankartigen Mensa,
die in einer ausziehbaren Platte den konsekrierten
Stein enthielt, und ihren schlichteren Formen nach
vielleicht jünger als der Oberteil sein dürfte, erhebt
sich der Altar, der 1,82 m in der Höhe und 1,02 m
in der Gesamtbreite misst, — Abmessungen, welche
auf seine Bestimmung für eine kleine Hauskapelle
oder einen zimmerartigen Raum schliessen lassen. Der
architektonische Aufbau dieses Teiles ist ebenso ori-
ginell wie fein durchdacht. Die Mitte nimmt eine
im Halbkreis geschlossene Nische mit dem Bilde der
Kreuzigung ein, vor welcher die Hauptfigur des Ge-
kreuzigten frei als gesondertes Kruzifix sich erhebt.
Diese Mittelnische ist zu beiden Seiten durch eine
Gruppe von je drei unter sich verschieden gestalteten
Säulen gestützt: die dem Rahmen des Kreuzigungs-
bildes zunächststehende Säule hat den üblichen
kreisrunden Querschnitt, während die beiden anderen,
nahe zusammenstehenden Säulen in ganz freier Weise
kandelaberartig, mit quadratischem, bezw. achteckigem
Querschnitt gestaltet sind. Die eigentümliche Stellung
dieser Säulen, welche aus der Grundrissskizze er-
sichtlich ist, zeigt sich bei näherer Betrachtung als wohl
überlegt: sie gewährt dem vor dem Altar Stehenden
einen freien Einblick in die schmalen, den Hinter-
grund der Seitenteile einnehmenden Bildflächen, auf
welchen sich links Maria, rechts Johannes in klagender
Stellung dargestellt finden. Ein mit einer Plinthe ver-
sehener Sockel folgt in reichen Verkröpfungen der
eigentümlichen Säulenstellung und tritt auch unter
dem freistehenden Kruzifix als selbständiger, mit Eck-
konsolen bereicherter Vorbau heraus. Das Ganze ruht
auf einer 17 cm hohen, durch kleine Konsolen abge-
teilten und mit Schubladen versehenen Unterlagsplatte.
Über dem in gleicher Weise wie der Sockel ver-
kröpften Gebälk der Säulen steigt eine glatte, oben
in Volutenformen ausgeschnittene Fläche auf, in welche
die eigentümlich kassettierte Nische als Abschluss des
Mittelbildes einschneidet. Seitwärts von kleinen Posta-
menten mit frei endigenden Aufsätzen begrenzt, trägt
diese Fläche drei verkröpfte Gesimsstücke, deren
seitliche zwei in knieender Stellung schwebenden voll-
runden Engelfiguren als Basis dienen, während das
mittlere, über dem Kruzifix, das von Strahlenwolken
umgebene Gottesauge aufnimmt.