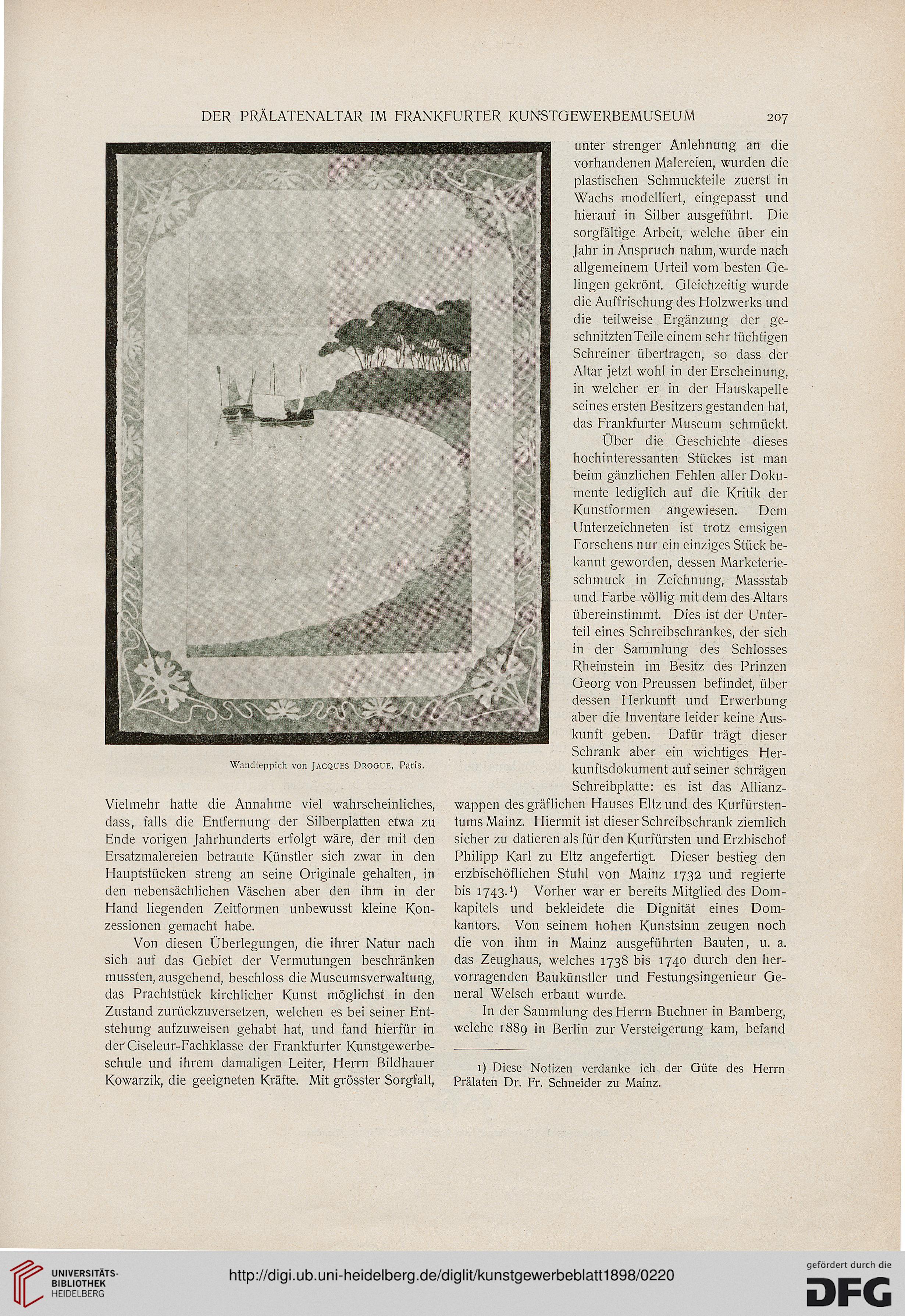DER PRÄLATENALTAR IM FRANKFURTER KUNSTGEWERBEMUSEUM
207
Wandteppich von Jacques Drooue, Paris.
Vielmehr hatte die Annahme viel wahrscheinliches,
dass, falls die Entfernung der Silberplatten etwa zu
Ende vorigen Jahrhunderts erfolgt wäre, der mit den
Ersatzmalereien betraute Künstler sich zwar in den
Hauptstücken streng an seine Originale gehalten, in
den nebensächlichen Väschen aber den ihm in der
Hand liegenden Zeitformen unbewusst kleine Kon-
zessionen gemacht habe.
Von diesen Überlegungen, die ihrer Natur nach
sich auf das Gebiet der Vermutungen beschränken
mussten, ausgehend, beschloss die Museumsverwaltung,
das Prachtstück kirchlicher Kunst möglichst in den
Zustand zurückzuversetzen, welchen es bei seiner Ent-
stehung aufzuweisen gehabt hat, und fand hierfür in
der Ciseleur-Fachklasse der Frankfurter Kunstgewerbe-
schule und ihrem damaligen Leiter, Herrn Bildhauer
Kowarzik, die geeigneten Kräfte. Mit grösster Sorgfalt,
unter strenger Anlehnung an die
vorhandenen Malereien, wurden die
plastischen Schmuckteile zuerst in
Wachs modelliert, eingepasst und
hierauf in Silber ausgeführt. Die
sorgfältige Arbeit, welche über ein
Jahr in Anspruch nahm, wurde nach
allgemeinem Urteil vom besten Ge-
lingen gekrönt. Gleichzeitig wurde
die Auffrischung des Holzwerks und
die teilweise Ergänzung der ge-
schnitzten Teile einem sehr tüchtigen
Schreiner übertragen, so dass der
Altar jetzt wohl in der Erscheinung,
in welcher er in der Hauskapelle
seines ersten Besitzers gestanden hat,
das Frankfurter Museum schmückt.
Über die Geschichte dieses
hochinteressanten Stückes ist man
beim gänzlichen Fehlen aller Doku-
mente lediglich auf die Kritik der
Kunstformen angewiesen. Dem
Unterzeichneten ist trotz emsigen
Forschens nur ein einziges Stück be-
kannt geworden, dessen Marketerie-
schmuck in Zeichnung, Massstab
und Farbe völlig mit dem des Altars
übereinstimmt. Dies ist der Unter-
teil eines Schreibschrankes, der sich
in der Sammlung des Schlosses
Rheinstein im Besitz des Prinzen
Georg von Preussen befindet, über
dessen Herkunft und Erwerbung
aber die Inventare leider keine Aus-
kunft geben. Dafür trägt dieser
Schrank aber ein wichtiges Her-
kunftsdokument auf seiner schrägen
Schreibplatte: es ist das Allianz-
wappen des gräflichen Hauses Eltz und des Kurfürsten-
tums Mainz. Hiermit ist dieser Schreibschrank ziemlich
sicher zu datieren als für den Kurfürsten und Erzbischof
Philipp Karl zu Eltz angefertigt. Dieser bestieg den
erzbischöflichen Stuhl von Mainz 1732 und regierte
bis 1743.1) Vorher war er bereits Mitglied des Dom-
kapitels und bekleidete die Dignität eines Dom-
kantors. Von seinem hohen Kunstsinn zeugen noch
die von ihm in Mainz ausgeführten Bauten, u. a.
das Zeughaus, welches 1738 bis 1740 durch den her-
vorragenden Baukünstler und Festungsingenieur Ge-
neral Welsch erbaut wurde.
In der Sammlung des Herrn Buchner in Bamberg,
welche 188g in Berlin zur Versteigerung kam, befand
1) Diese Notizen verdanke ich der Güte des Herrn
Prälaten Dr. Fr. Schneider zu Mainz.
207
Wandteppich von Jacques Drooue, Paris.
Vielmehr hatte die Annahme viel wahrscheinliches,
dass, falls die Entfernung der Silberplatten etwa zu
Ende vorigen Jahrhunderts erfolgt wäre, der mit den
Ersatzmalereien betraute Künstler sich zwar in den
Hauptstücken streng an seine Originale gehalten, in
den nebensächlichen Väschen aber den ihm in der
Hand liegenden Zeitformen unbewusst kleine Kon-
zessionen gemacht habe.
Von diesen Überlegungen, die ihrer Natur nach
sich auf das Gebiet der Vermutungen beschränken
mussten, ausgehend, beschloss die Museumsverwaltung,
das Prachtstück kirchlicher Kunst möglichst in den
Zustand zurückzuversetzen, welchen es bei seiner Ent-
stehung aufzuweisen gehabt hat, und fand hierfür in
der Ciseleur-Fachklasse der Frankfurter Kunstgewerbe-
schule und ihrem damaligen Leiter, Herrn Bildhauer
Kowarzik, die geeigneten Kräfte. Mit grösster Sorgfalt,
unter strenger Anlehnung an die
vorhandenen Malereien, wurden die
plastischen Schmuckteile zuerst in
Wachs modelliert, eingepasst und
hierauf in Silber ausgeführt. Die
sorgfältige Arbeit, welche über ein
Jahr in Anspruch nahm, wurde nach
allgemeinem Urteil vom besten Ge-
lingen gekrönt. Gleichzeitig wurde
die Auffrischung des Holzwerks und
die teilweise Ergänzung der ge-
schnitzten Teile einem sehr tüchtigen
Schreiner übertragen, so dass der
Altar jetzt wohl in der Erscheinung,
in welcher er in der Hauskapelle
seines ersten Besitzers gestanden hat,
das Frankfurter Museum schmückt.
Über die Geschichte dieses
hochinteressanten Stückes ist man
beim gänzlichen Fehlen aller Doku-
mente lediglich auf die Kritik der
Kunstformen angewiesen. Dem
Unterzeichneten ist trotz emsigen
Forschens nur ein einziges Stück be-
kannt geworden, dessen Marketerie-
schmuck in Zeichnung, Massstab
und Farbe völlig mit dem des Altars
übereinstimmt. Dies ist der Unter-
teil eines Schreibschrankes, der sich
in der Sammlung des Schlosses
Rheinstein im Besitz des Prinzen
Georg von Preussen befindet, über
dessen Herkunft und Erwerbung
aber die Inventare leider keine Aus-
kunft geben. Dafür trägt dieser
Schrank aber ein wichtiges Her-
kunftsdokument auf seiner schrägen
Schreibplatte: es ist das Allianz-
wappen des gräflichen Hauses Eltz und des Kurfürsten-
tums Mainz. Hiermit ist dieser Schreibschrank ziemlich
sicher zu datieren als für den Kurfürsten und Erzbischof
Philipp Karl zu Eltz angefertigt. Dieser bestieg den
erzbischöflichen Stuhl von Mainz 1732 und regierte
bis 1743.1) Vorher war er bereits Mitglied des Dom-
kapitels und bekleidete die Dignität eines Dom-
kantors. Von seinem hohen Kunstsinn zeugen noch
die von ihm in Mainz ausgeführten Bauten, u. a.
das Zeughaus, welches 1738 bis 1740 durch den her-
vorragenden Baukünstler und Festungsingenieur Ge-
neral Welsch erbaut wurde.
In der Sammlung des Herrn Buchner in Bamberg,
welche 188g in Berlin zur Versteigerung kam, befand
1) Diese Notizen verdanke ich der Güte des Herrn
Prälaten Dr. Fr. Schneider zu Mainz.