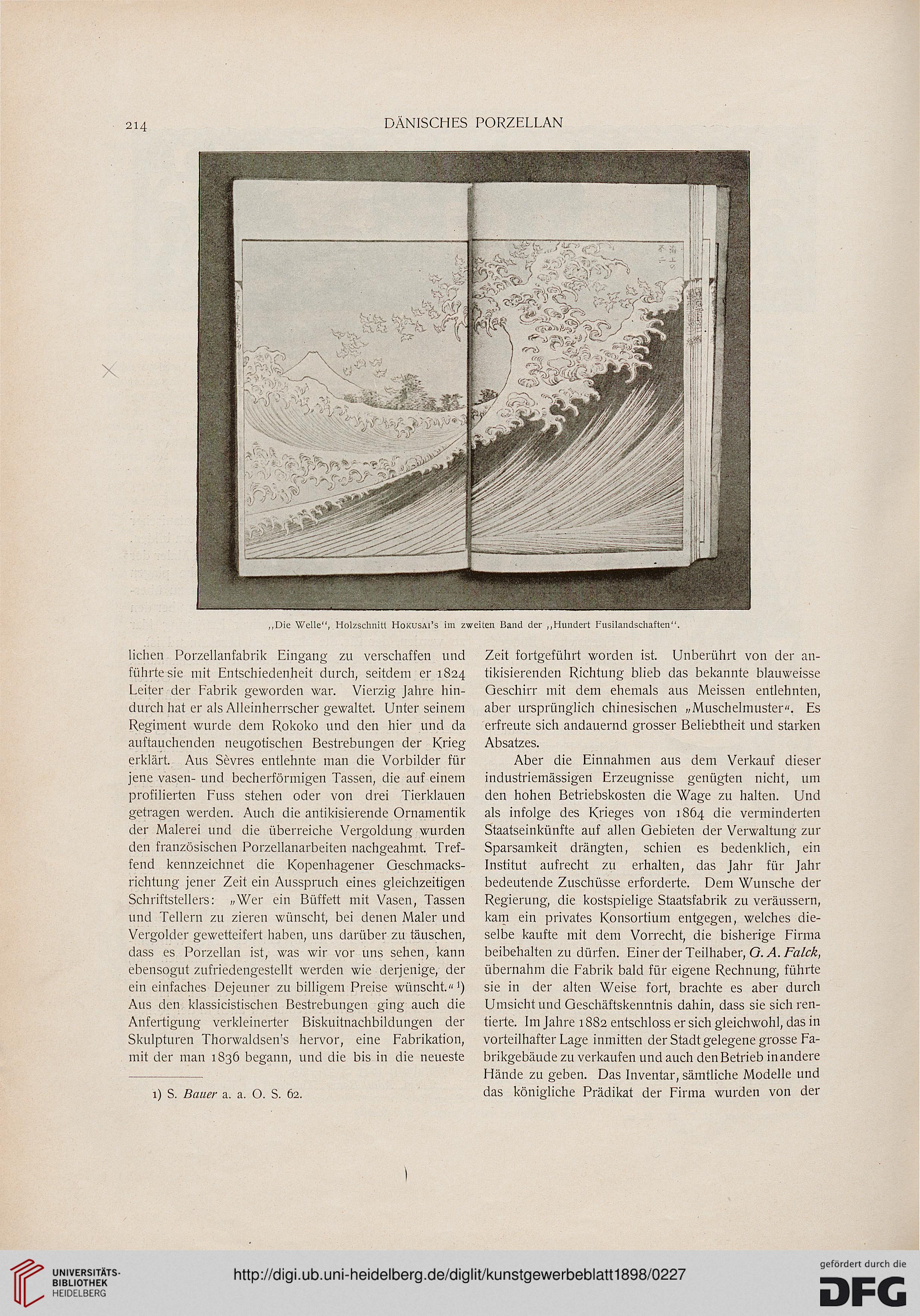214
DÄNISCHES PORZELLAN
„Die Welle", Holzschnitt Hokusai's im zweiten Band der „Hundert Fusilandschaften"
liehen Porzellanfabrik Eingang zu verschaffen und
führte sie mit Entschiedenheit durch, seitdem er 1824
Leiter der Fabrik geworden war. Vierzig Jahre hin-
durch hat er als Alleinherrscher gewaltet. Unter seinem
Regiment wurde dem Rokoko und den hier und da
auftauchenden neugotischen Bestrebungen der Krieg
erklärt. Aus Sevres entlehnte man die Vorbilder für
jene vasen- und becherförmigen Tassen, die auf einem
profilierten Fuss stehen oder von drei Tierklauen
getragen werden. Auch die antikisierende Ornamentik
der Malerei und die überreiche Vergoldung wurden
den französischen Porzellanarbeiten nachgeahmt. Tref-
fend kennzeichnet die Kopenhagener Geschmacks-
richtung jener Zeit ein Ausspruch eines gleichzeitigen
Schriftstellers: „Wer ein Buffett mit Vasen, Tassen
und Tellern zu zieren wünscht, bei denen Maler und
Vergolder gewetteifert haben, uns darüber zu täuschen,
dass es Porzellan ist, was wir vor uns sehen, kann
ebensogut zufriedengestellt werden wie derjenige, der
ein einfaches Dejeuner zu billigem Preise wünscht."1)
Aus den klassicistischen Bestrebungen ging auch die
Anfertigung verkleinerter Biskuitnachbildungen der
Skulpturen Thorwaldsen's hervor, eine Fabrikation,
mit der man 1836 begann, und die bis in die neueste
1) S. Bauer a. a. O. S. 62.
Zeit fortgeführt worden ist. Unberührt von der an-
tikisierenden Richtung blieb das bekannte blauweisse
Geschirr mit dem ehemals aus Meissen entlehnten,
aber ursprünglich chinesischen „Muschelmuster". Es
erfreute sich andauernd grosser Beliebtheit und starken
Absatzes.
Aber die Einnahmen aus dem Verkauf dieser
industriemässigen Erzeugnisse genügten nicht, um
den hohen Betriebskosten die Wage zu halten. Und
als infolge des Krieges von 1864 die verminderten
Staatseinkünfte auf allen Gebieten der Verwaltung zur
Sparsamkeit drängten, schien es bedenklich, ein
Institut aufrecht zu erhalten, das Jahr für Jahr
bedeutende Zuschüsse erforderte. Dem Wunsche der
Regierung, die kostspielige Staatsfabrik zu veräussern,
kam ein privates Konsortium entgegen, welches die-
selbe kaufte mit dem Vorrecht, die bisherige Firma
beibehalten zu dürfen. Einer der Teilhaber, G.A.Falck,
übernahm die Fabrik bald für eigene Rechnung, führte
sie in der alten Weise fort, brachte es aber durch
Umsicht und Geschäftskenntnis dahin, dass sie sich ren-
tierte. Im Jahre 1882 entschloss er sich gleichwohl, das in
vorteilhafter Lage inmitten der Stadt gelegene grosse Fa-
brikgebäude zu verkaufen und auch den Betrieb in andere
Hände zu geben. Das Inventar, sämtliche Modelle und
das königliche Prädikat der Firma wurden von der
DÄNISCHES PORZELLAN
„Die Welle", Holzschnitt Hokusai's im zweiten Band der „Hundert Fusilandschaften"
liehen Porzellanfabrik Eingang zu verschaffen und
führte sie mit Entschiedenheit durch, seitdem er 1824
Leiter der Fabrik geworden war. Vierzig Jahre hin-
durch hat er als Alleinherrscher gewaltet. Unter seinem
Regiment wurde dem Rokoko und den hier und da
auftauchenden neugotischen Bestrebungen der Krieg
erklärt. Aus Sevres entlehnte man die Vorbilder für
jene vasen- und becherförmigen Tassen, die auf einem
profilierten Fuss stehen oder von drei Tierklauen
getragen werden. Auch die antikisierende Ornamentik
der Malerei und die überreiche Vergoldung wurden
den französischen Porzellanarbeiten nachgeahmt. Tref-
fend kennzeichnet die Kopenhagener Geschmacks-
richtung jener Zeit ein Ausspruch eines gleichzeitigen
Schriftstellers: „Wer ein Buffett mit Vasen, Tassen
und Tellern zu zieren wünscht, bei denen Maler und
Vergolder gewetteifert haben, uns darüber zu täuschen,
dass es Porzellan ist, was wir vor uns sehen, kann
ebensogut zufriedengestellt werden wie derjenige, der
ein einfaches Dejeuner zu billigem Preise wünscht."1)
Aus den klassicistischen Bestrebungen ging auch die
Anfertigung verkleinerter Biskuitnachbildungen der
Skulpturen Thorwaldsen's hervor, eine Fabrikation,
mit der man 1836 begann, und die bis in die neueste
1) S. Bauer a. a. O. S. 62.
Zeit fortgeführt worden ist. Unberührt von der an-
tikisierenden Richtung blieb das bekannte blauweisse
Geschirr mit dem ehemals aus Meissen entlehnten,
aber ursprünglich chinesischen „Muschelmuster". Es
erfreute sich andauernd grosser Beliebtheit und starken
Absatzes.
Aber die Einnahmen aus dem Verkauf dieser
industriemässigen Erzeugnisse genügten nicht, um
den hohen Betriebskosten die Wage zu halten. Und
als infolge des Krieges von 1864 die verminderten
Staatseinkünfte auf allen Gebieten der Verwaltung zur
Sparsamkeit drängten, schien es bedenklich, ein
Institut aufrecht zu erhalten, das Jahr für Jahr
bedeutende Zuschüsse erforderte. Dem Wunsche der
Regierung, die kostspielige Staatsfabrik zu veräussern,
kam ein privates Konsortium entgegen, welches die-
selbe kaufte mit dem Vorrecht, die bisherige Firma
beibehalten zu dürfen. Einer der Teilhaber, G.A.Falck,
übernahm die Fabrik bald für eigene Rechnung, führte
sie in der alten Weise fort, brachte es aber durch
Umsicht und Geschäftskenntnis dahin, dass sie sich ren-
tierte. Im Jahre 1882 entschloss er sich gleichwohl, das in
vorteilhafter Lage inmitten der Stadt gelegene grosse Fa-
brikgebäude zu verkaufen und auch den Betrieb in andere
Hände zu geben. Das Inventar, sämtliche Modelle und
das königliche Prädikat der Firma wurden von der