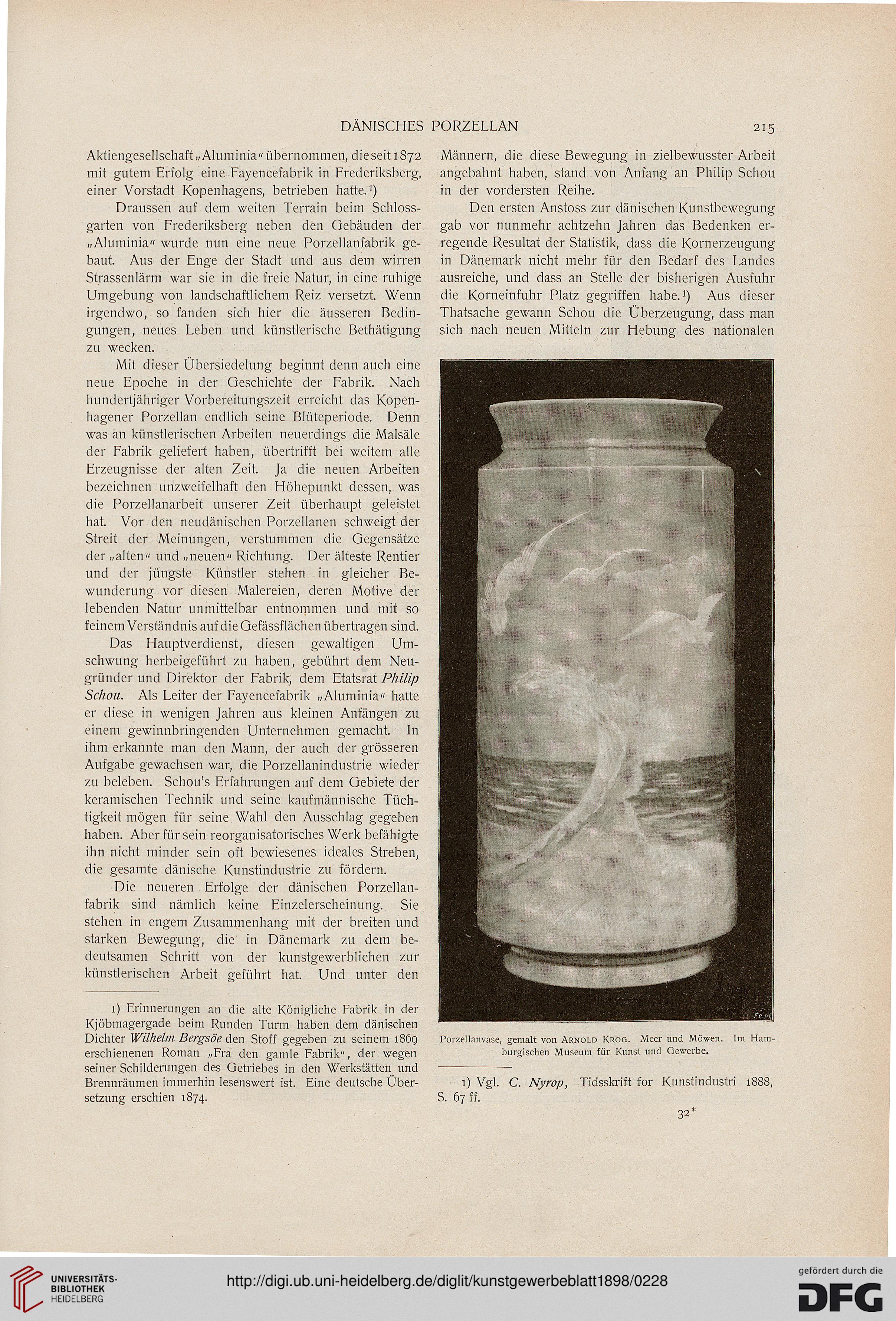DÄNISCHES PORZELLAN
215
Aktiengesellschaft „Aluminia" übernommen, dieseiti872
mit gutem Erfolg eine Fayencefabrik in Frederiksberg,
einer Vorstadt Kopenhagens, betrieben hatte.1)
Draussen auf dem weiten Terrain beim Schloss-
garten von Frederiksberg neben den Gebäuden der
„Aluminia" wurde nun eine neue Porzellanfabrik ge-
baut. Aus der Enge der Stadt und aus dem wirren
Strassenlärm war sie in die freie Natur, in eine ruhige
Umgebung von landschaftlichem Reiz versetzt. Wenn
irgendwo, so fanden sich hier die äusseren Bedin-
gungen, neues Leben und künstlerische Bethätigung
zu wecken.
Mit dieser Übersiedelung beginnt denn auch eine
neue Epoche in der Geschichte der Fabrik. Nach
hundertjähriger Vorbereitungszeit erreicht das Kopen-
hagener Porzellan endlich seine Blüteperiode. Denn
was an künstlerischen Arbeiten neuerdings die Malsäle
der Fabrik geliefert haben, übertrifft bei weitem alle
Erzeugnisse der alten Zeit. Ja die neuen Arbeiten
bezeichnen unzweifelhaft den Höhepunkt dessen, was
die Porzellanarbeit unserer Zeit überhaupt geleistet
hat. Vor den neudänischen Porzellanen schweigt der
Streit der Meinungen, verstummen die Gegensätze
der „alten" und „neuen» Richtung. Der älteste Rentier
und der jüngste Künstler stehen in gleicher Be-
wunderung vor diesen Malereien, deren Motive der
lebenden Natur unmittelbar entnommen und mit so
feinem Verständnis auf die Gefässflächen übertragen sind.
Das Hauptverdienst, diesen gewaltigen Um-
schwung herbeigeführt zu haben, gebührt dem Neu-
gründer und Direktor der Fabrik, dem Etatsrat Philip
Schou. Als Leiter der Fayencefabrik „Aluminia« hatte
er diese in wenigen Jahren aus kleinen Anfängen zu
einem gewinnbringenden Unternehmen gemacht. In
ihm erkannte man den Mann, der auch der grösseren
Aufgabe gewachsen war, die Porzellanindustrie wieder
zu beleben. Schou's Erfahrungen auf dem Gebiete der
keramischen Technik und seine kaufmännische Tüch-
tigkeit mögen für seine Wahl den Ausschlag gegeben
haben. Aber für sein reorganisatorisches Werk befähigte
ihn nicht minder sein oft bewiesenes ideales Streben,
die gesamte dänische Kunstindustrie zu fördern.
Die neueren Erfolge der dänischen Porzellan-
fabrik sind nämlich keine Einzelerscheinung. Sie
stehen in engem Zusammenhang mit der breiten und
starken Bewegung, die in Dänemark zu dem be-
deutsamen Schritt von der kunstgewerblichen zur
künstlerischen Arbeit geführt hat. Und unter den
1) Erinnerungen an die alte Königliche Fabrik in der
Kjöbmagergade beim Runden Turm haben dem dänischen
Dichter Wilhelm Bergsöe den Stoff gegeben zu seinem 1869
erschienenen Roman „Fra den gamle Fabrik", der wegen
seiner Schilderungen des Getriebes in den Werkstätten und
Brennräumen immerhin lesenswert ist. Eine deutsche Ober-
setzung erschien 1874.
Männern, die diese Bewegung in zielbewusster Arbeit
angebahnt haben, stand von Anfang an Philip Schou
in der vordersten Reihe.
Den ersten Anstoss zur dänischen Kunstbewegung
gab vor nunmehr achtzehn Jahren das Bedenken er-
regende Resultat der Statistik, dass die Kornerzeugung
in Dänemark nicht mehr für den Bedarf des Landes
ausreiche, und dass an Stelle der bisherigen Ausfuhr
die Korneinfuhr Platz gegriffen habe.1) Aus dieser
Thatsache gewann Schou die Überzeugung, dass man
sich nach neuen Mitteln zur Hebung des nationalen
Porzellanvase, gemalt von Arnold Kroq. Meer und Möwen. Im Ham-
burgischen Museum für Kunst und Gewerbe.
1) Vgl. C. Nyrop, Tidsskrift for Kunstindustri 1888,
67 ff.
32*
215
Aktiengesellschaft „Aluminia" übernommen, dieseiti872
mit gutem Erfolg eine Fayencefabrik in Frederiksberg,
einer Vorstadt Kopenhagens, betrieben hatte.1)
Draussen auf dem weiten Terrain beim Schloss-
garten von Frederiksberg neben den Gebäuden der
„Aluminia" wurde nun eine neue Porzellanfabrik ge-
baut. Aus der Enge der Stadt und aus dem wirren
Strassenlärm war sie in die freie Natur, in eine ruhige
Umgebung von landschaftlichem Reiz versetzt. Wenn
irgendwo, so fanden sich hier die äusseren Bedin-
gungen, neues Leben und künstlerische Bethätigung
zu wecken.
Mit dieser Übersiedelung beginnt denn auch eine
neue Epoche in der Geschichte der Fabrik. Nach
hundertjähriger Vorbereitungszeit erreicht das Kopen-
hagener Porzellan endlich seine Blüteperiode. Denn
was an künstlerischen Arbeiten neuerdings die Malsäle
der Fabrik geliefert haben, übertrifft bei weitem alle
Erzeugnisse der alten Zeit. Ja die neuen Arbeiten
bezeichnen unzweifelhaft den Höhepunkt dessen, was
die Porzellanarbeit unserer Zeit überhaupt geleistet
hat. Vor den neudänischen Porzellanen schweigt der
Streit der Meinungen, verstummen die Gegensätze
der „alten" und „neuen» Richtung. Der älteste Rentier
und der jüngste Künstler stehen in gleicher Be-
wunderung vor diesen Malereien, deren Motive der
lebenden Natur unmittelbar entnommen und mit so
feinem Verständnis auf die Gefässflächen übertragen sind.
Das Hauptverdienst, diesen gewaltigen Um-
schwung herbeigeführt zu haben, gebührt dem Neu-
gründer und Direktor der Fabrik, dem Etatsrat Philip
Schou. Als Leiter der Fayencefabrik „Aluminia« hatte
er diese in wenigen Jahren aus kleinen Anfängen zu
einem gewinnbringenden Unternehmen gemacht. In
ihm erkannte man den Mann, der auch der grösseren
Aufgabe gewachsen war, die Porzellanindustrie wieder
zu beleben. Schou's Erfahrungen auf dem Gebiete der
keramischen Technik und seine kaufmännische Tüch-
tigkeit mögen für seine Wahl den Ausschlag gegeben
haben. Aber für sein reorganisatorisches Werk befähigte
ihn nicht minder sein oft bewiesenes ideales Streben,
die gesamte dänische Kunstindustrie zu fördern.
Die neueren Erfolge der dänischen Porzellan-
fabrik sind nämlich keine Einzelerscheinung. Sie
stehen in engem Zusammenhang mit der breiten und
starken Bewegung, die in Dänemark zu dem be-
deutsamen Schritt von der kunstgewerblichen zur
künstlerischen Arbeit geführt hat. Und unter den
1) Erinnerungen an die alte Königliche Fabrik in der
Kjöbmagergade beim Runden Turm haben dem dänischen
Dichter Wilhelm Bergsöe den Stoff gegeben zu seinem 1869
erschienenen Roman „Fra den gamle Fabrik", der wegen
seiner Schilderungen des Getriebes in den Werkstätten und
Brennräumen immerhin lesenswert ist. Eine deutsche Ober-
setzung erschien 1874.
Männern, die diese Bewegung in zielbewusster Arbeit
angebahnt haben, stand von Anfang an Philip Schou
in der vordersten Reihe.
Den ersten Anstoss zur dänischen Kunstbewegung
gab vor nunmehr achtzehn Jahren das Bedenken er-
regende Resultat der Statistik, dass die Kornerzeugung
in Dänemark nicht mehr für den Bedarf des Landes
ausreiche, und dass an Stelle der bisherigen Ausfuhr
die Korneinfuhr Platz gegriffen habe.1) Aus dieser
Thatsache gewann Schou die Überzeugung, dass man
sich nach neuen Mitteln zur Hebung des nationalen
Porzellanvase, gemalt von Arnold Kroq. Meer und Möwen. Im Ham-
burgischen Museum für Kunst und Gewerbe.
1) Vgl. C. Nyrop, Tidsskrift for Kunstindustri 1888,
67 ff.
32*